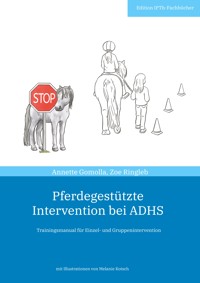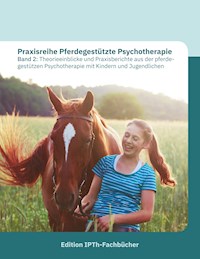
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Band 2 der Praxisreihe Pferdegestützte Psychotherapie gibt einen Einblick in den Einsatz und die Wirkung von Pferden in der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das Pferd ermöglicht eine emotionale Öffnung, dadurch kann Beziehung intensiviert und Emotionalität neu erlebt und genutzt werden. Das Pferd kann Geborgenheit, Wärme und Nähe schenken, es erleichtert den Klient*innen den Zugang zu sich und zum psychotherapeutischen Setting. Ebenso unterstützt es die/den Psychotherapeut*in in der Arbeit, unabhängig der psychotherapeutischen Ausrichtung. Das Buch gibt einen kurzen theoretischen Einblick in die Hintergründe der Pferdegestützten Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen und stellt danach im Schwerpunkt verschiedene Praxisbeispiele vor. Ein spannendes Buch für Psychotherapeut*innen, die sich mit dem Einsatz von Tieren beschäftigen ebenso wie für alle Interessierten im Feld der Pferdegestützten Therapie und Pädagogik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Pferdegestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen – eine Einführung
1.1. Fachtherapeut*innen und das Therapiepferd
1.2. Wirkungsweisen des Pferdes für die Pferdegestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
1.3. Methodische Zugänge in der Pferdegestützten Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
Praxisberichte
2.1 Praxisbericht 1
Eine Kombination aus kindzentrierter- und elternzentrierter Intervention
2.2 Praxisbericht 2
Pferdegestützte Intervention mit tiefenpsychologischem Schwerpunkt bei einer Jugendlichen mit Nähe versus Distanz Konflikt
2.3 Praxisbericht 3
Patientin mit Bindungsproblemen und Problemen in der Wahrnehmung von Grenzen
2.4 Praxisbericht 4
Patientin mit depressiver Störung und Agoraphobie
Autorinnenangaben
Einleitung
Der vorliegende Band 2 aus der Praxisreihe Pferdegestützte Psychotherapie widmet sich Erklärungen und Beschreibungen des Einsatzes von Pferden in psychotherapeutischen Kontexten mit Kindern und Jugendlichen. In Band 1 lag der Schwerpunkt auf der Arbeit mit erwachsenen Patient*innen aus der Verhaltenstherapie. In dem vorliegenden Buch werden Fallberichte aus unterschiedlichen psychotherapeutischen Hintergründen dargestellt und versucht, in der theoretischen Einführung zu Beginn einen Bogen über die Schulen hinweg zu schlagen. Tiere haben besonders bei Kindern einen starken Aufforderungscharakter, Kinder beschäftigen sich besonders gerne mit Tieren und diese können schon von daher eine hilfreiche Brücke sein, zu Kindern in Kontakt zu kommen. Ebenso werden Jugendliche erreichbar, die möglicherweise in anderen psychotherapeutischen Kontexten Mühe haben, einen Einblick in ihr Innenleben zuzulassen. Tiere im Allgemeinen können die kindliche Seite der Jugendlichen anklingen lassen und so einen Zugang für die Psychotherapie ermöglichen.
Das Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd. Dies war 2015 der Titel eines Vortrags bei der Konferenz „horses 4 humans“1. In diesem ging es darum, dass Pferde Wirkfaktoren in den therapeutischen Prozess einbringen, die das Pferd als Lebewesen mitbringt und die einzigartig sind. Dabei ist es dem Pferd selbstverständlich nicht bewusst, in welchem gedanklichen Kontext wir unsere psychotherapeutische Arbeit tun. Das Pferd stellt sich mit seinen Verhaltensweisen im Hier und Jetzt zur Verfügung, und wir binden es in unsere Konzepte mit ein. Dabei sollte jede/r Therapeut darauf bedacht sein, das, was ein Pferd so einzigartig in seiner Wesensart mitbringt, auch wirken zu lassen. Pferde sind feinfühlige und soziale Tiere, die im Kontakt mit anderen Lebewesen auf diese reagieren und ebenso eigenständige Impulse und arttypische Verhaltensweisen einbringen. Die Kunst in der Pferdegestützten Psychotherapie, ob mit Kindern oder Erwachsenen, ist es, diese Impulse der Tiere zu erkennen, aufzunehmen und in die Therapie einzubinden. Es ist von besonderer Bedeutung, das Pferd als eigenständiges Lebewesen zu achten, denn wichtig ist es, dass die Pferde dauerhaft gerne in Kontakt mit dem Menschen treten. Dies gelingt nur, wenn sie ihre Persönlichkeit mit einbringen können.
Pferdegestützte Psychotherapie ist zurzeit noch eine Randerscheinung. In Zusammenhang mit dem Einsatz anderer Tiere in der Psychotherapie etabliert sie sich jedoch mehr und mehr. Dieses Buch soll einen weiteren Beitrag hierzu leisten.
Im ersten Kapitel wird eine theoretische Einführung in das Thema gegeben. Die besonderen Eigenschaften der Pferde werden benannt ebenso wie mögliche Themen in der Psychotherapie, zu welchen sich das Pferd als Medium eignet. Weiterhin werden unterschiedliche methodische Zugänge beleuchtet. Im zweiten Kapitel finden sich Fallbeispiele aus der Psychotherapie mit und Jugendlichen. Hierbei werden Fall- und Therapiebeschreibungen aus ganz unterschiedlichen Schulen und Herangehensweisen beschrieben. Der Beschreibung einer kindzentrierten Maßnahme bei einem Fünfjährigen mit Pferd in Kombination mit einer verhaltenstherapeutischen Elternberatung folgt der tiefenpsychologische Fall einer Jugendlichen. Der dritte Fall widmet sich einer systemischen Therapie mit Pferd bei einer Jugendlichen und der vierte und letzte Bericht geht auf eine analytische Therapie unter Einsatz des Pferdes mit einer jungen Erwachsenen ein.
1Vortrag A. Gomolla, Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd - Aktuelle Methoden, Konzepte und Sichtweisen im therapeutischen Reiten
KAPITEL 1
1. Pferdegestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen – eine Einführung
Annette Gomolla
Die Entwicklung der Pferdegestützten Psychotherapie wurde in Band 1 kurz umrissen. Es ist eine jüngere Disziplin innerhalb der Pferdegestützten Interventionen, welche die Bereiche Reittherapie und Reitpädagogik, Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd sowie Hippotherapie umfasst. Die Abgrenzung der einzelnen Bereiche wird immer wieder diskutiert, da das Pferd an sich als interagierender Sozialpartner das Thema Beziehung mit einbringt und als Reittier ebenso stetig auf einer psychomotorischen Ebene Impulse setzt. Dadurch sind Überschneidungen und „Abgrenzungsprobleme“ zwischen den Teildisziplinen unumgänglich. Wichtig für jeden Bereich sind daher die Kompetenzschwerpunkte und der Beruf der ausübenden Fachkräfte. So kann folgerichtig eine Pferdegestützte Psychotherapie nur von Psychotherapeut*innen durchgeführt werden, die durch ihre psychologische, medizinische und psychotherapeutische Schulung für die Ausübung befähigt sind. Die Reittherapie als Bereich kann dagegen von unterschiedlichen Fachkräften sozialer Berufe ausgeführt werden, die eine Zusatzqualifikation in dem Einsatz von Pferden erworben haben (siehe Leitlinien des Berufsverbandes für Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen e.V.). Die Reittherapie wird dabei als adjuvante Therapie gesehen, welche die Psychotherapie sowie andere Therapieverfahren (z.B. die Physio- oder Ergotherapie) als tier- und körperorientiertes Verfahren ergänzt und ebenso als Fördermaßnahme bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen eingesetzt wird.
Die Pferdegestützte Psychotherapie ist kein eigenständiges Psychotherapieverfahren, es baut nur bedingt auf einer eigenen Theoriebildung auf, sondern setzt im Menschenbild und den Methoden an bestehende psychotherapeutische Schulen an bzw. kann in diese integriert werden. Es bezeichnet die Einbeziehung des Pferdes als Medium oder als Begleiter in ein psychotherapeutisches Geschehen mit einer Annahme an psychischen und physiologischen Wirkfaktoren.
1.1 Fachtherapeut*innen und das Therapiepferd
Psychotherapeut*innen, die Pferde in ihre Arbeit einbinden möchten, sollten sich als Fachtherapeut*innen schulen lassen, da die Einbindung der Tiere mit einer hohen Verantwortung gegenüber den Patient*innen und Pferden einhergeht. Eine gute reiterliche Qualifikation, die spezifische Ausbildung der Pferde und das fachliche Handling der Tiere im Einsatz werden in Schulungen vermittelt. Weiterhin steht eine Reflexion des Einsatzes in der Psychotherapie neben methodischer Kompetenz im Vordergrund. Im deutschsprachigen Raum bietet das Institut für Pferdegestützte Therapie (IPTh) eine Weiterbildung speziell für Psychotherapeut*innen (Mediziner*innen und Psycholog*innen) mit den genannten Inhalten an.
Pferde, die in der Interaktion mit dem Menschen eigenständig handeln dürfen und nicht degradiert werden zu reinen funktionierenden Empfängern von Anweisungen, schenken uns ihre Fähigkeit des affektiven Mitschwingens. Das heißt, dass sie emotionale Zustände über kleinste Körpersignale des Menschen erkennen und auf diese reagieren können. Das muss nicht immer in Form von sogenannter „Spiegelung“ passieren (als einfaches Beispiel: das Pferd wird unruhig, wenn der Mensch unruhig wird), sondern es reagiert individuell auf einen emotionalen Zustand, zum Beispiel durch Wegdrehen, Gähnen, Anstupsen oder anderen, oft kleinen Reaktionen. Weiterhin folgen in der Wechselseitigkeit der Interaktion zwischen zwei Lebewesen wiederum eigenständige Reaktionen des Pferdes aus sich heraus, um wieder in einen mentalen und körperlichen Gleichgewichtszustand zu kommen bzw. diesen zu halten, oder das Pferd fordert Interaktion oder zieht sich aus dieser heraus.
Da das Pferd die Fähigkeiten einbringt, sich auf den Menschen einzustellen, Zustände aufzunehmen und individuelle Reaktionen zu zeigen, wird häufig vom Pferd als Co-Therapeut gesprochen. Das Pferd bringt in die Psychotherapie seine Verhaltensweisen und Wahrnehmungsmuster als Herden- und Fluchttier mit ein, ohne dass es jedoch Verantwortung für den Prozess übernehmen kann. Daher wird noch diskutiert, ob es als Therapiepferd oder besser als Therapiebegleitpferd bezeichnet werden sollte (vgl. Otterstedt, 2017, S.54).
Pferde, die für den Einsatz in der Psychotherapie geschult werden, benötigen eine solide grundlegende Ausbildung als Reitpferd und eine vertiefende Schulung für die Arbeit in der Psychotherapie2. Je besser die Pferde reiterlich sowie in Bodenarbeit und Horsemanship geschult sind, umso einfacher haben es später Fachtherapeut*in und Patient*in. Eine gute und enge Beziehung zwischen Pferd und Fachtherapeut*in beugt zudem Gefahrensituationen vor. Wir sprechen hierbei von einer sicheren Basis zwischen Mensch und Pferd bzw. einem sicher gebundenen Therapie(begleit)pferd.
Bei der reiterlichen Ausbildung sollte das Pferd von Beginn an auf sehr feine Signale wie Atmung, Gewichtsverlagerung und Körperspannung geschult werden. Ein „hartes“ und schnelles Einreiten der Pferde ist kontraproduktiv für die Therapie. Pferde sollten von Beginn ihrer Arbeit mit dem Menschen an diesen möglichst als Partner erkennen. Stress sollte bei der reiterlichen Grundausbildung vermieden werden. Pferde, die unter dem Reiter „davonlaufen“, sind in der Therapie schwierig einsetzbar. Der / die Fachtherapeut*in ist gefragt, beim Kauf eines Pferdes auf die korrekten reiterlichen Grundlagen zu achten bzw. sich darüber bewusst zu sein, dass anderenfalls ein möglicherweise langjähriger Prozess der weiteren Schulung des Pferdes nötig sein wird.
Im Weiteren müssen Therapiepferde für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine solide Longenausbildung erhalten, sinnvoll ist nachfolgend das Einvoltigieren im Schritt, damit Kinder sich im späteren Einsatz des Pferdes auf diesem frei bewegen können (drehen, liegen, stehen, herunterspringen, einfache Voltigierübungen) und die Pferde dies stressfrei tolerieren.
Das Wichtigste in der Schulung von Therapiepferden ist das Führtraining mit späterer Arbeit auf Distanz am Leitseil sowie die Desensibilisierung und Materialgewöhnung. Diese Schritte bauen aufeinander auf und sollten fachlich korrekt von dem / der Fachtherapeut*in umgesetzt werden. Ebenfalls ist Teil der Therapiepferdeausbildung, dass die Pferde ohne Strick, also frei in die Interaktion mit den Kindern und Jugendlichen eingebunden werden können. Hierzu müssen sie eine besonders gute Nähe-Distanz-Regulation mit dem Menschen beherrschen und fein auf Körpersprache reagieren. Es geht NICHT darum, dass die Klient*innen ein klassisches „Join Up“ machen3, sondern dass sie ein Pferd auf Distanz mit Körpersignalen losschicken und anhalten sowie drehen können, und dass die Pferde es kennen, dass sie sich dem Menschen anschließen.
Es muss klargestellt werden, dass alle diese Ausbildungsbereiche nie abgeschlossen sind. Ein Therapiepferd ist nie „fertig“, so wie wir als Therapeut*innen ebenfalls nie fertig sind. Auffrischung und neue Lerninhalte sind Bestandteil eines stetigen Trainings.
Bei allen Ausbildungsschritten sowie im täglichen Handling von Fohlenzeit an muss das Bewusstsein bei den Ausbilder*innen da sein, dass sie das Wesen und die Verhaltensweisen des Pferdes in Bezug auf den Menschen prägen. Pferde sind denkende Lebewesen, die über Erfahrung lernen und ein sehr gutes Gedächtnis besitzen. Manche Lernerfahrungen wirken lange in ihnen nach, besonders auch negative Ereignisse. Eine feinfühlige Person, die das Pferd für den Therapieeinsatz vorbereitet, kann Kompetenzen im Pferd erkennen und auch schwierige Lernerfahrungen gegebenenfalls therapeutisch nutzbar machen. Daher ist es für pferdeerfahrene Personen auch möglich, Pferde in die Psychotherapie zu integrieren, die schwierige Verhaltensweisen aufgrund problematischer Lernerfahrungen mit dem Menschen mitbringen. Auch Pferde, die selbst traumatisierende Erfahrungen im Kontakt mit Menschen gemacht haben, können unter guten Bedingungen zu sehr mitfühlenden und sensiblen Therapiepferden werden, wobei die Sicherheit der Klient*innen immer oberste Priorität hat und es individuell zu entscheiden ist, ob es für Mensch und Pferd förderlich ist, miteinander zu arbeiten. Patient*innenschutz und Tierschutz müssen immer reflektiert werden.
Jedes Pferd hat seine Stärken, jedes Pferd hat Vorlieben und Interessenslagen. Diese herauszufinden und in der Therapie positiv nutzbar zu machen, ist ein Teil der fachlichen Arbeit eines/einer Therapeut*in der Pferdegestützten Psychotherapie. Zudem wurden Leitlinien durch den Berufsverband für Fachkräfte Pferdegestützter Interventionen (Berufsverband PI) erarbeitet, die eine Begrenzung des Einsatzes von Pferden in der Therapie vorsehen. Auch gibt es Vorgaben durch die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., welche ein Merkblatt für Pferde in Therapie und Pädagogik verfasst haben4. Verschiedene Studien haben sich mit der Stressbelastung bei Therapiepferden befasst und kamen insgesamt zu dem recht positiven Ergebnis, dass Pferde in der geführten Therapiearbeit wenig Stressmerkmale zeigen (vgl. Meinzer, 2009).
2An dieser Stelle kann nur ein kurzer Abriss gegeben werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Buch „Therapie(begleit)pferde – Auswahl, Schulung & Training“, Gomolla, 2019
3Ein „Join Up“ ist für Pferde, welche sich dem Menschen bereits vertrauensvoll unterordnen, häufig nicht notwendig und sollte wenn auch nur von erfahrenen Ausbilder*innen gemacht werden und nicht von Klient*innen. Ein solches Vorgehen könnte auch gefährlich für Klient*innen werden.
4Merkblatt Nr. 131.9
1.2 Wirkungsweisen des Pferdes für die Pferdegestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
Kinder finden in Tieren körperliche Nähe. Darin kann Trost, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Beruhigung liegen. Dies nehmen Kinder und Jugendliche bereits beim Berühren mit der Hand und Streicheln des Fells wahr. Das Fell eines Hundes zu streicheln kann z.B. bei Kindern mit unsicherer Bindung nachweislich zu einem reduzierten Kortisolspiegel im Speichel führen (vgl. Beetz et. al, 2011) und wird mit Beruhigung und ggf. auch Oxytocin-Ausschüttung in Verbindung gebracht. Besonders das Liegen ganzflächig auf dem Pferd mit dem Gesicht auf der Kruppe des Pferdes kann diese Gefühle wecken und unterstützen. Das Getragen und Geschaukelt werden in der Schrittbewegung auf dem Pferd bewirkt Lockerung und auch Beruhigung (vgl. Gomolla et al., 2011). So kann Kindern der Wunsch nach Getragen werden ermöglicht werden, und es findet auf natürliche Weise Wechselseitigkeit statt.
Die Interaktion mit dem Tier birgt Freude, Spontaneität und Spaß. Rund um das Pferd und mit dem Pferd in der Natur zu sein ist erlebnisreich