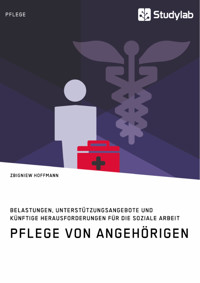
Pflege von Angehörigen. Belastungen, Unterstützungsangebote und künftige Herausforderungen für die Soziale Arbeit E-Book
Zbigniew Hoffmann
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Gesellschaft wird älter. Und auch die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen steigt in Deutschland weiter an. Häufig müssen Angehörige wie Ehepartner oder Kinder einen Großteil der Pflegeaufgaben übernehmen. Die damit verbundenen Belastungen für die Angehörigen sind nicht zu unterschätzen. Zbigniew Hoffmann untersucht in seiner Publikation, welchen physischen, psychischen, sozialen sowie materiellen Belastungen sich pflegende Angehörige aussetzen. Oft leiden sie unter Rücken- oder Hüftbeschwerden. Hinzu kommt, dass die Pflegebedürftigen häufig mit Zorn oder aggressivem Verhalten auf sie reagieren. Hoffmann untersucht aber auch, welche positiven Auswirkungen die Pflege auf die Angehörigen haben kann. Außerdem gibt er einen hilfreichen Überblick über die vorhandenen Unterstützungsangebote und schlägt mögliche Verbesserungen vor. Aus dem Inhalt: - Pflege; - Alter; - pflegende Angehörige; - Soziale Arbeit; - Beratungsangebote
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
1Einleitung
2 Die aktuelle Situation in Deutschland
2.1 Definitionen
2.1.1 Pflegebedürftigkeit
2.1.2 Pflegende Angehörige
2.2 Überblick über den derzeitigen Stand der häuslichen Pflege in Deutschland
2.2.1 Beziehungskonstellation
2.2.2 Wohnsituation
2.2.3 Altersstruktur
2.2.4 Gender
2.3 Umfang der Pflege
3 Beweggründe
4 Belastungen
4.1 Psychische Belastungen
4.2 Physische Belastungen
4.3 Soziale Belastungen
4.4 Materielle Belastungen
4.5Auswirkungen der Belastungen
5 Positive Effekte für pflegende Angehörige
6 Entlastungsmöglichkeiten
6.1 Gesetzliche Regelungen
6.2 Beratungs- und Entlastungsangebote
7 Rolle der Sozialen Arbeit
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hauptpflegepersonen in Privathaushalten im Jahr 2002 (%)
Tabelle 2: Hauptdiagnosen der Krankenhauspatientinnen und Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle)
Zusammenfassung
Die Familie übernimmt in Deutschland einen großen Teil der Pflegeaufgaben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Situation pflegender Angehöriger in Deutschland. Es wird untersucht welche Personen die Pflege tatsächlich übernehmen, wie umfangreich die Aufgabe ist und welche Belastungen mit der Pflegeaufgabe einhergehen können. Im Anschluss wird das Augenmerk auf die Entlastungsangebote für Pflegende gelegt. Insbesondere wird dabei die aktuelle Angebotsstruktur analysiert und im Hinblick auf die zukünftigen demographischen Entwicklungen Verbesserungspotentiale untersucht. Hier wird der Zusammenhang zur heutigen und zur zukünftigen Rolle der Sozialen Arbeit erstellt. Bezüglich des Erkenntnisinteresses wird die aktuelle fachliche und wissenschaftliche Literatur und aktuelle Gesetzestexte gesichtet.
Die Pflege von Angehörigen fängt meist bei der Pflege der Ehepartner an und verschiebt sich dann zu den Kindern, weswegen ein Großteil der Pflegepersonen selber ebenfalls bereits älter ist. Des Weiteren gibt es innerhalb der Pflegeübernahme ein deutliches Ungleichgewicht in der geschlechtlichen Verteilung. Der geringe Anteil von Männern bei der familiären Pflege kann einerseits auf die geringere Lebenserwartung, andererseits auf traditionelle Rollenvorstellungen zurückgeführt werden. Die Aufgabe der Pflege ist in vielen Fällen eine sehr umfangreiche Aufgabe und kann dementsprechend mit vielen unterschiedlichen Belastungen einhergehen. Diese Belastungen können sich auf physischer, psychischer, sozialer und materieller Ebene darstellen. Zusätzlich können Erfahrungen die im Rahmen der Pflegeaufgabe gesammelt werden, positive Effekte für die Pflegenden einhergehen, welche als Ressourcen für die Entlastungsarbeit angesehen werden können.
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aktuellen Situation pflegender Angehöriger in Deutschland. Dabei soll ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, welche Rolle die Soziale Arbeit in diesem Bereich spielt und welche zukünftigen Herausforderungen zu erwarten sind. Auf Grund der prognostizierten demographischen Entwicklungen in Deutschland rücken das Alter und die Pflege immer mehr in den Fokus der Wissenschaft.
Im Jahr 2010 bildeten die über 60-jährigen einen Anteil von 26,3% der deutschen Gesamtbevölkerung (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2012). Zusätzlich bildeten die 40- bis unter 60-jährigen im Jahr 2010 einen Anteil von 31,1% der Gesamtbevölkerung (vgl. ebd.). Die Menschen dieser Altersgruppe werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte ebenso der Lebensphase des Alters zugeordnet. Laut Statistischem Bundesamt (vgl. 2011, S. 5) gab es im Jahr 2011 rund 2,5 Millionen Pflegebedürftige insgesamt, von denen 1,76 Millionen zu Hause versorgt wurden. Dies entspricht einem Anteil von rund 70%. 1,18 Millionen der zu Hause versorgten Pflegebedürftigen wurden dabei lediglich durch ihre Angehörigen versorgt, rund 576.000 zusammen mit ambulanten Pflegediensten (vgl. ebd.). Diese Daten zeigen, dass in Deutschland die Familie einen überwiegenden Teil der Pflege sicherstellt. Demographische Prognosen sagen einen Anstieg der Gesamtzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland voraus. Laut Statistischem Bundesamt (vgl. 2010, S. 27) wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2030 auf etwa 3,37 Millionen ansteigen. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass auch die familiäre Pflege weiter in den Vordergrund der wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen rückt.
Die demographische Entwicklung und der damit einhergehende Anstieg der Pflegebedürftigkeit werden unsere Gesellschaft vor einige Herausforderungen stellen. Meines Erachtens betreffen diese Herausforderungen nicht nur die pflegerische und die medizinische Versorgung. Es bestehen einige Schnittstellen zwischen der Sozialen Arbeit und dem Gesundheitswesen. In den Handlungsfeldern Alter und Pflege sind das vor allem die Bereiche der Gerontologie und der Gesundheitsförderung. In einer Gesellschaft, in der es voraussichtlich mehr ältere und pflegebedürftige Menschen gibt, wird auch die Soziale Arbeit weiter in den Mittelpunkt rücken.
Neben der informellen Pflege durch Angehörige besteht in Deutschland auch ein System von professionell Pflegenden, so dass davon auszugehen ist, dass die Aufgabe der Pflege entsprechend umfangreich sein kann. Das Erkenntnisinteresse vorliegender Arbeit besteht darin, zu überprüfen, ob pflegende Angehörige auf Grund der fehlenden beruflichen Qualifikation und der Veränderungen in der Beziehung zum pflegebedürftigen Angehörigen im Rahmen der Pflege besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Gehen mit der Pflege Angehöriger physische, psychische, soziale oder materielle Belastungen einher, ist zu überprüfen, welche Unterstützungsangebote vorhanden sind und welche Rolle die Soziale Arbeit spielt. Des Weiteren soll der Bezug zu den prognostizierten demographischen Entwicklungen hergestellt werden und die Rolle der Sozialen Arbeit auf zukünftige Entwicklungen hin bewertet werden. Bezüglich des Erkenntnisinteresses wird die aktuelle fachliche und wissenschaftliche Literatur, sowie aktuelle Gesetzestexte nach folgendem Aufbau gesichtet.
Im ersten inhaltlichen Arbeitsschritt wird untersucht, wie sich die gegenwärtige Situation rund um die häusliche Pflege durch Angehörige, Freunde oder Bekannte darstellt. Zu Beginn sollen Begriffe wie Pflegebedürftigkeit und pflegende Angehörige, sowohl im gesetzlichen, als auch im sozialwissenschaftlichen Kontext erläutert werden. Anschließend soll beleuchtet werden, wer in Deutschland die Aufgabe der häuslichen Angehörigenpflege übernimmt und wer gepflegt wird. Dabei stehen Statistiken und Informationen zu Alter, Wohnsituation, Geschlecht und Beziehung zwischen den Pflegenden und den Pflegebedürftigen besonders im Vordergrund. Des Weiteren wird anschließend untersucht, welche Aufgaben pflegende Angehörige im Rahmen der Pflege übernehmen und in welchem zeitlichen Umfang diese Aufgaben wahrgenommen werden müssen.
Da davon auszugehen ist, dass die Aufgabe der Pflege sehr umfangreich sein kann, werden anschließend die Beweggründe und die Motivation pflegender Angehöriger erläutert. Dies soll zusätzlich die Möglichkeit der anschließenden Überprüfung, ob sich anhand der Beweggründe Rückschlüsse auf mögliche Belastungen pflegender Angehöriger und fehlende Beratungsangebote ziehen lassen, mit sich bringen.
Nachfolgend werden die möglichen Belastungen für pflegende Angehörige überprüft. Es sollen vier verschiedene Ebenen der möglichen Belastungen betrachtet werden: psychische, physische, soziale und materielle Belastungen.
Davon ausgehend, dass Belastung ein sehr subjektives Empfinden ist, sollen nicht nur mögliche negative Effekte, sondern ebenso mögliche positive Effekte der Pflege eine Rolle spielen. Des Weiteren können positive Effekte als Ressourcen für die Arbeit mit pflegenden Angehörigen betrachtet werden.
Um die Rolle der Sozialen Arbeit in dem Handlungsfeld der pflegenden Angehörigen definieren zu können, sollen nachfolgend bestehende Entlastungsangebote für pflegende Angehörige zusammengetragen werden. Zum einen sind dies die gesetzlichen Möglichkeiten im Rahmen der Pflegeversicherung, zum anderen ergänzende beratende und unterstützende Angebote für pflegende Angehörige. Gemeinsam mit den zuvor untersuchten Belastungen kann so überprüft werden, welche Bedürfnisse pflegender Angehöriger durch entsprechende Angebote bereits abgedeckt sind und wo es unter Umständen noch Verbesserungspotential gibt.
Die Rolle der Sozialen Arbeit soll anschließend vertiefend betrachtet werden. Zusätzlich zu der gegenwärtigen Rolle soll unter Berücksichtigung der möglichen Belastungen, der erarbeiteten Verbesserungspotentiale, der demographischen Entwicklung und der fachlichen Positionen der Sozialen Arbeit die Möglichkeiten der zukünftigen Rolle der Profession Soziale Arbeit erarbeitet werden.
2 Die aktuelle Situation in Deutschland
Im Folgenden soll die derzeitige Situation pflegender Angehöriger in Deutschland unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte beleuchtet werden. Zum einen werden die gesetzlichen Definitionen der Pflegebedürftigkeit und der Pflegepersonen genauer erläutert, zum anderen wird ein Überblick darüber gegeben, welche Personen die Pflegeaufgaben in Deutschland übernehmen und in welchem Umfang dies geschieht. Es ist davon auszugehen, dass das Thema Gender im Rahmen der häuslichen Pflege eine große Rolle spielt, so dass dies eine besondere Berücksichtigung in diesem Themenkomplex finden soll. Zum Schluss werden die genauen Aufgaben im Bereich der häuslichen Pflege dargestellt und es wird aufgezeigt, in welchem Umfang diese Aufgaben pflegende Angehörige einbinden.
2.1 Definitionen
Nachfolgend sollen die beiden für diese Arbeit wichtigsten Begriffe im Rahmen des Themas Pflege betrachtet werden. Dabei handelt es sich zum einen um den Begriff der Pflegebedürftigkeit und zum anderen um den Begriff der pflegenden Angehörigen. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist zu einem großen Teil von einem gesetzlichen Blickwinkel geprägt, wird im Rahmen dieser Arbeit allerdings ebenfalls aus sozialwissenschaftlicher Sicht betrachtet. Bei der Betrachtung des Begriffes pflegender Angehöriger soll ebenfalls einerseits die gesetzliche, andererseits die sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise eine Rolle spielen.
In Kapitel 6 vorliegender Arbeit sollen die Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige untersucht werden. Einige dieser Möglichkeiten sind direkt in der sozialen Pflegeversicherung im SGB XI festgeschrieben, weshalb die gesetzlichen Definitionen der beiden oben genannten Begrifflichkeiten im Rahmen dieser Arbeit als Basis dienen sollen.
2.1.1 Pflegebedürftigkeit
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Pflegebedürftigkeit ein gesundheitlicher Umstand verstanden, der dazu führt, dass eine Person über längeren Zeitraum Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten benötigt. Für die wissenschaftliche Betrachtung der Thematik bietet es sich an, die Begriffsdefinition des SGB XI zu nutzen. Nach §14 SGB XI, Abs. 1 gelten „Personen die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße [...] der Hilfe bedürfen“ als pflegebedürftig.
Nach §14 SGB XI, Abs. 2 sind Krankheiten und Behinderungen im Sinne dieser Definition: Funktionsstörungen am Bewegungsapparat, Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, Störungen des Zentralnervensystems, endogene Psychosen, Neurosen, sowie geistige Behinderungen.
Zusätzlich werden im SGB XI die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im täglichen Leben definiert. Die Beschreibung laut §14 SGB XI, Abs. 4 umfasst Verrichtungen im Bereich der Körperpflege, im Bereich der Ernährung, im Bereich der Mobilität und im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung.





























