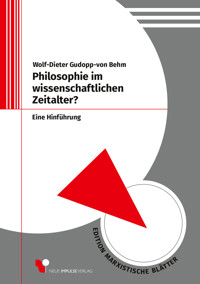
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neue Impulse Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wissenschaftliches Zeitalter«? Bertolt Brecht hat die Bezeichnung eingeführt und in seinem »Galilei« demonstriert, was er damit im Sinne hatte. Dieses Zeitalter nimmt auch die Philosophie ins Kreuzverhör. Was ist das überhaupt– Philosophie? Wie unterscheidet sie sich von anderen Wissenschaften? Hat sie in der Welt umwerfender wissenschaftlicher Erfolge eine Berechtigung? Weder ein gedankenloses JA oder ein vorschnell urteilendes NEIN führen weiter. Eine Antwort kann nur auf dialektischem Weg gefunden werden. Der prüfende Blick auf die Geschichte der Philosophie reicht von Heraklit über Aristoteles und Hegel zu Marx und Engels. Vor allem Engels’ Programm einer »Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs« hat der Diskussion auf die Sprünge geholfen und hält sie lebendig. Die Philosophie hatte ihre Zeit. Was ist der Gehalt dessen, das bleibt? Zum Titel des Buches gehört das Fragezeichen. Eslädt den Leser dazu ein mitzudenken und nicht zu vergessen: Denken ist etwas Anderes als Meinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm
Philosophie im wissenschaftlichen Zeitalter?Eine Hinführung
Begreifen des Einzelnen und Begreifen des Ganzen:Nur belehrt von der Wirklichkeit, können wirDie Wirklichkeit verändern.
Brecht, Die Maßnahme
Wolf-Dieter Gudopp-von Behm
Philosophie im wissenschaftlichen Zeitalter?
Eine Hinführung
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage Mai 2025Neue Impulse Verlag, EssenHoffnungstraße 18, 45127 EssenVerantwortlich: Lothar Geisler (Geschäftsführer)Kontakt: [email protected]
Gesamtausstattung:Medienwerkstatt Kai Münschke, Essenwww.satz.nrw
Korrektorat:Kurt W. Fleming
ISBN 978-3-96170-084-4 (Hardcover) ISBN 978-3-96170-384-5 (eBook) ISBN 978-3-96170-684-6 (ePDF)
Alle Rechte vorbehalten
© Neue Impulse Verlag, Essen 2025
www.neue-impulse-verlag.de
Inhalt
Impressum
I. Ende der Philosophie?
II. Erster Anlauf,
in dem es um Wissen, um Denken und um Begriffe geht.
III. Zweiter Anlauf,
in dem danach gefragt wird, was Philosophen sind und was sie treiben.
IV. Dritter Anlauf,
der einen Blick in die lebendige Wirklichkeit von Allem und in die des ›All‹ erlaubt: Dialektik.
V. Vierter Anlauf,
bei dem noch einmal gefragt fragt wird, was denn unter ›Theorie‹ verstanden wird – und ob sie ›abstrakt‹ sei.
VI. Fünfter Anlauf,
bei dem ›Wahrheit‹ gesucht wird.
VII. Sechster Anlauf,
mit dem man in die Zielgerade einfährt: ›Gesamtzusammenhang‹.
VIII. Das Resultat.
Wie soll man es nennen?
IX. Der Gesamtzusammenhang und ›das Ganze‹.
Frage, ob ›das Ganze‹ gedacht werden kann.Zugleich ein Gespräch mit Hans Heinz Holz.
X. Der dialektische Prozess und der Prozess des Rechts.
XI. ›Recht‹ und ›Maß‹ – Antrieb und Form des Weltprozesses.
Hinweise zum Text
Namensverzeichnis
Anhang:
Europäisierung Chinas. Sinisierung Europas?
Rede zum 10. Todestag von Hans Heinz Holz.
I. Ende der Philosophie?
Die Nachricht ist nicht neu: ›Religion‹ hat mit dem Siegeszug der diversen Wissenschaften, am auffallendsten der Naturwissenschaften samt den Möglichkeiten wissenschaftlicher Technik, ihren angestammten Platz verloren. Die Mehrung des Wissens in allen Bereichen hat Residuen, in denen sich ein Noch-Nicht-Wissen heimisch fühlen konnte, sukzessive verschwinden lassen. 1944 schrieb der Theologe Dietrich Bonhoeffer in seiner Gefängniszelle: »Gott als moralische, politische, naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden; ebenso aber als philosophische und religiöse Arbeitshypothese (Feuerbach!). Es gehört zur intellektuellen Redlichkeit, diese Arbeitshypothese fallen zu lassen […].«1 Perennierenden Bedürfnissen gemäß lebt das Phänomen ›Religion‹ in unterschiedlichen Gestalten weiter fort: sei’s im individuellen ›Seelenleben‹, sei’s als motivierender Zusammenhalt und Identitätsausweis in der Konkurrenz gesellschaftlicher Interessen. Im Spektrum der Wissenschaft hat sie ihren Platz als Religions- und Theologiegeschichte, die einen relativ eigenständigen Strang der Geschichte im Ganzen darstellt.
Eine letzte große authentisch theologische Anstrengung im protestantischen Bereich hat Karl Barth unternommen: Barth setzt das erste Gebot des Dekalogs als theologisches Axiom und betreibt dann Theologie nach allen Regeln der Kunst als Wissenschaft, der es darum geht, die Rationalität, das heißt die innere Folgerichtigkeit der biblischen Schriften in ihrer eigenen Notwendigkeit rational zu ermitteln und zu formulieren.2 Auf der katholischen Seite wird das Gewicht auf die sogenannte Fundamentaltheologie verschoben, die der eigentlichen Theologie unterlegt ist; in einer vorwiegend philosophischen Sprache geht ihre Argumentation darauf aus, die menschliche Existenz und das Denken hin zu einer Transzendenz, zum »Übernatürlichen« offen halten.3
Weshalb sollte es dem philosophischen Denken im wissenschaftlichen Zeitalter anders ergehen als der Religion beziehungsweise der Theologie? »Man fordert von der Philosophie, da die Religion verloren, daß sie sich aufs Erbauen lege und den Pfarrer vertrete.« (Hegel)4 Das ist keine Lösung. Philosophie ist keine Religion. Sie glaubt nicht. Sie bildet auch keine Kirche; sie organisiert sich vielleicht in »Schulen« und bildet gelegentlich auch so etwas wie Gemeinden, Bünde oder Kreise, die eine soziale und geschichtliche Kontinuität bestimmter Inhalte repräsentieren. Geprägt ist und bleibt sie durch ihre Geburt. In Griechenlands archaischer Zeit ist sie unter den günstigen Bedingungen der griechischen Freiheit als Partei der Wissenschaft entstanden. Motor war ein gesellschaftliches Bedürfnis der hoch entwickelten Zivilisation des östlichen Mittelmeers – die Welt und ihre Phänomene sollten bewusst rational erforscht, bedacht und theoretisch begriffen werden. Seither sind die Höhen und Tiefen der Philosophie mit der Geschichte der Wissenschaften im ganzen unlösbar verbunden.5 Ob ihre eigene Geschichte in unserer Zeit zu Ende geht oder schon zu Ende gegangen ist? Fungieren nicht auch Gedankengebilde der Philosophie ähnlich denjenigen der Religion vielfach als ›Lückenbüßer‹? Mit den Worten einer zeitgenössischen Physikerin: »Wir brauchen Philosophen, um die Lücke zwischen präwissenschaftlicher Konfusion und wissenschaftlicher Argumentation zu überbrücken. Doch das bedeutet auch, dass mit dem Fortschritt in den Naturwissenschaften, mit der Erweiterung unseres Wissens der Spielraum für die Philosophie unvermeidlich schrumpft.«6
Die Welt der Wissenschaft führt es seit langem vor – wenn auch manche ihrer Vertreter in bescheidener oder ängstlicher Zurückhaltung gerne das Gegenteil behaupten: Wir schaffen es alleine. Die Philosophie ist, und zwar nicht erst seit dem heutigen Tag, als Philosophie in ihre Existenz-Krise geraten.7
Nachdem * die französische Aufklärung8 der Philosophie das Feld eines befreienden vernünftigen Denkens und Tuns zugewiesen hat, nachdem sich * der deutsche Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant daran gemacht hat, die Bedingungen des Erkenntnisvermögens und überhaupt die Gegebenheiten des Menschseins kritisch zu erhellen und die Philosophie erneuernd auf die Höhe der Wissenschaft zu bringen9 – »unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß«10 –, ist mit * Hegel die Philosophie ein letztes Mal in ihrer alten Größe auf den Plan getreten.11
Auch Hegels erklärtes Ziel ist es gewesen – gegen die (romantisierende) Mode der Zeit –, dass die Philosophie »der Wissenschaft näherkomme, dem Ziele, […] wirkliches Wissen zu sein«12; das sei aber nur als System, zusammenhängend im Zusammenhang, möglich13. Systematisch hat Hegel das Ganze der Welt mit der Welt der Menschen, den Makro- und den Mikrokosmos, erfasst und es als vernünftigen, der Vernunft zugänglichen Zusammenhang durchdacht. »Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an.«14 Es ist ein einvernehmliches und darin zugleich beiderseits ein forderndes Sehen. Die komplexe Dynamik der Welt, die gesetzmäßige Ordnung ihres Zusammenhangs und ihrer Entwicklung wird in ihrer eigenen Bewegung begriffen – im Medium des philosophischen Elements, dem Medium des Geistes. »Daß in dem Gange des Geistes (und der Geist ist es, der nicht nur über der Geschichte wie über den Wassern schwebt, sondern in ihr webt und allein das Bewegende ist) die Freiheit […] oder mit anderen Worten, daß Vernunft in der Geschichte sei, wird teils wenigstens ein plausibler Glaube sein, teils aber ist es Erkenntnis der Philosophie.«15
Ludwig Feuerbach hat das Scheitern der Geist-reichen Philosophie Hegels verkündet. »Der Philosoph muß das im Menschen, was nicht philosophiert, was vielmehr gegen die Philosophie ist, […] das also, was bei Hegel nur zur Anmerkung herabgesetzt ist, in den Text der Philosophie aufnehmen. […] Die Philosophie hat daher nicht mit sich, sondern mit ihrer Antithese, mit der Nichtphilosophie, zu beginnen.«16 Wo Gott entthront ist, muss die Philosophie nach.
Die Philosophie, so Feuerbach, hat sich in eine verkehrte Welt verstrickt, indem sie den Menschen mitsamt den natürlichen Erscheinungen dem tatsächlichen Boden entriss, in die Sphäre des »Geistes« verschob und als Attribute, als Eigenschaften des Geistes deklarierte; jetzt soll sie, salopp gesagt, wieder runterkommen, irdisch denken und »sich wieder mit der Naturwissenschaft, die Naturwissenschaft mit der Philosophie verbinden.«17 Denn »das wahre Verhältnis vom Denken zum Sein ist nur dieses: Das Sein ist Subjekt, das DenkenPrädikat, aber ein solches Prädikat, welches das Wesen seines Subjekts enthält.«18 Will sagen: Der Kopf macht Aussagen über das Sein, aber diese sind keine Kopfgeburten, sondern sind dem Sein, dem, was zuerst ist, entnommen. Was denn sonst? Mit einem Blick auf Hegel ist das die Verkehrung der Verkehrung, die Rückkehr zu den wirklichen, von der Hegelschen Philosophie auf den Kopf gestellten Verhältnissen: »Wir dürfen […] die spekulative Philosophie nur umkehren, so haben wir die unverhüllte, die pure, blanke Wahrheit.«19
Karl Marx und Friedrich Engels sind durch diesen »Feuerbach«20 hindurchgegangen und schauen auf die »wirklichen Voraussetzungen«21 der Geschichte mitsamt deren Philosophien und Ideologien. Wenn auch mit der allergrößten Bewunderung nennt Friedrich Engels »das Hegelsche System als solches […] eine kolossale Fehlgeburt«22 und resümiert: »Mit Hegel schließt die Philosophie überhaupt ab; einerseits weil er ihre ganze Entwicklung […] zusammenfaßt, andrerseits weil er uns […] den Weg zeigt aus diesem Labyrinth der Systeme zur wirklichen positiven Erkenntnis der Welt.«23 Engels stellt die große Frage, die bis heute bewegt und inspiriert:
Wozu mag ›Philosophie‹ in einer Zeit glänzender Erfolge der Wissenschaft(en) noch gut sein? Was kann, darf und soll eventuell von ihr rechtens erwartet oder sogar gefordert werden? Bertold Brecht dachte, als er die Form des neuen Theaters konzipierte, »an die Kinder eines wissenschaftlichen Zeitalters«24.
Gut hundert Jahre nach Hegel hat Martin Heidegger mit einem eigenartigen Anlauf den Versuch unternommen, der Philosophie noch einmal ihren alten Platz zuzumuten und sie zugleich – im Wissen um ihre Existenzkrise25 und schon im Gedanken ihrer Aufhebung – gründlich zu kritisieren.
Einen großen Erfolg hat ihm die Fähigkeit verliehen, seine Gedanken in einer verstörenden Sprache darzulegen und dabei das Wesen der Philosophie, von der er wirklich etwas verstanden hat, in einem tendenziell apologetisch-fundamentaltheologischen Sinne abzufälschen.
In der frühen Phase seines Wirkens schreibt er: »Die Philosophie des lebendigen Geistes […] steht vor der großen Aufgabe einer prinzipiellen Auseinandersetzung mit dem an Fülle wie Tiefe, Erlebnisreichtum und Begriffsbildung gewaltigsten System einer historischen Weltanschauung, als welches es alle vorangegangenen fundamentalen philosophischen Problemmotive in sich aufgenommen hat, mit Hegel.«26 Auch nach Faschismus und Krieg hat er sein Programm nicht vergessen: »Der einzige Denker des Abendlandes, der die Geschichte des Denkens denkend erfahren hat, ist Hegel.«27 Dieser übergreife seinen Gegensatz Marx, und »durch diesen Gegensatz bleibt Marx innerhalb der Metaphysik Hegels«.28 Womit der Ausbrecher wieder eingefangen wäre. Die qualifizierte Gegenaufklärung versucht, Hegel und die Folgen in den Gedanken aufzunehmen und sie mit der Methode einer verdeckten Begleitung zu überholen. Diese Reformierung der Philosophie führt nicht zur Wissenschaft hin, sondern kehrt sich von ihr ab – »Wissenschaft denkt nicht«29 – und misstraut schließlich auch dem traditionellen Titel ›Philosophie‹. Wo ›Philosophie‹ war, soll – wieder – ›Denken‹ werden. Zurück zum Anfang: »Heraklit und Parmenides waren noch keine ›Philosophen‹. Warum nicht? Weil sie die größeren Denker waren.«30 – Andras Gedö hat darauf hingewiesen, dass Karl Löwith eine Ähnlichkeit von M. Heidegger und K. Marx hinsichtlich der Aufhebung der Philosophie vermutet.31
Die allgemeine Frage nach der Zukunft der Philosophie führt zur Frage nach der Stelle der Philosophie im Marxismus. Besonders Friedrich Engels hat dieses Thema grundsätzlich aufgegriffen und durchdacht und das Resultat im Sinne der wissenschaftlichen Weltanschauung klar und verständlich vorgetragen: Der »moderne Materialismus […] ist wesentlich dialektisch und braucht keine über den anderen Wissenschaften stehende Philosophie mehr. Sobald an jede einzelne Wissenschaft die Forderung herantritt, über ihre Stellung im Gesamtzusammenhang der Dinge und der Kenntnis von den Dingen sich klarzuwerden, ist jede besondre Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang überflüssig.«32 Der Satz will genau gelesen und gründlich bedacht werden. Ende der Philosophie?
Der Philo-soph ist hin- und hergerissen und blickt ratlos auf seine Bücher: Einerseits kann er Engels’ einsichtigem, zugegeben heftigem Urteil nicht widersprechen, andererseits möchte er von der Philosophie doch nicht lassen – auch wenn er nicht mit Hegel sagt: »Verkehr mit der Philosophie ist als der Sonntag des Lebens anzusehen.«33 In der Verlegenheit mag er im Folgenden versuchen, fürs erste in einer unbefangen unakademischen Einführung Themen und Motive der Philosophie anzusprechen und in mehreren, sich manchmal überschneidenden und auch wiederholenden (Entschuldigung!) Anläufen Zugänge zu erproben, dann aber danach zu fragen, was es wohl sei, das als »Philosophie« nach der Philosophie lebendig bleibt. Spurlos geht nichts verloren, und niemand wird ein reiches Erbe ausschlagen wollen. Der Impuls einer solchen Hinführung ist die Neugierde. Nicht alle, aber viele Wege führen nach Rom, sofern sich der Wanderer an die geographischen Gegebenheiten hält. Wenn die Diagnose einer finalen Existenz-Krise der Philosophie zutrifft, wird der Gang so oder so unausweichlich zum Feld des Problems und in den Kern der Frage finden:
Philosophie im wissenschaftlichen Zeitalter?
1 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, hrg. v. E. Bethge, München 19588, S. 240. – Laplace auf die Frage Napoleons, warum in der »Mécanique céleste« der Schöpfer nicht erwähnt wird: »Je n’avais pas besoin de cette hypothèse.« (zit. nach F. Engels, Einleitung zur engl. Ausgabe der »Entwicklung des Sozialismus«, MEW 22, S. 295 f.)Gut 300 Jahre davor hatte der geniale Frühaufklärer Cyrano de Bergerac überlegt: Da es ihr Denkvermögen überfordert, die Ewigkeit der aus unendlich vielen Welten bestehenden Welt in ihrer Selbstentwicklung zu erfassen, stellen sich die Menschen eine Schöpfung vor und übertragen die Ewigkeit von der Welt auf Gott; sie gewinnen damit wenig, handeln sich aber das Problem der creatio ex nihilo ein. »Um also diesem Labyrinth von Unerklärbarkeit zu entgehen, muß man neben Gott eine ewige Materie annehmen, und dann braucht man keinen Gott mehr anzunehmen.« (Die Reise zum Mond, Frankfurt/M u. Leipzig 19923, S. 91.)
2 Barth kann formulieren: die »Sprache des Denkens, das heißt Dialektik« und von der »innere[n] Dialektik der Sache« reden: Der Römerbrief, Zollikon 1954, Vorw. z. 2. Aufl., S. IX bzw. S. XIII. – Zu Barths Verständnis der theologischen Wissenschaft: Hanfried Müller, Evangelische Dogmatik im Überblick, Bd. 2, Berlin ²1989, S. 308 f. Zur »relativen Rationalität« theologischer Systematik: Holz, Wider den neuen Irrationalismus, in: Deutsche Ideologie nach 1945. Ges. Aufsätze aus 50 Jahren, Bd. 2, Essen 2003, S. 125 (aus: Plädoyers für einen wissenschaftl. Humanismus, FS W. Hollitscher, hg. v. J. Schleifstein, E. Wimmer, Frankfurt/M 1981.) Vgl. H. H. Holz, Gott und Welt. Karl Barth und die Dialektik der christlichen Philosophie. In: Weißenseer Blätter. Berlin, 2/2006, v. a. S. 20 f. – Hinweise zur Relation Theologie-Philosophie-Wissenschaft bei Hermann Mörchen, Zur Offenhaltung der Kommumikation zwischen der Theologie Rudolf Bultmanns und dem Denken Martin Heideggers, in: B. Jaspert (Hg.), Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung, Darmstadt 1984.
3 In der einen oder anderen Variante wird sie mit der Generallinie des Neothomismus harmonieren. In diesem Sinn hat der katholische Theologe Karl Rahner SJ die Kirche auf die sich verändernden Verhältnisse vorbereitet.
4 G. W. F. Hegel, Aphorismen (aus der Jenenser Zeit), FA Bd. 2, S. 558.
5 In diese Geschichte gehören im christlichen wie im muslimischen und jüdischen Kulturbereich die wechselseitigen Erb-Verhältnisse von Theologie und Philosophie, einschließlich des Streits um die Rangordnung, den Immanuel Kant auf seine Weise entschieden hat: »Auch kann man allenfalls der theologischen Fakultät den stolzen Anspruch, daß die philosophische ihre Magd sei, einräumen (wobei doch noch immer die Frage bleibt: ob diese ihrer gnädigen Frau die Fackel vorträgt oder die Schleppe nachträgt) […].« (Kant, Der Streit der Fakultäten, Erster Abschnitt: Der Streit der philosophischen Fakultät mit der theologischen, I. 2.)
6 Sabine Hossenfelder, Das hässliche Universum, Frankfurt/M. 2018, S. 287. – F. Engels, Ludwig Feuerbach, MEW 21, S. 295: Das »Gesamtbild zu liefern, war früher die Aufgabe der sogenannten Naturphilosophie. Sie konnte dies nur, indem sie die noch unbekannten wirklichen Zusammenhänge durch ideelle, phantastische ersetzte, die fehlenden Tatsachen durch Gedankengebilde ergänzte, die wirklichen Lücken in der bloßen Einbildung ausfüllte.«
7 Ein Symptom dieser Krise ist ein auffallendes Ausweichen oder eine Verflüchtigung gegenwärtiger Philosophie in Seitengebiete (etwa der Kommunikationstheorien), wie sie Dietmar Dath beklagt: Unsere Zeit, Essen, 22.12.2023 (»Bürgerverstand im Endstadium«).
8 Ein »Sonderfall« ist der Schweizer Rousseau, dessen Schriften entgegen dem Anschein den Charakter naturwissenschaftlicher Experimente haben.
9 Dazu Hermann Klenner, Immanuel Kant 1724–1804. In: Marxistische Blätter, Essen, 2/2024.
10 Dies eine Anmerkung, die Kant der Vorrede der ersten Auflage seiner ›Kritik der reinen Vernunft‹ beigefügt hat. Der Satz fährt fort: »Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung durch ihre Majestät, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen.«
11 »[…] die Philosophie hat fürs Erste ihren Kreis vollendet.« Eduard Gans in seinem Nekrolog. Zit. nach A. Gedö, Der Kampf um Philosophie und »Nicht-Philosophie«, in: M. Buhr (Hg.) Enzyklopädie zur bürgerlichen Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert, Leipzig 1988, S. 28.
12 Hegel, Phänomenologie, Vorrede, FA Bd. 3, S. 14.
13 Z. B. Hegel, Enzyklopädie (1830), § 14.
14 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Einleitung. FA Bd. 12, S. 23. (»[…] bei allem insbesondere, was wissenschaftlich sein soll, darf die Vernunft nicht schlafen und muß Nachdenken angewandt werden. Wer die Welt vernünftig …«)
15 Hegel, Enzyklopädie, § 549. – Engels hat Kantianer als verschämte Materialisten bezeichnet: Ludwig Feuerbach, MEW 21, S. 276; dazu Engels, Dialektik der Natur, MEW 20, S. 316: »Die erste Bresche in diese versteinerte Naturanschauung wurde geschossen nicht durch einen Naturforscher, sondern durch einen Philosophen [Kant]. […] die Erde und das ganze Sonnensystem erschienen als etwas im Verlauf der Zeit Gewordenes.« Analog kann Hegel als ein verdeckter Materialist verstanden werden. Engels, ebenda, S 277: »Was sie [die Philosophen] in Wahrheit vorantrieb, das war namentlich der gewaltige und immer schneller voranstürmende Fortschritt der Naturwissenschaft und der Industrie. […] auch die idealistischen Systeme erfüllten sich mehr und mehr mit materialistischem Inhalt […]; so daß schließlich das Hegelsche System nur einen nach Methode und Inhalt idealistisch auf den Kopf gestellten Materialismus repräsentiert.« Dazu Lenin, Konspekt zu Hegels ›Wissenschaft der Logik‹, LW 38, S. 226: »Der Materialismus ist mit Händen zu greifen.« Im Konspekt zu Hegels »Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie«, ebenda, S. 263: »Ein kluger Idealismus steht dem klugen Materialismus näher als ein dummer Materialismus.«
16 L. Feuerbach, Thesen zur Reformation der Philosophie, Werke, hg. v. W. Schuffenhauer, Bd. 9, Berlin 1982, S. 254. – Zur Philosophiekritik Feuerbachs u. a.: J. Bartels, Materielle Verhältnisse – Praxis – Theorie. In: J. Bartels, H. H. Holz, J. Lensink, D. Pätzold, Dialektik als offenes System, Köln 1986.
17 Feuerbach, a. a. O., S. 262 f.
18 a. a. O., S. 258. Vgl. S. 263.
19 a. a. O., S. 244. (K. Barth hat die Religionskritik Feuerbachs bejahend in den Band ›Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert‹ aufgenommen!)
20 K. Marx, Luther als Schiedsrichter zwischen Strauß und Feuerbach. MEW 1, S. 27. Der Artikel (mit dem Schlußsatz »Der Feuerbach ist das Purgatorium der Gegenwart.«), unterzeichnet mit »Kein Berliner«, stammt nicht von Marx, sondern von Feuerbach selbst: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin, 1/1976, S. 67.
21 Marx/Engels, Deutsche Ideologie, MEW 3, S. 20. Vgl. K. Marx, Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie [Manuskript], MEW 13, S. 631.
22 F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus, MEW 19, S. 206. (MEW 21, S. 270.)Dieter Kraft, Hegels dialektische Philosophie der gesunden Menschenvernunft, Aufhebung, Salzburg, 6/2015, S. 36: »[…] Engels ›Dialektik der Natur‹ ist doch nichts anderes als ein Kommentar zu Hegel, in dem der Versuch unternommen wird, die, wie er sagt, ›kolossale Fehlgeburt‹, mit Leben zu erfüllen […].«
23 F. Engels, Ludwig Feuerbach, MEW 21, S. 270. Dazu auch K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, wo er von der »Negation der seitherigen Philosophie, der Philosophie als Philosophie« spricht (MEW 1, S. 384).
24 B. Brecht, Kleines Organon für das Theater (14.), in: Brecht über Theater, Leipzig 1966, S. 211.
25 M. Heidegger, Was ist das – die Philosophie? (1956) Pfullingen 31963, S. 19: »Wenn diese Frage [nach dem Wesen der Philosophie] aus einer Not kommt […], dann muß uns die Philosophie als Philosophie fragwürdig geworden sein.«
26 M. Heidegger, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus (1916), M. H., Frühe Schriften, Frankfurt/M 1972, S. 352.
27 Ders., Der Spruch des Anaximander, in: M. Holzwege, Frankfurt/M 61980, S. 319.
28 M. Heidegger: Grundsätze des Denkens, in: Jahrbuch der Görres-Gesellschaft für Psychologie und Psychotherapie Freiburg/München 6 (1958), H. 1/3; S. 41. Ders., Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969, S. 63: »Mit der Umkehrung der Metaphysik [Nietzsche], die bereits durch Karl Marx vollzogen wird, ist die äußerste Möglichkeit der Philosophie erreicht.«Zum ›Übergreifen‹ vgl. H. H. Holz, Thesen zu Robert Kurz, in: Holz, Deutsche Ideologie nach 1945, a. a. O. (aus: Weißenseer Blätter 4/1993), S. 214: »[…] das ›übergreifende Allgemeine‹ ist […] die Gattung seiner selbst und seines Gegenteils; das bedeutet, dass der Kapitalismus im Stadium seines entwickelten Selbstwiderspruchs die Gattung ist, die als Arten den Kapitalismus selbst (in seinen verschiedenen Erscheinungsformen) und den Sozialismus umfasst.«
29 M. Heidegger, Was heißt Denken? (1952) In: Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954, S. 133. S. 134: »Es gibt von den Wissenschaften her zum Denken keine Brücke, sondern nur den Sprung«
30 M. Heidegger, Was ist das – die Philosophie?, a. a. O., S. 24.
31 A. Gedö, Philosophie und »Nicht-Philosophie« nach Hegel, Essen 2002, S. 10 f.
32 F. Engels, Die Entwicklung des Sozialismus, S. 207. Ders., Anti-Dühring, MEW 20, S. 34: »Wenn wir den Weltschematismus nicht aus dem Kopf, sondern bloß vermittelst des Kopfes aus der wirklichen Welt, die Grundsätze des Seins aus dem, was ist, ableiten, so brauchen wir dazu keine Philosophie, sondern positive Kenntnisse von der Welt und was in ihr vorgeht; und was dabei herauskommt, ist ebenfalls keine Philosophie, sondern positive Wissenschaft.«
33 Konzept der Antrittsrede an der Berliner Universität 1818, FA Bd. 10, S. 412.
II. Erster Anlauf,
in dem es um Wissen, um Denken und um Begriffe geht.
Sobald man sich auf die Gedanken oder auf den Gedanken der Philosophie einlässt, befindet man sich, wie auch immer man den Einstieg wählt, im Zentrum des Ganzen; nur das spezifische Interesse und die Perspektive werden jeweils andere sein. Womit also soll man im Sinne der genannten Suchaufgabe beginnen? Wer nach dem fragt, was Philosophie sei oder sein könne, bewegt sich bereits in der Landschaft, die er erkunden möchte.1
Die Gelehrten, die in der Antike die Schriften des Aristoteles geordnet und redigiert haben (ohne die Griechen geht’s in der Philosophie nicht), stellten an den Anfang der Abteilung, die sie ›Meta-Physik‹ nannten (das bedeutet: nach den ›physikalischen‹ Schriften), den Satz: »Alle Menschen streben von Natur/Physis aus nach Wissen – πάντεϛ ἄνϑρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει / pántes ánthrōpoi toû eidénai orégontai phýsei.«
Der kurze Satz hat es in sich. Aristoteles benennt eine Charaktereigenschaft der menschlichen Gattung. Das Streben nach Wissen ist dem Menschen als Menschen eigen und unterscheidet ihn von anderen Lebewesen. Es handelt sich dabei nicht um ein neugieriges Dieses-und-Jenes-einmal-Wissenwollen oder um ein Wissen, das man zum täglichen Nahrungserwerb braucht, sondern um einen wesentlichen Grundzug des menschlichen Lebens, um so etwas wie einen »Naturtrieb«, der sich nicht gerne einschränken lasst.
Es können Zweifel laut werden: Alle Menschen? Lehrt die Erfahrung nicht Anderes? Auch Aristoteles klagt: Wie viele Menschen fliehen in schöne Worte, anstatt ernsthaft nachzudenken!2 Schon lange davor ist im griechischen Ephesos an der Küste Kleinasiens der Denker Heraklit an seinen Mitmenschen verzweifelt: Das Denkvermögen ist doch allen gemeinsam – wie die Welt allen gemeinsam ist. Warum nur verhalten sich die Leute wie Schlafende? Im Traum ist jeder für sich, griechisch: idiotisch, und diese Idioten lassen sich dann leicht von Verführern einfangen.3 Später setzt Kant in seine kleine Schrift »Was heißt Aufklärung?« den unvergänglichen Weckruf: »Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.« Hegel wird vom »Mute des Erkennens«4 reden; allerorts aber sieht er Schlafmützen. »Den Seinen gibt Er’s schlafend«? Seit diesem Spruch »hat jeder Schlafende sich zu den Seinen gezählt«5.
Der angeführte Satz des Aristoteles redet von der ›Physis‹. Die Menschen wollen und sie müssen Wissen erlangen; das ist ihre Natur. ›Physis‹ ist keine tote Natur, sondern etwas Aktives – natura naturans; in seiner alten Bedeutung bezeichnet der Begriff ein Werden und ein Hervorbringen. In der Physis, sagt Aristoteles, ist nichts umsonst (μάτην / mátēn) und ungeordnet (ἄτακτον / átakton); denn sie ist die Ursache für alles.6 Die natürliche Anlage des Menschen hat auch eine normative Seite: Sie verpflichtet dazu, sie zu nutzen, ihr gerecht zu werden und eine stabile ›Haltung‹ (ἕξιϛ / héxis) zu entwickeln. (Auch dazu hat Aristoteles Einiges gesagt.) Stumpfsinn, eine Wissens- und Denkverweigerung, heißt das, ist ebenso natur- wie sittenwidrig.
Zum Verständnis dessen, was Aristoteles meint, kann es beitragen, die sprachliche Nah-Umgebung des griechischen Worts mitzudenken, das mit ›streben‹ übersetzt wird: ὀρέγεσϑαι / orégesthai ist verwandt und mit dem deutschen ›sich recken‹ nach, ›sich-ausrichten‹ auf etwas.7
Auch mit dem ›Wissen‹ hat es eine besondere Bewandtnis. Das griechische Wort lautet εἰδέναι / eidénai. Es bedeutet eigentlich: gesehen haben8 und enthält den Vorgang eines sinnlichen Wahrnehmens und Forschens.
Ein Hinweis am Rande: Das Verb eidénai hat ursprünglich mit einem w begonnen; das w ist in der Sprachgeschichte verloren gegangen. Man wird es nicht auf Anhieb hören, aber dieses ›weidénai‹ ist etymologisch identisch mit dem deutschen ›wissen‹; es ist das gleiche Wort.9
Aristoteles verbindet das ›eidénai‹ in den anschließenden Sätzen folgerichtig mit den Sinnen, unter denen er die Wahrnehmung (griechisch: aísthēsis10) mit den Augen hervorhebt. Bruno Snell: »In dieser Sphäre fällt das Intensive tatsächlich mit dem Extensiven zusammen: wer viel und oft gesehen hat, besitzt intensive Kenntnis.«11 Snell verweist auf den »Schiffskatalog« im Zweiten Gesang der Homerischen Ilias: Kein Mensch kann wissen, welche einzelnen Schiffe es genau sind, die in einer unübersehbaren Menge bereit liegen, um gegen Troja zu fahren; aber die Musen können’s: Sie haben alles gesehen, und sie erinnern sich; die Erinnerung ist ihre Hauptfunktion;12 allerdings sagen sie nicht immer die Wahrheit.13 Den Neu-gierigen, die nicht von wissenden Musen besucht werden, bleibt nur übrig, sich der eigenartigen Dynamik des Wissens anheim zu geben. Wissen erzeugt Wissen-Wollen; es kann nicht stehen bleiben sondern muss fortwährend Neues entdecken und erschließen. Es erweitert und qualifiziert sich aus eigener Notwendigkeit – das ist der Prozess der Wissenschaft.
Der Anfang des Wissens wäre demnach das Sehen. Von dieser Einheit ist die philosophischen Wissenschaft bei den Griechen ausgegangen. In Religionen hat den Vorrang in der Regel das Hören – ›das Wort‹ hören. Philosophie ist eben eine griechische Wissenschaft. Dass der olympische Zeus nicht seit ewig war, kein Schöpfergott und wahrhaftig kein »ganz Anderes« ist, gehört zu den günstigen Bedingungen ihres Werdens.
Damit ist die Landschaft skizziert, in der ›Philosophie‹, was sie auch sein mag, beheimatet ist. Es geht um Wissen, um Wissenschaft, nicht um mehr oder weniger interessante Vorstellungen von der Art »man macht sich ja immer so seine Gedanken« und daraus fließende Meinungen.
Um einem Zwischenruf zuvorzukommen, sei bekräftigt: An der Aufhellung der Welt, die »den Wachenden eine und gemeinsame« ist (Heraklit), arbeitet nicht die Wissenschaft allein. Auch die (anderen) Künste oder Kunst-Regionen sind beteiligt: neben dem sehenden Denken das denkende Sehen der bildenden Kunst, das denkende Tönen-lassen der Musik, die Welten aufschließende Poesie und die mitdenkenden gesellschaftlichen Erkundungen der Theater-Kunst. Von den Möglichkeiten, Formen und Gesetze dieser und anderer Künste wird hier, wo nach der Möglichkeit der Philosophie in unserer Zeit gefragt wird, nicht geredet.14
***
»Die Philosophie kann zunächst im allgemeinen als denkende Betrachtung der Gegenstände bestimmt werden«15, schreibt Hegel. Vielleicht denkt man nur, man denkt? Alle Menschen streben nach Wissen, aber nicht alle sind geübt, die Gegenstände im Sinne des oben eingeführten ›eidénai‹ denkendzusehen. »Jeder Mensch hat Finger, kann Pinsel und Farbe haben, darum ist er noch kein Maler.«16 Selbstverständlich denken alle Wissenschaftler; jede Wissenschaft beruht darauf, das Wesen eines Sachverhalts von der Art und Weise, wie dieser erscheint, zu unterscheiden. Karl Marx: »Alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen.«17. Die »denkende Betrachtung« sieht nicht ›Dieses und Jenes‹, sondern bringt es ins Allgemeine des Zusammenhangs.18 Das ist die Leistung des Gedankens; er integriert das Viele. Man kann ein Vergnügen daran finden. Klassisch der Satz in Brechts ›Galileo Galilei‹ (3. Szene): »Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse.« Der Papst (Urban VIII., ehedem Kardinal Barberini) versteht Galilei: »Er denkt aus Sinnlichkeit.« (12. Szene.)19
Jeder Gegenstand, der sich »im« Kopf bewegt oder diesen bewegt, ist ein durch Sinne und ordnende Arbeit des Denkens vermittelter – und derjenige im philosophischen Denken, so sagt man, in besonderer Weise:
Denken ist nie gegenstandslos, aber im »philosophischen Kopf« wird zudem das Denken bedacht, es wird sich im Denken des Denkens selbst Gegenstand. Der Gegenstand ist ein Gegenstand der ermittelnden Untersuchung undzugleich





























