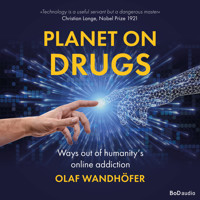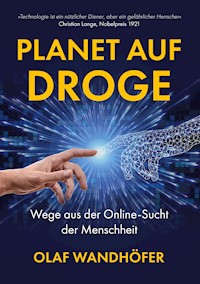
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sind wir alle Junkies? Online-Sucht ist ein ambivalentes und emotionales Phänomen, dessen vielfältigen Symptome in der Gesellschaft nicht mehr zu übersehen sind: geringe Aufmerksamkeitsspannen, die Suche nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen, Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft sowie psychische Probleme bei Erwachsenen und Jugendlichen nehmen zu. Die Prinzipien der Aufklärung als "Epoche der Vernunft" kommen unter Druck. Demokratien und Staatenbündnisse verlieren zunehmend an Stabilität. Schaffen wir den Entzug? Bei der Bekämpfung der Online-Sucht handelt es sich weniger um ein Erkenntnis- als vielmehr um ein Akzeptanz- und Umsetzungsproblem. Das größte Hindernis bei der Überwindung der Online-Sucht sind wir selbst. Dieses Buch beschreibt die Ursachen und Auswirkungen der Online-Sucht und stellt einen umfangreichen und gruppenspezifischen Werkzeugkasten vor, der uns dabei helfen soll, unsere Kinder, uns selbst, unser Umfeld und unsere Gesellschaft von der Online-Sucht zu befreien und wieder das Beste aus Online- und Offline-Welt zu nutzen. Zukunft gestalten oder Untergang verwalten? Wir sollten positiv nach vorne schauen und mit der notwendigen Entschlossenheit handeln. Technologiefeindlichkeit und Kulturpessimismus sind fehl am Platz. Wir haben die Risiken und Nebenwirkungen der neuen Technologien Internet und Smartphone/Tablet viel zu lange vernachlässigt und sollten nun gegensteuern. Ein zielgerichtetes Handeln ist von äußerster Wichtigkeit für uns persönlich, für die nachfolgenden Generationen und für die Zukunft der gesamten Menschheit im 21. Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Technologie ist ein nützlicher Diener,
aber ein gefährlicher Herrscher.
Christian Lange, Nobelpreis 1921
INHALT
1. Schöne neue Welt? Die Motivation für dieses Buch
2. Sind wir alle Junkies? Ein ambivalentes und emotionales Thema
3. Quo vadis Homo sapiens? Die Hintergründe zur Online-Sucht
3.1 Was sind stoffliche und nichtstoffliche Suchtmittel?
3.2 Warum ist Online-Sucht ein globales Phänomen?
4. Aufklärung in Auflösung? Die Auswirkungen der Online-Sucht
4.1 Wie groß ist das Ausmaß der Online-Sucht?
4.2 Welches sind die Hauptursachen der Online-Sucht?
4.3 Wie ist der Mensch als vernunftbegabtes und soziales Wesen betroffen?
4.4 Welche Gruppen zeigen Symptome der Online-Sucht?
4.4.1 Kinder und Jugendliche
4.4.2 Eltern
4.4.3 Erwachsene
4.4.4 Lehrer (Schule/Hochschule)
4.4.5 Wissenschaftler und Journalisten
4.4.6 Berufsanfänger und Arbeitgeber
4.4.7 Manager
4.4.8 Politiker
4.4.9 Gesellschaften und Staaten
4.4.10 Planet und Zivilisation
4.5 Wie groß ist der Handlungsdruck in Zeiten globaler Herausforderungen?
5. Schaffen wir den Entzug? Die Wege aus der Online-Sucht
5.1 Wie ist die Ausgangslage bei der Bekämpfung der Online-Sucht?
5.2 Welche Art von Regulierung ist notwendig?
5.3 Wie kann Technologie bei der Überwindung der Online-Sucht helfen?
5.4 Welche gruppenübergreifenden Maßnahmen gibt es?
5.5 Wie sehen gruppenspezifische Maßnahmen aus?
5.5.1 Kinder und Jugendliche
5.5.2 Eltern
5.5.3 Erwachsene
5.5.4 Lehrer (Schule/Hochschule)
5.5.5 Wissenschaftler und Journalisten
5.5.6 Berufsanfänger und Arbeitgeber
5.5.7 Manager
5.5.8 Politiker
5.5.9 Gesellschaften und Staaten
5.5.10 Planet und Zivilisation
5.6 Wie sind die Erfolgsaussichten und was sind die Haupthindernisse?
6. Zukunft gestalten oder Untergang verwalten? Das Fazit
7. Quellenverzeichnis
8. Autor
1.SCHÖNE NEUE WELT? DIE MOTIVATION FÜR DIESES BUCH
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie aufwachen und denken: Etwas stimmt nicht? Mir ist es eines Tages so ergangen. Ich lag noch im Bett und starrte bereits mehrere Minuten auf mein Smartphone. Plötzlich kam mir ein beunruhigender Gedanke. Was hatte es wohl zu bedeuten, wenn ich morgens ganz instinktiv zu meinem Smartphone griff? Es war das Erste, was ich in der Frühe tat, noch bevor ich aufstand und ins Bad ging. Und wie viele Jahre lag das kleine Tablet eigentlich schon auf meinem Nachttisch? Abends legte ich es oft erst aus der Hand, wenn meine Frau und ich das Licht ausmachten.
Allmählich begann ich, das Internetverhalten meiner Mitmenschen genauer zu beobachten. Mir fiel auf, dass praktisch niemand mehr Anstoß daran nimmt, wenn wir permanent auf die kleinen Bildschirme in unserer Hand schauen. Selbst der Anblick von Kindern im Restaurant, die gebannt auf das Tablet ihrer Eltern starren, erzeugt nur noch bei wenigen Menschen ein Störgefühl.
Die alltägliche Flut von beruflichen und privaten Nachrichten hatte ich – wie die meisten Menschen – längst akzeptiert. Folglich versuchte ich, mich möglichst effizient in unserer beschleunigten Welt zu bewegen. Der Griff zum Smartphone war häufig ein unbewusster Reflex, dem zum Glück auch Arbeitskollegen und Freunde nachgaben.
Ist dies die neue Normalität? War früher alles besser oder nur anders? An der Universität und später im Berufsleben habe ich verschiedene Welten kennengelernt. Ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung zum promovierten Chemiker durchlaufen, habe als Unternehmensberater mit Kunden in der Telekommunikations- und Technologieindustrie gearbeitet und hatte verschiedene Management-Positionen in der Finanz- und Technologiebranche inne. Auf Basis meiner Erfahrungen aus den zurückliegenden 25 Jahren kann ich sagen, dass Internet und Smartphone/Tablet den Zugriff auf Informationen in wohltuender Weise beschleunigt haben. Wir kommen heute in den Genuss von mächtigen Werkzeugen wie Google, Google Maps, Messenger-Diensten oder Online-Banking. Gleichwohl ist eine Flut von beruflichen und privaten Nachrichten hinzugekommen, deren zeitnahe Beantwortung erwartet wird, ob während der Arbeitszeit oder am Feierabend. Es gehört inzwischen zur Normalität, dass wir in unserem Tun ständig durch Computer, Tablet oder Smartphone unterbrochen und abgelenkt werden. Freiräume für konzentriertes Arbeiten müssen wir uns stets aktiv erkämpfen. Die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt, die Konzentrationsfähigkeit leidet, die Diskussionen im privaten und beruflichen Umfeld werden oberflächlicher, der Stress nimmt zu.
Die Auswirkungen der Online-Sucht auf die Menschheit haben mich schockiert. Angeregt durch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, und durch bewusstes Beobachten meiner Umwelt habe ich begonnen, mich systematisch mit dem Phänomen „Online-Sucht“ zu beschäftigen. Ich las Studien und Artikel und führte zahlreiche Gespräche mit Betroffenen und Experten. Nach einiger Zeit wurde mir klar, dass dieses Problem uns alle angeht. Unsere Gesellschaft besteht mehrheitlich, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, aus „Online-Junkies“, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. In diesem Buch geht es deshalb nicht um die Online-Sucht einzelner Jugendlicher oder bestimmter sozialer Gruppen, sondern um das Online-Suchtverhalten von uns allen.
Als promovierter Naturwissenschaftler sind mir die Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens vertraut. Ein wissenschaftlicher Beweis setzt eindeutige, reproduzierbare Fakten und angemessene Zeitreihen voraus. Als Unternehmensberater und Manager habe ich gelernt, dass es Situationen gibt, in denen es darauf ankommt, auf Basis unvollständiger Informationen zu handeln, anstatt auf zusätzliche Fakten und Beweise zuwarten. Der vom Menschen verursachte Klimawandel lässt sich nicht auf Basis eines Zeitraums von fünf Jahren wissenschaftlich nachweisen. Die Auswirkungen der Online-Sucht auf das Individuum und die Gesellschaft sind mit einer Zeitreihe von fünf bis zehn Jahren jedoch mit hinreichend hoher Genauigkeit zu beschreiben.
Bei Jugendlichen lässt sich als Folge der Online-Sucht eine Beeinträchtigung der Lernfähigkeit und der Psyche beobachten: Die Konzentrationsfähigkeit sinkt, die Aufmerksamkeitsspanne1 verkürzt sich und die Fähigkeit zum inhaltlichen Tiefgang nimmt ab. Diese Auswirkungen sind messbar. Zudem zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Multitasking ein Mythos ist. Wir haben nicht zu wenige Studien, Artikel und Indizien zum Thema „Online-Sucht und ihre Folgen“. Vielmehr tun wir zu wenig, um das Problem entschlossen anzugehen.
Die vergangenen Jahre sind geprägt von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die uns bis vor Kurzem noch undenkbar erschienen: der EU-Austritt des Vereinigten Königreiches, Donald Trumps „America First“-Politik, der Sturm auf das US-Kapitol und der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Sind alle diese Ereignisse direkte Folgen der Online-Sucht der Menschheit? Vielleicht nein. Der Trend zur Radikalisierung und Polarisierung innerhalb der Gesellschaft im Vereinigten Königreich und den USA durch soziale Medien sowie die dadurch ausgelöste Instabilität von Bündnissen wie der NATO spielen jedoch eine wesentliche Rolle. Schaut man auf die Spaltung der US-Gesellschaft, in der Begriffe wie „Fake News“, „Fake Media“, „Mainstream Media“, „Media Mob“ ihren Ursprung haben, liegt folgender Schluss nahe: Die Auswirkungen der Online-Sucht sind in einigen Teilen der Welt schon weiter fortgeschritten, als wir denken.
Ein großes Problem zu identifizieren, reicht nicht aus. Konkrete Vorschläge zur Lösung dieses Problems bringen uns weiter. Während ich mich intensiv mit den Auswirkungen der Online-Sucht beschäftigte, wurde mir das Ausmaß des Problems immer deutlicher. Ich kam zu der Erkenntnis, dass wir dringend konkrete und umsetzbare Lösungenbenötigen. Deshalb widmet sich dieses Buch zu einem großen Teil den vielfältigen Wegen, die aus der Online-Sucht herausführen können.
Wie können wir uns aus der Online-Sucht befreien und die Kontrolle über unser Internetverhalten am Smartphone oder Tablet wieder zurückgewinnen? Dieses Buch enthält eine Reihe von Empfehlungen, die ich größtenteils selbst ausprobiert und umgesetzt habe. Ich kann sagen, dass sich meine kognitive Leistungsfähigkeit schon nach kurzer Zeit verbessert hat. Außerdem nahm meine Zufriedenheit zu. Darüber hinaus wollte ich meinem Umfeld als gutes Beispiel vorangehen. Arbeitskollegen haben die höhere Produktivität von Besprechungen ohne Smartphone am eigenen Leib erlebt und änderten daraufhin ihr Verhalten.
Meine Frau und ich nutzen mobile Endgeräte und Apps nun anders und bewusster als früher. Viele Apps sind mittlerweile von unseren Smartphones und Tablets verschwunden. Wir verwenden kaum noch Zeit und Energie dafür, mit hohem Aufwand wahre Nachrichten von Fake News im Internet zu unterscheiden. Stattdessen verlassen wir uns wieder mehr auf traditionelle Gatekeeper wie kompetente Wissenschaftler und seriöse Journalisten/Autoren. Unsere Online-Zeit haben wir bewusst reduziert, zugunsten von mehr gemeinsamer Zeit in der realen Welt.
Kulturpessimismus, Technologiefeindlichkeit und Weltuntergangsszenarien helfen uns bei der Bewältigung der Online-Sucht nicht weiter. Bei diesem Thema haben wir letzten Endes kein Erkenntnis-, sondern ein Akzeptanz- und Umsetzungsproblem. Es ist nicht die Zeit, um in Panik oder Verzweiflung zu geraten. Vielmehr sollten wir positiv nach vorne schauen und auf Basis von Fakten entschlossen handeln. Ich habe dieses Buch geschrieben, um hierzu einen Beitrag zu leisten.
2.SIND WIR ALLE JUNKIES? EIN AMBIVALENTES UND EMOTIONALES THEMA
Die Erfindung des Internets ist ein ambivalentes und hoch emotionales Thema. Ambivalente Technologien sind in der Menschheitsgeschichte keine Seltenheit. Denken wir z. B. an die Dampfmaschine, an Elektrizität, Auto, Pharmaka, Flugzeug, Rakete, Fernsehen, Petrochemie, Atomkraft, Gentechnik und künstliche Intelligenz. Nutzen und Risiken neuer Technologien gehen typischerweise Hand in Hand und hängen stark von der konkreten Anwendung ab. Im Idealfall werden sie systematisch analysiert und reglementiert. Seit jeher schaut man beispielsweise bei Pharmaka auch auf die Risiken und Nebenwirkungen. Im historischen Kontext betrachtet besitzt das Internet den mit Abstand größten nichtstofflichen Einfluss auf den Menschen in seiner Gesamtheit als vernunftbegabtes und soziales Wesen. Exzessive Internetnutzung beeinträchtigt die kognitiven Fähigkeiten als auch die soziale Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in hohem Maße. Eine systematische Erfassung von Nutzen und Risiken des Internets, begleitet von einer angemessenen Regulierung, existiert jedoch bislang nicht.
Neben großem Nutzen birgt das Internet immense Risiken für Individuum und Gesellschaft. Diese Ambivalenz sei anhand verschiedener Beispiele verdeutlicht.
(1) Demokratie: Im Internet liegt ein großes demokratisches Potenzial, denn die neue Technologie stärkt das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Rede. Politische Skandale lassen sich leichter aufdecken. Aus diesem Grund haben totalitäre und autokratische Regime starkes Interesse ander Kontrolle und Zensur des Internets. Auf der anderen Seite tragen soziale Netzwerke und Videoplattformen wie YouTube in hohem Maße zur Polarisierung und Radikalisierung innerhalb demokratischer Gesellschaften bei. Als Beispiel sei hier die Erstürmung des Kapitols in den USA – als Wiege der modernen Demokratie – erwähnt.
(2) Informationen: Mit Hilfe des Internets haben wir schnellen, umfassenden und unzensierten Zugang zu einer Vielzahl von Informationen. Diese Informationsflut ist für den Einzelnen allerdings schwer bis unmöglich zu bewältigen. Gleichzeitig beobachten wir seit der Verbreitung des mobilen Internets verstärkt das Aufkommen von „Fake News“ und Verschwörungstheorien als globales Phänomen.
(3) Wissenschaft: Für den wissenschaftlichen Fortschritt ist das Internet von sehr hohem Wert, denn es ermöglicht den schnellen Zugang zu Forschungsergebnissen und Studien zu jeder Zeit über alle Kontinente hinweg. Die enge und schnelle Vernetzung der Wissenschaftler untereinander kann Forschungsprozesse enorm beschleunigen. Denken wir z. B. an die Entwicklung wirksamer Impfstoffe gegen COVID-19 in Rekordzeit. Während die Wissenschaft auf der einen Seite stark vom Internet und der Vernetzung von Wissenschaftlern profitiert, erleben wir auf der anderen Seite eine Erosion des Ansehens der kompetenten und seriösen Wissenschaft in sozialen Netzwerken, da die Informationsflut des Internets praktisch für jede Verschwörungstheorie oder noch so abwegige Meinung vermeintlich wissenschaftliche Beweise bereithält.
(4) Werkzeuge: Das mobile Internet mit dem Smartphone als wichtigstem Endgerät ist zu einem mächtigen, nützlichen und für die meisten Menschen zu einem unentbehrlichen Werkzeug geworden. Für uns gehört es zur Normalität, dass wir Fotos, Filme, Musik, Kontaktdaten stets bei uns tragen, immer wissen, wo genau wir uns auf dem Globus befinden und wie lange wir zu einer bestimmten Adresse mit dem Auto oder zu Fuß brauchen. Wir stehen über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke mit einer beliebig hohen Anzahl von Personen auf der gesamten Welt in Kontakt. Wir kaufen unterwegs Geschenke ein, buchen Reisen, bestellen ein Taxi, tätigen Überweisungen. Auf der anderen Seite erleben die Menschen in allen Teilen der Gesellschaft zunehmend den Drang, immer online zu sein. Denken wir in diesem Zusammenhang an den unbewussten Reflex, das Smartphone in die Hand zu nehmen, um Nachrichten zu lesen, im Internet zu surfen, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein oder sich die Langeweile bei Wartezeiten zu vertreiben. Die wenigsten Menschen entscheiden sich bewusst dafür, täglich mehrere Stunden online zu sein und eine zwei- bis dreistellige Anzahl von Nachrichten zu lesen und zu schreiben. Die meisten nehmen ihr Smartphone mehrere Male pro Stunde in die Hand und entsperren es, weil sie auf ein akustisches oder visuelles Signal reagieren. Viele tun dies auch nur aus reiner Neugier und unbewusst.
Wir haben uns mittlerweile als Gesellschaft an den Anblick von Personen gewöhnt, die – sei es im Privatleben oder im Beruf – permanent auf ihr Smartphone starren, anstatt sich mit ihrem Gegenüber zu unterhalten. Neben dem zunehmenden Drang der Menschen, ständig online zu sein, ist die Möglichkeit der Überwachung und vollständigen Transparenz des Einzelnen durch die ständige Smartphone-Nutzung zu einem Problem geworden. Wir geben bereitwillig preis, wo wir uns befinden, was wir tun, mit wem wir kommunizieren und was unsere Haltung zu verschiedenen Themen ist. Das unangenehme Gefühl, dass diese Daten zur Überwachung, Kontrolle oder Manipulation eingesetzt werden können, schieben wir lieber beiseite.
Wir müssen uns auf die Ambivalenz des Internets als neue Technologie emotional einlassen und akzeptieren, dass es keine einfachen und schnellen Antworten gibt, an die wir uns vielleicht gewöhnt haben. Das Internet besitzt enormen Einfluss auf unsere kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen. Angesichts dessen scheint es für jeden Einzelnen geboten, sich folgende Fragen stellen:
Bin ich selbst ein Online-Junkie? Falls ja, möchte ich einer bleiben oder darüber reden?
Was kann oder sollte ich ändern in meinem eigenen Verhalten?
Was kann oder sollte ich ändern in meinem Verhalten gegenüber anderen (Kinder, Partner, Freunde, Arbeitskollegen, Angestellte)?
Um hier zu ehrlichen Antworten zu gelangen, müssen wir womöglich eine große emotionale Hürde überwinden. Wir machen uns als Menschen verletzlich. Doch nur so erhalten wir einen ungetrübten und klaren Blick auf die Situation und erkennen den möglichen Handlungsdruck. Der erste Schritt zur Lösung eines Problems besteht bekanntlich darin, anzuerkennen, dass es dieses Problem gibt.
3.QUO VADIS HOMO SAPIENS? DIE HINTERGRÜNDE ZUR ONLINE-SUCHT
3.1 WAS SIND STOFFLICHE UND NICHTSTOFFLICHE SUCHTMITTEL?
Die Wissenschaft definiert verschiedene Suchtkriterien und unterscheidet zwischen stofflichen und nichtstofflichen Suchtmitteln. Typische Suchtkriterien sind Verlangen, Entzugserscheinungen, Toleranzentwicklung, Kontrollverlust, Interessenverlust und sozialer Rückzug. Beispiele für stoffliche Suchtmittel sind Nikotin, Alkohol, Beruhigungs- und Schmerzmedikamente, Amphetamine, Cannabis, Ecstasy, LSD, Opiate (Heroin, Morphine) und Kokain. Neben stofflichen gibt es nichtstoffliche Süchte, die sich in dem Drang äußern, bestimmte Aktivitäten auszuüben. Beispiele sind der zwanghafte Drang zum Glücksspiel, Einkaufen, Sammeln und Horten, Arbeiten, Sport und Sex. Als vergleichsweise neue nichtstoffliche Abhängigkeiten gelten Online-Spielsucht und insbesondere Online-Sucht.2, 3
Stoffliche Suchtmittel sind im Gegensatz zu nichtstofflichen Suchtmitteln deutlich länger und damit besser erforscht. In der Wissenschaft sind stoffliche Süchte seit langem gut beschrieben und klinisch definiert. Es gibt daher ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Oft treten mehrere stoffliche Suchtmittel gleichzeitig nebeneinander auf (Nikotin, Alkohol, Medikamente, Opiate etc.). Für nichtstoffliche Suchtmittel hingegen ist die Diagnostik bislang schwächer fundiert und Behandlungsmöglichkeiten sind weniger erprobt. Aus diesem Grund sind Begriffe wie „Online-Sucht“ noch nicht in dem Maße in den Köpfen der Menschen verankert wie z. B. Alkohol- und Schmerzmittelsucht.
Typischerweise kommt es zu einem Zeitversatz von zehn bis fünfzehn Jahren zwischen dem Auftauchen und der Anerkennung eines neuen Krankheitsbildes. Der Zyklus der ICD (International Classification of Diseases, World Health Organization) beträgt zehn bis fünfzehn Jahre. Die aktuelle ICD-11 trat im Jahr 2022 in Kraft. Für das DSM (Diagnostic and Statistical Manual, American Psychiatric Association) beträgt der Zyklus zehn bis zwanzig Jahre. Das aktuelle DSM-5 stammt aus dem Jahr 2013.
Online-Spielsucht ist mittlerweile als Diagnose anerkannt und in ICD-11 und DSM-5 aufgenommen4. Online-Sucht hingegen ist noch nicht offiziell als Krankheitsbild anerkannt. Eine problematische Nutzung von Online-Computerspielen („Internet gaming disorder“) liegt dann vor, wenn lange Dauer und klare Verhaltensstörungen kombiniert auftreten. Das DSM-5 beinhaltet seit 2015 einen Kriterienkatalog für Online-Spielsucht (fünf von neun Kriterien sollten über zwölf Monate erfüllt sein). Im Gegensatz zur ICD ist Online-Spielsucht im DSM-5 bislang nur als Forschungsobjekt und nicht als eindeutiges Krankheitsbild klassifiziert.5 Bis zur Aufnahme der Online-Sucht in ICD und DSM werden voraussichtlich zehn bis zwanzig Jahre vergehen.
Ein bekannter Selbsttest zur Feststellung von Online-Sucht ist der CIUS-Fragebogen (Compulsive Internet Use Scale, siehe Abb. 1). Hiermit kann jeder selbst herausfinden, ob das eigene Internetverhalten über Computer, Tablet, Smartphone und andere Endgeräte als problematisch anzusehen ist. Der Test besteht aus vierzehn Fragen. Für jede Frage gibt es fünf Antwortmöglichkeiten, bei denen zwischen 0 (Antwort „nie“) und 4 Punkten (Antwort „sehr häufig“) vergeben werden. Die Punktewerte werden am Ende aufsummiert. Bei 20 bis 27 Punkten liegt ein problematisches Online-Verhalten vor. Bereits ab einem Wert von 28 aus 56 möglichen Punkten wird die Abklärung durch eine Suchtberatungsstelle empfohlen.
Abb. 1: Compulsive Internet Use Scale (CIUS) nach Meerkerk et. al (2009)
3.2 WARUM IST ONLINE-SUCHT EIN GLOBALES PHÄNOMEN?
Wissenschaft und Internetindustrie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Phänomen „Online-Sucht“ und ihren verschiedensten Ausprägungen. Es existieren zahlreiche Studien, Artikel und Indizien. Nach strengen wissenschaftlichen Maßstäben gibt es angesichts der geringen Zeitspanne des Auftretens von Online-Sucht noch keine formale Anerkennung. Um ein problematisches Online-Verhalten festzustellen, schaut man im Allgemeinen auf Themen wie Nutzungsdauer, Kommunikationsverhalten (z. B. in sozialen Netzwerken), Kaufverhalten und Sexualverhalten.
Seit ca. fünfzehn Jahren nutzen breite Bevölkerungsschichten das Internet. In den letzten fünf Jahren lässt sich jedoch ein starkes Wachstum der mobilen Internetnutzung beobachten. Ein Grund hierfür ist die weite Verbreitung des Smartphones in Verbindung mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten im Mobilfunk (3G, 4G).
Ein Meilenstein für das mobile Internet war die Vorstellung des iPhones im Jahr 2007. Die weltweite Smartphone-Nutzung wuchs seitdem kontinuierlich an, zwischen 2016 (50 %) und 2021 (82 %) ist der Anteil der Smartphone-Besitzer nahezu explodiert. Die Anzahl der Facebook-Anwender lag im Jahr 2007 bei rund 50 Millionen. Bis 2016 stieg die Nutzerzahl auf 1,8 Milliarden und bis 2021 sogar auf 2,7 Milliarden an (2021 sind 60 % aller Internetnutzer weltweit bei Facebook registriert, 85 % davon nutzen Facebook nur mobil). 4G/LTE hat sich als globaler Standard etabliert und die mobile Internetnutzung revolutioniert. Der 5G-Roll-out hat bereits begonnen. Das starke Wachstum der Internetindustrie lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass sie wenigen bis gar keinen Regulierungen unterliegt.
Es existieren zahlreiche Studien, die sich mit den problematischen Auswirkungen übermäßiger Online-Nutzung auseinandersetzen. Demgegenüber gibt es bislang sehr wenige Arbeiten, die positive Effekte (z. B. von Online-Lernmedien) beschreiben und nicht aus dem Umfeld von Anbietern dieser Dienstleistungen stammen.
Bei einer Diskussion über das kontroverse Thema „Online-Sucht“ kann es helfen, sich die grundsätzliche Frage zu stellen: „Woran muss ich glauben?“ Nehmen wir das Beispiel „Online-Sucht bei Kindern und Jugendlichen“. Woran müsste ich z. B. glauben, wenn mir jemand sagen würde, dass Online-Sucht für diese Altersgruppe kein Problem darstelle? In diesem Fall müsste ich die folgenden Aussagen für richtig halten: „Drei bis vier Stunden Social Media, zwei bis drei Stunden Online-Spiele, mehr als 100 Nachrichten täglich sowie die Nutzung der sozialen Netzwerke zur Emotionsbewältigung (Langeweile, Sorgen, Stress, Realitätsflucht, Wut) sind eine gute Sache für Kinder und Jugendliche. Ein solches Online-Verhalten hat positive und gewünschte Effekte auf die Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten und der sozialen Kompetenz in einer für die Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung äußerst wichtigen Lebensphase.“ Wer würde diese Aussagen ohne Vorbehalte unterschreiben? Wahrscheinlich nur sehr wenige Mitmenschen.
Fast die gesamte Menschheit ist derzeit auf der Online-Droge, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Dieser Umstand erschwert das Problembewusstsein und die Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung des globalen Phänomens „Online-Sucht“. In den Industriestaaten nutzen mittlerweile 95 bis 100 % der Personen unter sechzig Jahren mobiles Internet. Aus gruppendynamischen Gründen lässt es sich schlecht über Drogen reden, die nahezu „jeder“ auf irgendeine Weise konsumiert. Letzten Endes bedarf es eines Problembewusstseins auf individueller Ebene. Hierfür ist das intellektuelle und emotionale Akzeptieren von Handlungsbedarf notwendig.
Der Handlungsdruck ist hoch, denn das Warten auf eine wissenschaftliche Anerkennung von Online-Sucht als individuelles und letztlich globales Problem in ca. zehn Jahren ist eine riskante Strategie. Der Nobelpreisträger Christian Lange hat in seiner Friedensnobelpreis-Ansprache 1921 den denkwürdigen Satz gesagt: „Technologie ist ein nützlicher Diener, aber ein gefährlicher Herrscher.“ Schauen wir nun mit der notwendigen innerlichen Distanz auf unser Nutzerverhalten. Betrachten wir die Rolle von Nutzern und Anbietern und stellen wir uns dann folgende Frage: „Ist das Internet noch Werkzeug und Diener (Google Maps, WhatsApp, Online-Reisebuchungen etc.) oder auf dem Weg zum Herrscher, der uns sagt, was wir tun, was wir denken und wie wir unsere Zeit verbringen sollen (Amazon, YouTube, Google, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok etc.)?“ Zu welcher Antwort gelangen wir?
Sind wir ehrlich zu uns und gestehen uns ein, dass wir als Individuen und als Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zunehmendes Problem mit der Nutzung der neuen Technologien haben? Oder wenden wir eine Taktik an, welche Sozialpsychologen als „Dissonanzreduktion“ bezeichnen? Bei bestimmten Themen verspüren wir ein Unwohlsein, wenn unser Verhalten unseren Überzeugungen widerspricht (z. B. Tabakkonsum, Fast Food, Klimawandel). Dieser unangenehme Gefühlszustand wird „kognitive Dissonanz“ genannt. Um die Dissonanz wieder aufzulösen, reagieren wir dann mit Selbsttäuschung durch Kleinreden, Relativieren der wissenschaftlichen Erkenntnisse, Entlastung oder Leugnung.
4.AUFKLÄRUNG IN AUFLÖSUNG? DIE AUSWIRKUNGEN DER ONLINE-SUCHT
4.1 WIE GROSS IST DAS AUSMASS DER ONLINE-SUCHT?
Online-Sucht beeinflusst den Menschen in seiner Eigenschaft als vernunftbegabtes und soziales Wesen. Sie hat Auswirkungen auf Individuum, Gruppe und Gesellschaft. Dies geschieht auf drei Ebenen.
(1) Rationale Ebene („Google ersetzt Wissen“): Viele Menschen verwechseln die Summe zahlreicher verschiedener Informationen aus dem Internet mit erworbenem Wissen über ein Fachgebiet oder ein Thema. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich mit einem Sachverhalt auf tieferer Ebene auseinanderzusetzen, gehen verloren. Es macht einen Unterschied aus, ob ein Orthopäde zu Vor- und Nachteilen neuer Operationstechniken in seinem Fachbereich recherchiert, oder ob sich ein medizinischer Laie aufgrund von Internetrecherchen eine Meinung zu einer neuen Operationstechnik bildet. Ähnliches gilt im Hinblick auf die professionelle Sichtung von Nachrichten. Wenn ein Journalist mehrere Stunden und Tage zu einem Thema recherchiert und der Artikel anschließend die Faktenkontrolle seiner Zeitung durchläuft, haben die Inhalte eine bestimmte Qualität und Aussagekraft. Eine schnelle Google-Recherche ohne Qualitäts- und Faktenkontrolle der vorgeschlagenen Informationen kann die journalistische Arbeit nicht ersetzen.
(2) Kommunikative Ebene („Facebook und Twitter ersetzen sachliche Kommunikation und fundierte Meinungsbildung“): Es gibt einen Trend zu immer schnellerer Kommunikation. Soziale Medien bedienen das Bedürfnis, auf komplexe Fragestellungen einfache Antworten zu finden. Soziale Netzwerke beschleunigen Polarisierung und Radikalisierung. Online-Mobbing wird zu einem wachsenden Problem. Nutzer mit Fantasienamen agieren in Chats und Foren zunehmend enthemmt. Darüber hinaus werden sie in Nutzergruppen gelenkt, die sie in ihren Überzeugungen bestärken (Echo-Räume). Widerspruch oder Minderheitsmeinungen erzeugen in diesen Gruppen eine heftige Reaktion.
(3) Emotionale Ebene („Facebook und Instagram ersetzen reale Freundschaften“): Die Qualität eines persönlichen Gesprächs ist durch digitale Kommunikation nicht zu ersetzen. 70 bis 80 % der Informationsvermittlung geschieht in einem persönlichen Gespräch nonverbal (z. B. über Gestik, Mimik, Tonfall).6 Bei der digitalen Kommunikation gehen diese Inhalte jedoch verloren. Zudem braucht der Mensch als soziales Wesen persönliche Kontakte, sonst droht Vereinsamung.7 Übermäßige Internet- und Smartphone-Nutzung kann bei Heranwachsenden zu einer geschwächten Ausbildung der Empathiefähigkeit führen8, 9, bei Erwachsenen kann der Verlust von Empathie die Folge sein.
Wie viele echte Freunde haben wir auf Facebook und Instagram? Wie viele unserer echten Freunde verlieren wir, wenn wir Facebook und Instagram nicht mehr nutzen? Es werden sicher nicht viele wirkliche Freunde sein. Auf alle Fälle haben wir dann wieder mehr Zeit, die wir in Telefonate und persönliche Treffen investieren können, um die Qualität unserer Freundschaften zu erhöhen.
Die Prinzipien der Aufklärung („Epoche der Vernunft“) kommen unter Druck und lösen sich auf, was weitreichende Folgen hat.