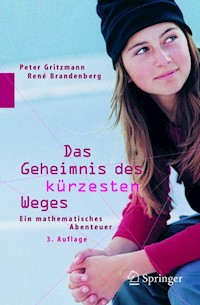16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
So, wie es optische Täuschungen gibt, so gibt es auch logische. Die 24 Geschichten dieses unterhaltsamen, leicht lesbaren Buches stammen aus der Welt der alltäglichen Entscheidungen, etwa der Medizin, der politischen Wahlsysteme, der Werbung, der Corona-Impfung oder der Schlankheitsdiäten. Was auf den ersten Blick völlig einleuchtend zu sein scheint, kann dennoch komplett in die Irre führen. Plausibel, logisch, falsch zeigt uns, wie wir Pseudo-Wahrheiten durchschauen, und gibt uns die Mittel an die Hand, die Holzwege des gesunden Menschenverstandes zu vermeiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Gritzmann
Plausibel, logisch, falsch
Auf den Holzwegen des gesunden Menschenverstandes
C.H.BECK
Zum Buch
So, wie es optische Täuschungen gibt, so gibt es auch logische. Die 24 Geschichten dieses unterhaltsamen, leicht lesbaren Buches stammen aus der Welt der alltäglichen Entscheidungen, etwa der Medizin, der politischen Wahlsysteme, der Werbung, der Corona-Impfung oder der Schlankheitsdiäten. Was auf den ersten Blick völlig einleuchtend zu sein scheint, kann dennoch komlett in die Irre führen. Plausibel, logisch, falsch zeigt uns, wie wir Pseudo-Wahrheiten durchschauen, und gibt uns die Mittel an die Hand, die Holzwege des gesunden Menschenverstandes zu vermeiden.
Vita
Peter Gritzmann ist Prof. em. für Mathematik an der Technischen Universität München. Längere Gastprofessuren führten ihn in die USA und nach Frankreich. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach international ausgezeichnet. Heute berät er Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen im In- und Ausland.
Inhalt
Vorwort
(Ent-)Warnung
Dank
Der kleine Unterschied?
Sie sollten Ihr Testament machen
Das perfekte Restaurant
Die Qual mit der Wahl
Wofür Gremien nicht alles gut sind
Die Bürger haben gesprochen
Ich sehe was, was du nicht siehst
Ein Fall für den Psychiater?
Ein neuer Stern am Kunsthimmel
Wahre Größe
Überall Spitze und doch nicht vorne?
Der schöne Schein des scheinbar Besseren
Ja, was messen sie denn?
Alles nur Mittelmaß?
Das Tempo der Änderung der Veränderung
Urlaubstag ist Handtuchtag
Der Wert des Euro
Die alte Brücke und der Verkehr
Gier, doch weiter kommt man ohne ihr
Anarchie und Effizienz
Das kann doch kein Zufall sein
Geheime Mächte regieren die Welt?
Botschaften aus dem All
Schlemmen für die Traumfigur
Und jetzt?
Epilog: Ist es wirklich so schlimm?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Namen- und Sachverzeichnis
Vorwort
Manipulation überall. Wer glaubt noch den Versprechungen der vielen «Rattenfänger» unserer Zeit? Gesunder Menschenverstand lässt uns zweifeln und in unserem Gegenüber den Erbschleicher, Heiratsschwindler oder auch nur den Gebrauchtwagenhändler sehen. Menschen versuchen ihr Bestes, um das für sie Beste zu erreichen. Aber ihr Bestes kann dabei durchaus ihr Schlechtestes sein, moralisch verwerflich oder sogar kriminell.
Davon handelt dieses Buch jedoch nur am Rande. Vielmehr befasst es sich mit den Überforderungen durch scheinbar logische und richtige Schlüsse, die bei genauerer Betrachtung aber keineswegs logisch und richtig sind. Wenn wir erkennen, wie leicht wir uns selbst aufs Glatteis führen, relativiert sich vielleicht unsere Entrüstung über politische Prozesse. Nein, die meisten Politiker sind nicht von Natur aus schlecht. Sie sind einfach nur überfordert. So wie wir alle.
Wir sind von der Evolution zwar sehr gut daraufhin optimiert, Gefahren zu erkennen, die von Löwen in der freien Wildbahn ausgehen, Entfernungen zu Raubtieren abzuschätzen, Adrenalin auszuschütten, um uns auf die Flucht vorzubereiten und, wenn das alles nichts hilft, wenigstens eine Lebensversicherung abzuschließen. Aber was ist mit den anderen Gefahren unserer komplexen Welt, den Trugschlüssen, die unsere Entscheidungen bestimmen? Schaffen wir es wirklich, die Vielzahl von «offensichtlich richtigen» Voraussetzungen für unsere Schlüsse zu durchschauen? Denn offensichtlich richtig ist oftmals gründlich falsch. Der gesunde Menschenverstand ist weit beschränkter und weit anfälliger für Täuschungen, als uns bewusst und sicherlich als uns lieb ist. Glücklicherweise sind viele der Fehlschlüsse harmlos. Allerdings gibt es auch solche, deretwegen wir unseren Wohlstand, unsere Arbeitsstelle oder sogar unser Leben verlieren können.
Insofern versucht dieses Buch ernsthaft, aber durchaus auch ein wenig augenzwinkernd, Leben zu retten. Es hält aber noch eine weitere tröstliche Erkenntnis bereit: Ihre Vorgesetzten, Journalisten oder Politiker sind möglicherweise gar nicht so manipulativ und durchtrieben, wie Sie sich das in Ihren Fantasien vielleicht ausmalen; sie fallen einfach nur genauso auf die Fallstricke der einfachen Lösungen herein, wie wir alle. Ist nicht das Klare, Einfache und Offensichtliche richtig, insbesondere wenn es alle so sehen? Leider nicht immer! Denn so, wie es typische optische Täuschungen gibt, gibt es auch logische, auf die wir nur zu leicht hereinfallen. Diesen wollen wir auf den Grund gehen. Ja, das wackelt an festen Gewohnheiten und verunsichert – und das durchaus mit Absicht.
«Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse.»[1] Bertolt Brecht (1898–1956) hat recht. Und so soll die Lektüre nicht nur augenöffnend, sondern auch vergnüglich sein. Viele teils wahre, teils der Wahrheit nachempfundene, teils ernste, teils amüsante Geschichten entlarven die unerträglich süße Absurdität unseres Seins.
Übrigens, nicht jedem wird das recht sein. Schließlich sind aufgeklärte Kunden, Schüler, Bürger schwieriger zu beeindrucken. Hannah Ahrendt (1906–1975) hat ebenfalls recht: «Es gibt keine gefährlichen Gedanken. Das Denken an sich ist gefährlich.»[2] Also, schnallen Sie sich an: Die Reise kann holprig werden.
(Ent-)Warnung
Dieses Buch betreibt keine Lifestyle-Lebensberatung, ist kein Lehrbuch, soll Ihnen keine speziellen Gewissheiten vermitteln, sondern Sie im Gegenteil eher verunsichern. Ist das, was mir meine Logik, mein gesunder Menschenverstand sagt, wirklich so uneingeschränkt richtig? In bisweilen für Sie hoffentlich amüsanten Anekdoten hinterfragt es so manche Grundlage menschlichen Denkens. Dieses Buch ist eine Gefahr für eingefahrene Denkmuster. Wenn Sie also eine Abneigung haben, darüber ins Grübeln zu kommen, wie Sie eigentlich zu Ihren Schlüssen und Ansichten gelangen, und Ihre eigene Logik auch mal in Frage zu stellen: Jetzt ist noch Gelegenheit, das Buch wegzulegen.
Allen anderen wünsche ich eine vergnügliche Abenteuerreise auf den Holzwegen unserer Erkenntnis. Bisweilen wird es vielleicht etwas herausfordernd; aber macht das nicht gerade den Reiz einer Entdeckungsreise aus!? Ziel ist es natürlich nicht, sich über unsere Unzulänglichkeiten lustig zu machen oder gar zu erheben. Ziel ist es, sie zu durchschauen, um so unser logisches Immunsystem zu stärken.
Wenn Sie der Erkenntnis noch «eins draufsetzen» wollen, sind im Buch einige wenige kleinere Fehler versteckt. Finden Sie sie?
Dieses Buch ist weder eine wissenschaftliche Monografie noch ein wissenschaftlicher Leitfaden zur Selbstoptimierung. Es ist daher nicht das Ziel, die vorhandene Literatur zu den einzelnen Kapiteln umfassend darzustellen. Es werden jedoch (selbstverständlich) zu den wesentlichen Erkenntnissen Original- oder Buchquellen angegeben. Ferner sind Internetadressen (mit Datumsangabe des letzten Zugriffs) angefügt, um Ihnen bei Interesse einen leichteren Zugang zu weiteren Informationen zu ermöglichen. Bitte denken Sie jedoch daran, dass keine Garantie besteht, dass zum Zeitpunkt Ihres Zugriffs eine Seite noch existiert, die dort enthaltenen Informationen korrekt sind oder die Seite nicht von «bösen Mächten» gehackt oder gekapert worden ist. Sie sollten also in jedem Fall die gleiche Sorgfalt walten lassen, die bei allen digitalen Aktionen dringend geboten ist. Verantwortung für den Inhalt der angegebenen Webseiten können jedenfalls weder der Autor noch der Verlag übernehmen.
Umgekehrt können wir für keine einzige Zeile des Buches die Verantwortung auf ChatGPT[3] oder andere Tools der generativen künstlichen Intelligenz schieben. Schließlich geht es hier ja um die Holzwege des gesunden Menschenverstandes, nicht die der KI. Gänzlich KI-frei ist das Buch allerdings auch nicht. Insbesondere wurden manche englischen Zitate unter Verwendung von «Vorübersetzungen» durch DeepL ins Deutsche übertragen.
In der Literaturliste am Ende des Buches sind neben den zitierten noch einige wenige zusätzliche Bücher aufgeführt. Ich bitte alle um Entschuldigung, deren ebenfalls hervorragende Bücher, die den einen oder anderen Aspekt dieses Buches vertiefend behandeln, nicht genannt werden.
Trotz des eher anekdotischen Charakters des Buches ist ein umfangreiches Stichwortverzeichnis angefügt, das es Ihnen erleichtert, Stellen wiederzufinden, die Sie vielleicht noch einmal nachlesen oder Ihren Freunden oder Bekannten zeigen wollen.
Die in den einzelnen Geschichten verwendeten Namen sind frei erfunden. Oft leiten sie sich allerdings in naheliegender Weise aus dem Englischen, Lateinischen, Griechischen, Spanischen, Italienischen oder Türkischen ab. Ihre «Entstehung» ist im Stichwortverzeichnis «dokumentiert». (Da die Sprachkenntnisse des Autors in manchen dieser Sprachen höchst eingeschränkt sind, bitte ich, mir ggf. versteckte, in den einschlägigen Wörterbüchern nicht angegebene und gänzlich unbeabsichtigte «Doppelbedeutungen», die sich vermutlich nur Muttersprachlern erschließen, nachzusehen.) Die frei erfundenen Namen von Städten, Krankheiten, Arzneimitteln etc. dienen ausschließlich dazu, die Geschichten «lebendiger» zu machen. In jedem Fall sind Ähnlichkeiten mit existierenden Bezeichnungen rein zufällig. Das gilt selbstverständlich auch für alle auftretenden Personen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird.
Zum Abschluss noch eine stilistische Bemerkung. Wie wir wissen, gibt es höchst verschiedene Geschlechtsidentitäten.[4] Selbstverständlich sind diese im vorliegenden Text stets alle angesprochen und mit gemeint. Wir behandeln hier ja Denkfallen, in die wir Menschen alle tappen können, unabhängig von unseren politischen Überzeugungen, unseren Berufen, unserem Alter und natürlich auch unseren Geschlechtsidentitäten. Dennoch soll sich niemand als Dummkopf*in fühlen, aber auch nicht als Koryphäe*r. Im Gegenteil! Keiner ist vor den verlockenden Fallen sicher; die Widersprüche, Paradoxien und Absurditäten des Denkens betreffen uns alle.
Ziel des Buches ist es, das Bewusstsein für die Fallstricke unserer Bewertungen von «Wirklichkeit» zu schärfen. Da Logik manchmal schon anstrengend genug ist, werden wir im Sinne der einfacheren Lesbarkeit weitgehend auf genderbetonende Sprache verzichten. Auf die aktuelle Diskussion im Spannungsfeld der Positionen «Sprache bestimmt Wirklichkeit» und «Sprachkampf ist nur ein Nebenschauplatz» kann hier naturgemäß nicht eingegangen werden. Allerdings tritt in unserem Alltag so manche schreiende Ungerechtigkeit auf, die durchaus in den hier thematisierten Kontext von «Priming» oder «Interpretationsrahmen» gehört und die einen signifikanten Einfluss auf unsere Denkprozesse, Einschätzungen, Überzeugungen und natürlich auch auf unsere Wahrnehmung von Geschlechtern und Geschlechterrollen hat. Da es hier gerade um die Sichtbarmachung solcher Effekte geht, ist zu hoffen, dass das Buch durchaus einen Beitrag zu ihrer Überwindung leistet. Um das wichtige Anliegen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit anzuerkennen, werden im Buch willkürlich manche Beispiele mittels weiblicher, andere mittels männlicher Protagonisten verdeutlicht. Aber noch einmal ganz ausdrücklich: Vertreter aller Identitäten sind in gleicher Weise und selbstverständlich angesprochen.
Dank
Abschließend möchte ich allen Dank sagen, die mich bei der Arbeit an diesem Buch unterstützt haben.
Besonders bedanken möchte ich mich bei Dr. Wolfgang Beck, der meine ersten Ideen zu diesem Buch begeistert aufgenommen hat, und bei Dr. Stefan Bollmann, der mich vom Konzept bis zum fertigen Buch geduldig und konstruktiv begleitet hat.
Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Gitta und unserem Sohn Simon für ihre vielfältige Unterstützung, die vielen Diskussionen und ihr Feedback als erste Testleser.
Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Der kleine Unterschied?
Haben Sie auch schon mal Ihren Schlüssel verlegt und sich gefragt, ob dieser beim Einkauf aus der Tasche gefallen sein könnte? Natürlich schaut man zuerst an den üblichen Stellen im Hause nach, wo sich Schlüssel «verstecken» könnten. Der «Beweis», dass Sie den Schlüssel nicht verloren, sondern in der Wohnung nur verlegt haben, ist zweifelsfrei erbracht, wenn Sie den Schlüssel finden. Was aber, wenn Ihnen das nach zunächst oberflächlichem Suchen nicht gelingt? «Mist», werden Sie vielleicht sagen, dann muss ich wohl alles gründlich durchsuchen. Das ist sehr viel aufwändiger, aber selbst, wenn Sie ihn dann immer noch nicht gefunden haben, bleibt noch ein Rest Unsicherheit, ob der Schlüssel sich nicht doch irgendwo in Ihrer Wohnung «versteckt».
Ein in seiner Logik ähnliches Beispiel ist uns während der Schwangerschaft meiner Frau tatsächlich passiert. In regelmäßigen Abständen wurden die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt, zu denen auch verschiedene Ultraschalluntersuchungen gehörten. Ich durfte bei allen dabei sein. Meine Frau und ich freuten uns sehr auf unser Kind, und selbst die frühen Ultraschallbilder waren schon faszinierend und beglückend. Irgendwann nach dem dritten Schwangerschaftsmonat fragte uns die Ärztin, die die Ultraschalluntersuchung durchführte: «Wollen Sie wissen, ob Sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen?» Manche künftigen Eltern wollen sich lieber überraschen lassen. Wir gehörten nicht dazu. Warum sollten andere mehr über unser Kind wissen als wir selbst? Ja, wir wollten es wissen! Die Antwort der Ärztin war: «Es ist ein Junge.»
Beim nächsten Untersuchungstermin hatten wir einen anderen Arzt. Auch er fragte: «Wollen Sie das Geschlecht Ihres Kindes wissen?» Offenbar kannte er den «Befund» seiner Kollegin nicht, und wir wollten ihn auch nicht beeinflussen, antworteten also einfach wieder mit «Ja». «Es ist ein Mädchen», stellte er fest. Das war interessant. Noch interessanter wurde es bei den nachfolgenden Untersuchungen: jeweils das gleiche Spiel. «Wollen Sie das Geschlecht Ihres Kindes wissen?» Ja, wir wollten, immer wieder. Die folgenden Antworten waren, in dieser Reihenfolge: «Sie bekommen einen Sohn!», «Es ist ein Mädchen!», «Es ist ein Junge!»
Sie können sich vorstellen, dass wir einigen Spaß mit diesen Aussagen hatten. Junge, Mädchen, Junge, Mädchen, Junge, immer schön abwechselnd. Ich kann mich noch erinnern, wie ich witzelte: «Ist sie nicht toll die moderne Medizin! Sie erlaubt es den künftigen Eltern, das Geschlecht des Kindes selbst zu bestimmen, je nachdem ob sie eine gerade oder ungerade Anzahl von Ultraschalluntersuchungen durchführen lassen.»
Die Medizin und besonders auch die medizinische Bildgebung hat sich inzwischen in beeindruckender Weise weiterentwickelt, und vielleicht käme es heute nicht mehr zu dieser «Ambiguität». Der entscheidende Punkt ist hier aber ein anderer: die «Asymmetrie in der Beweisführung», die auch in vielen anderen Lebensbereichen zu Fehlschlüssen einlädt. Zum Nachweis, dass das «betreffende Etwas» vorhanden ist, brauchen Sie es im Ultraschall nur zu sehen. Das ist nicht immer einfach und hängt davon ab, wie genau das Kind im Mutterleib liegt. Viel schwieriger ist es nachzuweisen, dass dieses Etwas nicht da ist. Aus der Tatsache, dass Sie es bei einer Untersuchung nicht sehen, können Sie jedenfalls nicht zweifelsfrei schließen, dass etwas nicht vorhanden ist.
Übrigens, wir bekamen einen Sohn. Das hat mich nicht wirklich überrascht. Wenn man ein männliches Geschlechtsteil sieht, ist es (auch beim Stand der damaligen Technik) nicht sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein «Artefakt» der Bildgebung handelt. Wenn man hingegen kein solches sieht, kann es durchaus sein, dass man es übersehen hat oder eben auch, dass keines vorhanden ist. Das weiß man aber nicht so genau. Die Verlässlichkeit des «positiven Nachweises» ist deutlich höher als die des «Nichtnachweises».
Ähnliche Beispiele von «asymmetrischer Beweisführung» begegnen uns in allen Lebensbereichen. Es handelt sich um logische Regeln, die man nicht einfach umkehren kann. Aus der Tatsache, dass im Ultraschallbild ein kleiner Penis zu sehen ist, kann man schließen, dass es sich um einen Jungen handelt. Die Umkehrung gilt allerdings nicht. Nur weil man keinen sieht, kann man nicht schließen, dass es sich um ein Mädchen handelt. Manche der untersuchenden Ärzte sind genau auf diesen Trugschluss hereingefallen, als sie verkündeten: «Es ist ein Mädchen!»
Wenn A und B zwei logische Aussagen sind und aus der Aussage A die Aussage B folgt, so bedeutet das nicht, dass aus B auch A folgt. Tatsächlich ist «Aus A folgt B» oder «A impliziert B» gleichbedeutend mit «Entweder gilt A gar nicht, oder, falls A jedoch zutrifft, dann muss zwangsläufig auch B gelten». Dabei ist das «oder» einschließend, d.h., es kann beides gleichzeitig gelten, B also auch wahr sein, ohne dass A gilt. Im Ultraschallbeispiel heißt das: «Entweder man sieht keinen kleinen Penis; aber wenn man einen sieht, so handelt es sich um einen Jungen.» Der korrekte «Umkehrschluss» dieser Aussage ist daher: «Wenn es kein Junge ist, sieht man im Ultraschall auch kein männliches Glied», nicht aber: «Wenn man keinen Penis sieht, ist es ein Mädchen.» Tatsächlich enthält die Aussage «Aus A folgt B» überhaupt keine Information darüber, was für B gilt, wenn A überhaupt nicht zutrifft.
Da für uns das Geschlecht des Kindes nicht wichtig und schon gar kein hoch emotionales Thema war, haben wir uns über diese Art von Fehlschlüssen lediglich amüsiert. Es gibt jedoch viele Beispiele, in denen solche falschen Umkehrschlüsse weniger lustig wären und durchaus massive Konsequenzen haben könnten. Die (als korrekt angenommene) Aussage «A impliziert B» ist jeweils kursiv gesetzt.
Falls die Bäume vom Borkenkäfer befallen sind, stirbt der Wald.
Falsche «Konsequenz»: Wenn wir den Borkenkäfer ausrotten, ist der Wald gesund.
Nach einer Werbekampagne steigt der Absatz.
Falsche «Konsequenz»: Um den Umsatz zu steigern, ist eine Werbekampagne erforderlich.
Oft tritt das Problem des falschen Umkehrschlusses auch in anderer «Verkleidung» auf: Aus «A impliziert B» und dem Zutreffen von B wird auf das Zutreffen oder, etwas überhöht, die «Wahrheit» von A geschlossen.
Wenn die Nachfrage nach einem Produkt wächst, steigt der Preis.
Tatsächlich steigt der Preis.
Falscher «Schluss»: Also wächst die Nachfrage, und man sollte die Aktie des Herstellers kaufen.
Denn es kann auch sein, dass der gestiegene Preis nur die gestiegenen Kosten widerspiegelt, und das könnte ganz andere Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.
Wenn ich an der Parkinson-Krankheit erkrankt bin, zittere ich.
Ich zittere.
Falscher «Schluss»: Also habe ich Parkinson.
Denn natürlich gibt es eine Vielzahl anderer, oft auch harmloser Gründe, warum ich gerade zittere.
Viele der bekannten Verschwörungstheorien funktionieren nach folgendem Muster, obwohl es vermutlich kaum jemand zugeben wird:
Wenn geheime Mächte wirken, dann ist die Welt für mich nicht durchschaubar. Ich durchschaue die Welt nicht, also wirken geheime Kräfte.
Und vergessen Sie nicht, 90% aller unserer Kinder zeigen bisweilen ungewöhnliches Verhalten, sind also hochbegabt.
Sie sollten Ihr Testament machen
Im Rahmen Ihres regelmäßigen Gesundheitschecks führt Ihre Ärztin verschiedene Früherkennungstests durch. Sie ist besonders gründlich und lässt Ihr Blut auch auf verschiedene seltene Erkrankungen untersuchen. Nach den offiziellen Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit[5] gilt in der Europäischen Union eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 0,05% aller Personen von ihr betroffen sind, und oftmals sind es viel weniger. Es gibt aber insgesamt mehr als 6000 unterschiedliche seltene Erkrankungen, so dass zwar nur wenige an einer speziellen seltenen Erkrankung leiden, die Anzahl derjenigen, die irgendeine seltene Erkrankung entwickeln, aber gar nicht mal so klein ist. Geschätzt leiden 6–8% der Bevölkerung an irgendeiner dieser Krankheiten.[6]
Sie ahnen es schon: Unglücklicherweise ist das Ergebnis positiv. Genauer: Der Test auf Polyturpitis ist positiv. Das ist besonders bitter, denn bei dieser extrem seltenen Stoffwechselerkrankung kommt auf 100.000 Gesunde gerade mal ein Kranker. Leider gibt es für Polyturpitis keine Therapie, und die Lebenserwartung beträgt höchstens noch ein Jahr. Sie sind also am Boden zerstört. Warum gerade Sie? All Ihre schönen Pläne zunichte! Es ist noch nicht einmal klar, ob Sie im Sommer noch die schon gebuchte Reise nach Ägypten antreten können, und dabei hatten Sie sich so darauf gefreut, die Pyramiden zu sehen. Ihr Leben, so wie Sie es kennen: aus und vorbei? Ab jetzt nur noch Leid, bis zum bitteren Ende?
Aber, sind Sie wirklich erkrankt? Was für eine Frage? Schließlich war der Test doch positiv!
Ob Sie sich wirklich Sorgen machen müssen, hängt natürlich von der Genauigkeit des Tests ab. Wir wissen ja, dass Labordiagnostik in der Medizin fast immer mit Fehlern behaftet ist. Nach Auskunft des Herstellers hat der bei Ihnen angewendete Polyturpitis-Test allerdings eine Genauigkeit von 99%. Seine Fehlerquote fällt also kaum ins Gewicht; der Test ist nahezu perfekt! Sie hätten also wirklich allen Grund, mit Ihrem Schicksal zu hadern. Rund 80.000.000 Bürger sind gesund, und nur 800 haben Polyturpitis. (Wir gehen der einfacheren Rechnung wegen von einer Gesamtbevölkerung von 80.000.800 aus, obwohl die reale Zahl etwas höher ist. Für unser Argument ist das ohne Bedeutung.)
Wieso trifft es ausgerechnet Sie? Sie sollten also Ihr Testament machen, Ihre Angelegenheiten regeln und mit Ihrem Leben abschließen! Wirklich? Ist diese Angst tatsächlich so begründet, wie es scheint?
Der Test irrt in nur einem Prozent der Fälle, das heißt, nur einer von hundert Kranken wird nicht erkannt. Mit für die Medizin fast unglaublicher Genauigkeit von 99 zu 1 werden die Erkrankten also tatsächlich erkannt. Bei 800 an Polyturpitis erkrankten Personen irrt der Test somit statistisch nur in 8 Fällen. 792 werden hingegen korrekt als erkrankt erkannt. Also: kein Strohhalm der Hoffnung?
Allerdings irrt der Test auch in der anderen Richtung. Wenn wir die Laboruntersuchung bei allen 80.000.000 gesunden Bürgern durchführen würden, würde der Test entsprechend der angegebenen Herstellerstatistik ebenfalls in einem Prozent der Fälle versagen. Das bedeutet jedoch, dass der Test auch bei 800.000 Gesunden anschlägt. Insgesamt werden daher von den 80.000.800 Einwohnern 800.792 Personen als lebensbedrohlich erkrankt «erkannt». Von diesen sind jedoch nur 792 wirklich an Polyturpitis erkrankt, 800.000 aber nicht. Obwohl der Test bei Ihnen anschlägt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an der seltenen Krankheit leiden, unter einem Promille. Vielleicht sind Sie wirklich an Polyturpitis erkrankt, mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch nicht.
Wenn Sie jetzt noch daran denken, dass es in Deutschland im Jahr 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamts[7] 2.406.465 gemeldete Verkehrsunfälle mit 361.134 Verletzten gab, dann haben Sie grob abgeschätzt ein 30-fach höheres statistisches Risiko, im nächsten Jahr in einen solchen Unfall verwickelt zu sein, und immerhin ein mehr als vierfaches Risiko, in einem Verkehrsunfall verletzt zu werden. Sie können also ganz beruhigt weiterleben; sehr wahrscheinlich werden Sie auch im nächsten Jahr noch gesund und munter sein (und wahrscheinlich auch keinen Verkehrsunfall haben).
Gut, dass Sie und auch Ihre Ärztin sich durch die durchaus korrekte Genauigkeitsangabe von 99% nicht haben irritieren lassen. Plausibel ist eben nicht immer richtig.
Hier sehen wir einen häufigen Fehler: Wir nehmen eine «Symmetrie» in der Interpretation an, obwohl die Ausgangslage selbst asymmetrisch ist.
Sie haben es sicherlich schon bemerkt: Die Krankheit Polyturpitis ist frei erfunden. Dass der Begriff durchaus «medizinisch» klingt, liegt daran, dass er – wie so viele medizinische Fachbegriffe – aus dem Lateinischen kommt: turpis bedeutet niederträchtig, hässlich, und das wäre diese seltene Krankheit ja nun wirklich.
In unserem fiktiven Beispiel liegt die Asymmetrie darin, dass die Krankheit so selten ist. Die Aussage zur Genauigkeit des Tests enthält nämlich eigentlich zwei Aussagen, erstens, dass eine vorhandene Erkrankung erkannt wird, und zweitens, dass eine gesunde Person auch nicht als krank diagnostiziert wird. Während in beiden Fällen der relative Fehler gleich groß ist, nämlich 1%, so ist jedoch der absolute Fehler, d.h. die Anzahl der falsch Diagnostizierten, sehr verschieden. Die angegebene Testgenauigkeit berücksichtigt nämlich nicht, wie selten die Krankheit in der Bevölkerung überhaupt vorkommt. Wegen der extrem großen Unterschiede zwischen der Anzahl 800 der Kranken und 80.000.000 der Gesunden in der Bevölkerung führt die Multiplikation mit dem in der Testgenauigkeit angegebenen Fehler von nur 1% zu Zahlen von extrem unterschiedlicher Größenordnung. Zwar schlägt der Test bei gerade einmal acht Kranken nicht an, erklärt sie also für gesund; immerhin 800.000 Gesunde werden jedoch fälschlich als krank diagnostiziert.
Daher sagt die Genauigkeit von 99% nichts darüber aus, ob Sie sich wirklich Sorgen machen sollten. Zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, dass bei einem positiven Testergebnis wirklich Polyturpitis vorliegt, müssen wir die Anzahl der Erkrankten unter den positiv Getesteten jedoch ins Verhältnis zu allen positiv Getesteten setzen.
Der Prozentsatz fehlerhafter Testergebnisse ist also schlicht der falsche Quotient, um Ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit abzuschätzen. So überzeugend sich eine Genauigkeit von 99% auch anhört, Ihr Testament brauchen Sie bei Ihrem positiven Ergebnis deswegen nicht gleich zu machen.
Gut, dass Ihre Ärztin die bekannten Statistiken richtig einschätzen konnte. Es ist natürlich zu hoffen, dass Sie niemals in eine solche (trotz richtiger Interpretation durchaus belastende) Situation kommen. Falls aber doch, fragen Sie ruhig detailliert bei Ihrem Arzt nach, immerhin gehört Medizinstatistik zum Prüfungsstoff der Medizinausbildung.
Das perfekte Restaurant
Nächsten Samstag ist es endlich wieder so weit. Ihr lange geplantes, mehrfach verschobenes und freudig erwartetes Wiedersehen mit neun alten Freunden kann endlich stattfinden. Sie treffen sich seit Jahren endlich mal wieder zum Abendessen, und es gibt bestimmt viel zu erzählen.
Für dieses Wiedersehen wollen Sie ein besonders schönes Lokal aussuchen. Sie denken dabei entweder an das neue, etwas stylische, argentinische Restaurant, das zünftige bayerische Gartenlokal oder an das chinesische Restaurant mit dem großen Rundaquarium voller exotischer Zierfische. Sie selbst finden alle drei Optionen hervorragend – aber was wird wohl den anderen am besten gefallen? Sicherlich kämen auch für jeden ihrer Freunde alle drei Restaurants in Frage. Spezielle Allergien oder grundsätzliche Abneigungen gegen eine der drei Kategorien hat keiner von Ihnen.
Aber Julia würde, so wie Sie sie kennen, in jedem Fall das argentinische Lokal bevorzugen, Bayerisch wäre ihre zweite Wahl, während sie kein ausgesprochener Freund der chinesischen Küche ist. Axel hingegen würde ebenfalls am liebsten ins argentinische Lokal gehen, Chinesisch käme auf Platz 2, während Bayerisch seine dritte Wahl wäre. Wenn nur diese beiden zum Abendessen kämen, wäre die Wahl klar: Sie würden in das argentinische Lokal gehen.
Es gibt aber unter den sieben anderen Gästen noch ganz andere Vorlieben. Sie gehen die Liste aller Ihrer Freunde einzeln durch. Um sich einen Überblick zu verschaffen, notieren Sie deren Präferenzen in einer Tabelle. Der Einfachheit halber sind Ihre Gäste dort durchnummeriert, F1 bis F9, d.h. Freund 1 bis Freund 9. Julias Vorliebe ist unter F1 zu sehen, A vor B vor C, d.h. Argentinisch vor Bayerisch vor Chinesisch, von oben nach unten. Axels Präferenzen sind in Spalte 2 angegeben, A, C, B, also Argentinisch vor Chinesisch vor Bayerisch.
Die Tabelle gibt einen klaren Überblick, wie Ihre neun Freunde die drei Optionen A, B, C auf ihre Plätze 1, 2 und 3 setzen.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
A
A
A
A
B
B
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
C
B
B
B
A
A
A
A
A
Was ist aber nun aufgrund dieser «Datenlage» die beste lukullische Entscheidung?
Das ist gar nicht so ganz klar. Für jede der drei Alternativen spricht durchaus etwas; einheitlich ist das Bild jedenfalls nicht. Natürlich könnten Sie sagen: «Dann entscheide eben ich, wohin wir gehen, schließlich bezahle ich das Essen ja auch.» Aber einen solchen Eindruck wollen Sie erst gar nicht aufkommen lassen. Sie versuchen ja wirklich Ihr Bestes, damit der Abend gelingt. Ihre Wahl soll daher so fair wie möglich und für alle klar nachvollziehbar sein. Schließlich könnten sich sonst vielleicht diejenigen Freunde benachteiligt fühlen, denen ein anderes Restaurant lieber gewesen wäre.
Bei Wahlen denkt man meistens zuerst an die große oder wenigstens kommunale Politik. Tatsächlich haben wir ja regelmäßig Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, die stets und völlig zu Recht auch eine große mediale und politische Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei der Bundestagswahl 2021 waren insgesamt 61.181.072 Wahlberechtigte[8] aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Mit der Zweitstimme konnte eine von 40 verschiedenen Parteien gewählt werden; die Erststimmen verteilten sich auf insgesamt 6211 Direktkandidaten[9] in 299 Wahlkreisen.
Das ist natürlich eine ganz andere Dimension als bei unserer «Essen-mit-Freunden»-Wahl mit ihren nur neun Wahlberechtigten und drei Kandidaten, und zugegebenermaßen ist das Ergebnis von Bundestagswahlen auch deutlich wichtiger. Allerdings ist die Aufgabe nicht wirklich so verschieden, wie es sich zunächst vermuten lässt. Jeder einzelne Wahlberechtigte hat Präferenzen für Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten und äußert diese auf den Stimmzetteln.
In politischen Wahlen können den Wahlberechtigten je nach Wahlsystem dabei durchaus verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für ihren politischen Willen zur Verfügung stehen, vom einfachen Kreuzchen bis hin zum Kumulieren und Panaschieren.
Für Ihre Restaurant-Wahl kennen Sie die Präferenzen von jedem Ihrer neun Freunde: Julias Platz 1 ist Argentinisch, gefolgt von Bayerisch, und Chinesisch liegt auf Platz 3. Bei der Bundestagswahl hat man natürlich viel mehr als drei Alternativen. Zur Wahl 2021 waren 54 Parteien zugelassen. Hiervon nahmen 47 letztlich teil, 40 davon mit Landeslisten.[10]
Statt mehr als 60 Millionen Wahlberechtigter, die mit ihrer Zweitstimme eine von 40 Landeslisten wählen konnten, hat unsere kleine «Essen-mit-Freunden»-Wahl nur neun Wahlberechtigte, die ihre Präferenzen für die drei Alternativen A, B und C ausdrücken konnten. Natürlich geht es bei der Restaurant-Wahl auch nicht um die Zusammensetzung des Bundestags, also um eine möglichst gerechte Abbildung des Wählerwillens in parlamentarische Kräfteverhältnisse. Nein, viel, viel einfacher: Wir suchen ja nur das beste Restaurant für einen einzigen Abend.
Wenn aber der Unterschied doch gar nicht so grundsätzlich ist, können wir dann nicht einfach mal gängige politische Wahlsysteme zu unserer Entscheidungsfindung anwenden? Versuchen wir es!
Zu den gängigsten Wahlverfahren gehört sicherlich das der Mehrheitswahl, wie es etwa bei den Parlamentswahlen in England oder (mit Ausnahme von Georgia und Louisiana) bei den Senatswahlen in den USA angewendet wird. Die Präsidentschaft in Frankreich wird hingegen mittels einer absoluten Mehrheitswahl mit Stichwahl entschieden. Wenn auch weniger bei politischen Wahlen, so ist auch die «Punkte»-Wahl recht weit verbreitet, bei der Sie den Alternativen je nach Ihren Präferenzen Punkte zuweisen.
Wenden wir diese drei Verfahren doch einfach mal auf unsere Restaurant-Auswahl an!
Beim Mehrheitswahlrecht hat jeder unserer Freunde F1 bis F9 eine Stimme, die er seinem bevorzugten Restaurant, also seinem Platz 1 gibt. Wir zählen nun einfach ab, wie viele Stimmen jedes Lokal bekommen hat. Julia und Axel wählen Argentinisch, A erhält also schon mal ihre zwei Stimmen. Da F3 und F4 ebenfalls A wählen, die anderen aber andere Favoriten haben, erhält A insgesamt vier Stimmen. F5, F6 und F7 geben ihre Stimme B, während F8 und F9 sich für C entscheiden. Die Tabelle fasst das Wahlergebnis noch einmal zusammen.
A
B
C
4
3
2