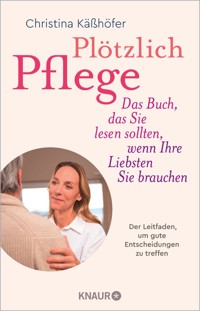
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pflege betrifft uns alle - doch sind wir vorbereitet? Ein bewegendes Buch über die emotionale Achterbahnfahrt der Pflege. »Zwischen Überforderung, Zeitdruck und persönlichen Sorgen gibt es in der Pflege keine perfekten Entscheidungen, nur gute.« Christina Käßhöfer nimmt uns mit auf ihre persönliche Reise durch das deutsche Pflegesystem - ein System, das Angehörige fordert und überfordert. Seit Jahren kümmert sie sich um ihren an Parkinson erkrankten Vater, navigiert durch einen undurchsichtigen Dschungel aus Anträgen, Pflegegraden, Pflegealltag und der Suche nach guten Fachkräften. Dabei stößt sie an ihre eigenen Grenzen - körperlich, mental und finanziell. Solange es uns nicht selbst betrifft, verdrängen wir das Thema. Doch wenn die Krise eintritt und ein Elternteil oder der eigene Partner pflegebedüftig wird, sind wir gefordert, für einen anderen Menschen lebensverändernde Entscheidungen zu treffen. Erschöpfung, Zeitdruck, fehlende Unterstützung, verwirrende Informationen - die Belastungen sind enorm. Besonders Frauen tragen oft die Hauptverantwortung und fühlen sich zwischen Pflichtgefühl und Überforderung gefangen. Dieses Buch ist mehr als ein Erfahrungsbericht. Es ist ein ehrlicher, kraftspendender Wegweiser für alle, die sich in der Pflege ihrer Liebsten wiederfinden und vorbereitet sein wollen. Neben ihren persönlichen Erfahrungen und Schicksalsschlägen erzählt Christina Käßhöfer von Unsicherheiten und Ängsten - aber auch von Mut und Durchhaltevermögen und teilt praktische Tipps und wichtige Hilfestellungen, um sich der Verantwortung zu stellen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. - Aufbau eines Unterstützernetzwerks - Beantragung von Pflegestufen und Widerspruch - Möglichkeiten häuslicher und stationärer Pflege - Vor- und Nachteile einzelner Pflegeoptionen - Führen schwieriger Gespräche - Wissenswertes von Patientenverfügunge, Vollmachten bis Palliativversorgung - Selbstfürsorge: Grenzen erkennen und setzen Ein informativer, ermutigender Leitfaden für pflegende Angehörige, der Trost spendet und Orientierung bietet für eine der schwierigsten Phasen des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christina Käßhöfer
Plötzlich Pflege
Das Buch, das Sie lesen sollten, wenn Ihre Liebsten Sie brauchen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Zwischen Überforderung, Zeitdruck und persönlichen Sorgen gibt es in der Pflege keine perfekten Entscheidungen, nur gute.«
In »Plötzlich Pflege« nimmt Christina Käßhöfer uns mit auf ihre persönliche Achterbahnfahrt durch das deutsche Pflegesystem – ein System, das Angehörige fordert und häufig überfordert. Seit Jahren kümmert sie sich um ihren an Parkinson erkrankten Vater, sie navigiert durch einen undurchsichtigen Dschungel aus Anträgen und Pflegegraden, immer wieder ist sie auf der Suche nach guten Fachkräften. Dabei stößt sie an ihre eigenen Grenzen – körperlich, mental und finanziell.
Neben ihren eigenen Erfahrungen und Schicksalsschlägen erzählt Christina Käßhöfer von Unsicherheiten und Ängsten, aber auch von Mut und Durchhaltevermögen. Sie gibt praktische Tipps und wichtige Hilfestellungen, damit all die, die sich der Verantwortung stellen, sich dabei nicht selbst verlieren.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Prolog
1 Die Krise tritt ein
Parkinson – das Wort, das alles verändert
Unser Umgang mit Krisen
Nachfragen bringt Licht ins Ungewisse
2 Die Fassade bekommt Risse
Kleine Stürze, großes Schweigen
Der feine Grad zwischen Krankheit und Pflege
Was Zeit wert ist
3 Von eigenen Glaubenssätzen und sozialem Druck
Warum Pflege (nicht) weiblich ist
Ein Gedanke bleibt – Es ist nie genug
4 Der Wunsch nach einem selbstbestimmten und sicheren Leben
Ein verrückter Einfall: ein behindertengerechter Bungalow
Von alten Bauordnungen und neuen Bedürfnissen
Der Weg zur Unterstützung – Wie man schwierige Gespräche über Hilfe führt
5 Niemand wird gerne beurteilt
Das Pflegegutachten
6 Zuhören, verstehen, entscheiden – unverzichtbar für eine gute, stabile Pflegesituation
Warum Scham und Erwartungen menschlich, aber hinderlich sind
Die Gründe, für welche Pflegelösung wir uns entscheiden
7 Externe Pflege organisieren – eine Aufgabe für sich
Die Suche nach einem mobilen Pflegedienst
Die lieben Finanzen – Pflege muss man sich leisten können
8 Unser Pflegealltag – zwischen Organisation, Erschöpfung und Normalität
Streben nach Autonomie
Personalmangel und Norovirus – Warum intensive Recherche guter Einrichtungen unerlässlich ist
9 Ein Pflegenetzwerk – der wichtigste Rettungsanker in einer privaten Pflegesituation
Pflege braucht eine starke Gemeinschaft
10 Jakub zieht ein – Neues Familienleben mit einer 24-Stunden-Haushaltshilfe
Im Notfall nicht alleine
11 Weitere Schicksalsschläge – Warum es wichtig ist, jeden Augenblick zu genießen
Lungenentzündung – Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist
Ein ungebrochener Lebenswille
12 Was Pflege ausmacht – Mitgefühl, Interesse, Erinnerungen
Meine Eltern werden Arbeitgeber
Was dem Leben Leichtigkeit schenkt, auch in der Pflege
13 Mit dem Rücken an der Wand – Alle Energie ist aufgebraucht
Ein tiefes Tal
Die Tür des Vertrauens geht nach außen auf
Pflegedienstleisterwechsel – Nach Schatten kann Licht kommen
14 Pflege in Deutschland – Wo wir als Gesellschaft stehen
Unsere Idealvorstellung braucht Korrektur
15 Selbstfürsorge beginnt beim Annehmen, was ist
Wir dürfen auch an uns denken
16 Vom Loslassen und Vorausschauen
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden
Mein persönlicher Pflegeleitfaden
1. Unterstützung in der Sorgearbeit und Pflege
2. Pflegebedürftigkeit
3. Hilflosigkeit versus Pflegebedürftigkeit
4. Die Pflegeversicherung
5. Fragebogen für einen Anspruch auf Pflegeversicherungsleistungen
6. Demenzerkrankungen: Erste Anzeichen erkennen
7. Die Pflegeberatung – Wichtigkeit und Anspruch
8. Pflegegrade und Pflegegradbegutachtung
9. 17-Punkte-Plan für die ersten Schritte
10. Pflegeleistungen im Überblick
11. Vor- und Nachteile einzelner Pflegelösungen
12. Unterstützung durch 24-Stunden-Kräfte
13. Wichtige rechtliche Dokumente
14. Hilfestellungen für pflegende und sorgende Bezugspersonen
15. Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
16. Sozial-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung für pflegende Angehörige
17. Palliativversorgung
Literatur und Links
Dank
Bildnachweis
Für meine Mutter.
Für alle Alltagsheldinnen.
Vorwort
Es ist schwer, verdammt schwer. Sie werden von mir nicht hören, dass der Weg, der vor Ihnen liegt, mit zunehmendem Fortschreiten einer Krankheit und Pflegebedürftigkeit eines geliebten Menschen – und vielleicht auch Ihrem eigenen Älterwerden – leicht wird.
Im Verlauf der Parkinson-Erkrankung meines Vaters sehe ich immer wieder ein Bild vor mir: Ich sitze im Sand, die Füße eingegraben. Langsam zieht die Ebbe das Wasser zurück, und unter meinen Beinen formt sich eine Kuhle. Wie ein langsames Unterhöhlen, ein stetiges, unaufhaltsames Nachgeben. Dieses Gefühl, das in mir immer mehr Raum einnimmt, begleitet mich, seit mein Vater im Jahr 2002 die Diagnose bekam. Heute, 2025, hat er Pflegegrad 5 und wird in seinem Zuhause umsorgt. Mutig hatte ich mich bisher mit Neugier allen Chancen im Leben gestellt. In letzter Zeit fühlt es sich so an, als hätte es mich über Bord gestoßen.
Was kündigt die leise, schleichende Krankheit eines geliebten Menschen an, die alles aus den Angeln hebt? Wo ist die Sirene, wenn das Leben kippt und sich unter einem der Boden langsam in eine Kuhle verwandelt? Als sich mein eigenes Leben plötzlich nur noch darum drehte, die Würde meines Vaters zu bewahren, wurde alles andere zur Nebensache. Komplizierte Situationen im Beruf, Liebeskummer oder Ärger mit dem Finanzamt rückten plötzlich in den Hintergrund. Und ich begriff: Man kann weitermachen, auch wenn die Welt um einen herum stillsteht und wenig Sinn macht.
In den mehr als zwanzig Jahren, in denen ich meinen Vater und seine Krankheit begleite, habe ich unzählige Tiefen und Höhen im deutschen Pflegesystem erlebt. Dinge, die mich schockiert und mein Vertrauen in unseren Sozialstaat ein Stück weit erschüttert haben. Trotz allem gibt es gute Gründe, die Zuversicht nicht zu verlieren – auch in einem überlasteten und chaotischen Pflegesystem. Zuversicht, das bedeutet für mich, nach vorn zu schauen und an etwas mitzuwirken, damit es besser wird. Nicht Politiker und ihre Entscheidungen geben mir diese, sondern couragierte Menschen, die sich füreinander und für das Gemeinwohl einsetzen. Engagierte Angehörige, Nachbarn, herzliche Pflegefachpersonen, kompetente Pflegeberater und all jene, die helfen, das Labyrinth aus Anträgen, Fachbegriffen und Pflegekräftemangel zu durchbrechen. Sie gibt es, glauben Sie mir!
Dieses Buch ist eine persönliche Reise durch ein Labyrinth aus Verantwortung, Zuwendung und einem Pflegesystem, das oft mehr Fragen als Antworten aufwirft. Ich habe nicht die perfekte Lösung für alle Pflegesituationen. Denn es gibt hier keine richtigen oder falschen Entscheidungen, nur die besten, die mit den verfügbaren Mitteln und Kräften in einem bestimmten Augenblick möglich sind. Ich bin keine gelernte Pflegekraft, habe aber aus meiner beruflichen Erfahrung einiges an Konfliktbewältigungsstrategien mitnehmen können. Außerdem trage ich nicht die körperliche Hauptlast bei der Pflege meines Vaters, das ist meine Mutter. Dennoch versuche ich seit mehr als fünfzehn Jahren, ein liebevolles Umfeld für meinen Vater zu schaffen, in dem dieser seine verbleibende Zeit genießen kann.
Meine Reise ähnelt einem Prozess aus kleinen Schritten – manchmal vorwärts, manchmal zurück. Somit ist sie eine Sammlung von Erfahrungen und Einsichten, eine »Pflege-Werkzeugkiste«, gefüllt mit Anregungen und praktischen Hilfestellungen. Ganz gleich, welche Gefühle Sie erleben – Stress, Angst, Frustration oder Trauer –, ich hoffe, dass Sie hier Ideen für die nächsten Schritte finden und den Mut, sich Unterstützung zu holen. Das Buch ist also Tagebuch und Leitfaden zugleich. Wenn es Ihren Weg ein wenig leichter macht, gute Lösungen zu finden für die Person, die Sie pflegen, und auch für sich selbst, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Prolog
2024
Der lange, kahle Flur liegt verwaist. Erstaunlich ruhig für einen Faschingsdienstag, denke ich noch beim Betreten der Notaufnahme. An einer der Wände mit der Farbe von geronnener Butter, die jeden, krank oder gesund, gelblich aussehen lässt, lehnt Petra, blass und ernst. Mit müden Augen drückt sie, mit der ich wie eine Schwester aufgewachsen bin, erst meine Mutter, dann mich fest an sich.
»Wo sind sie?«, frage ich erschöpft von der langen Autofahrt und der Ungewissheit.
»Die zweite Tür rechts, da vorn.« Petra zeigt auf eine der vielen geschlossenen Türen, die hinter den leeren Besucherstühlen abgeht. Wenige Stunden zuvor hatte mich die Handynachricht erreicht: Hallo Christina, bin mit Wolfgang im Krankenhaus – hatten Sturz mit Rollstuhl im Bus – Halswirbelsäule betroffen. Können wir telefonieren, wenn der Doc den Befund hat?« Abgeschickt hatte sie Marianne, eine ausgebildete Altenpflegerin, die seit einem Jahr mit Kompetenz und fröhlichem Enthusiasmus unser privates Pflegekommando unterstützt. Sekunden später rief ich sie zurück. Nach einem gepressten »Hallo« gab sie ihr Telefon an den diensthabenden Arzt weiter, der sich als Dr. Schramm vorstellte. Sturz, Fraktur, Notoperation. Jeden Augenblick könne es zu einer Querschnittslähmung kommen. Ich verstand nur Bruchstücke, benebelt durch die Schocknachricht. Der kurzen Erklärung des Chirurgen folgte ein Drängen, sofort, im kalten Auto, ohne meinen Vater gesehen zu haben, einer Operation zuzustimmen. Wenn ich etwas in beruflichen Stressphasen als weibliche Führungskraft und bei privaten Kurzschlussreaktionen gelernt habe, dann das: Es empfiehlt sich, neue Sachlagen für einen Moment setzen zu lassen. Mein verletztes Ego schießt gerne pfeilschnell, schneller, als mein Kopf gewöhnlich abkühlen kann. Aber mit Ende vierzig sollte ich ja irgendwas begriffen haben.
»Wie lange ist er schon bei Ihnen in der Notaufnahme? Hat sich sein Zustand in der Zwischenzeit verändert?«, versuchte ich vom Arzt zu erfahren, um Zeit zu schinden, um nachzudenken.
»Sein Zustand ist kritisch, aber aktuell stabil«, bescheinigte mir der Chirurg, während ich mein Auto von München Richtung Franken lenke.
»Dann erwarten Sie sicherlich nicht, dass diese Entscheidung am Telefon getroffen wird, ohne dass ich meinen Vater gesehen oder mich mit meiner Mutter abgestimmt habe?« Es fiel mir schwer, die Wut und Überforderung in meiner Stimme zu unterdrücken. Wir einigten uns, das Gespräch fortzuführen, sobald ich persönlich in der Notaufnahme eintraf.
Ich bin es gewohnt, in beruflichen Situationen Druck standzuhalten und Optionen sachlich abzuwägen. Aber das hier war etwas völlig anderes. Würde mein Vater einen weiteren Schicksalsschlag verkraften? Würde er ein Dasein ohne Bewegungsmöglichkeiten seiner Arme und Beine noch als lebenswert erachten, neben all seinen anderen Einschränkungen? Das Gedankenkarussell raste, Horrorszenarien stiegen in mir auf.
Während ich durch die dunkle Nacht fuhr, hatte ich das dringende Bedürfnis, Jörg, den Mann, mit dem ich seit einigen Monaten ausging, um Rat zu fragen. Ich mochte seine überlegte, aber herzliche Art. Er, der beide Elternteile bis zu ihrem jeweiligen Tod gepflegt hatte, konnte bestimmt am besten nachfühlen, wie es mir ging. In Deutschland war es 21:26 Uhr. In Detroit, wo er seit Jahresbeginn für einen deutschen Industriekonzern tätig war, früher Nachmittag. Sein Name blinkte wenige Minuten nach meiner WhatsApp auf meinem Display auf.
»Hey.«
»Hey. Ich habe deine Nachricht gelesen. Das ist ja schrecklich. Wie geht es ihm?«
»Ich habe gerade mit dem Arzt gesprochen.« Und ich erzählte ihm kurz von der Unterhaltung mit dem Chirurgen. Als ich mit der Schilderung fertig war, fügte ich hinzu: »Sie wollen ihm heute Nacht noch die beiden gebrochenen Rückenwirbel stabilisieren. Wäre es dein Vater, würdest du zustimmen, wenn die Operation alternativlos ist?«
»Ja, zumindest dann, wenn es keine Alternativen gibt. Das Risiko einer Querschnittslähmung wäre mir zu groß«, antwortete Jörg besonnen. »Und«, setzte er nach, »nehmt euch Zeit für eure Fragen und die Entscheidung.« Seine Worte trösteten mich.
Bevor ich in die Klinik fuhr, holte ich zu Hause meine sichtlich erschütterte Mutter ab, die schon vor der Tür stand. Kurze Zeit später, es war schon weit nach Mitternacht, bogen wir in die dunkle Straße zum Krankenhaus ein.
Als Petra, meine Mutter und ich zu dritt den kleinen Ambulanzraum betreten, finden wir meinen Vater auf einer Liege vor, eine wattierte grüne Halskrause hält seinen Kopf in gerader Position. Marianne steht neben ihm und streichelt ihm über den Arm. Ein schlaksiger jüngerer Mann mit dunklem Fünftagebart steht in weißem Arztkittel am Ende des Raums. Ich habe so viele Fragen, insbesondere an Marianne: Was ist passiert? Wie war der Sturz im Rollstuhl überhaupt möglich, wo es doch Gurte gibt? Warum waren sie mit dem Bus anstatt mit dem kleinen, weißen Elektro-Fiat unterwegs, der genau dafür angeschafft wurde? Die Fragen stelle ich nicht, auch später nicht. Ändern sie doch nichts am Leid meines Vaters. Die Schuldfrage hat im Unterholz des Lebens selten Licht ins Dickicht gebracht. Unglück passiert, selbst wenn es schwer zu akzeptieren ist.
Mein Vater, wir vier Frauen und der diensthabende Arzt, den ich auf Mitte dreißig schätze – er schüttelte meine Hand, »Dr. Schramm, wir hatten telefoniert« –, füllen den kleinen Raum. Der Unfallchirurg wirkt, als ob sein Tag schon fünfundzwanzig Stunden hatte. Sicherlich traurige Routine in diesem harten Job.
»Hallo, Papa«, begrüße ich meinen Vater und versuche, meiner Stimme eine Spur positive Normalität zu verleihen. »Was macht ihr denn für Sachen?« Vorsichtig drücke ich ihm einen Kuss auf die Wange, um seine Liegeposition nicht zu verändern.
»Tja, das war’s wohl mit dem Ausflug«, antwortet mein Vater mit seinem gewohnt trockenen Humor. Sonst sagt er nichts. Die nachmittägliche Fahrt in die Stadt zur Fußpflege mit anschließender kleiner Runde über den Marktplatz wäre eine schöne Abwechslung gewesen, endlich einmal außer Haus. Stattdessen befindet er sich seit über sechs Stunden in der Notaufnahme. Sein Blick ist wach, trotz der fortgeschrittenen Stunde. Hätte er keine Halskrause um, könnte man denken, der Ausflug hätte ihm keinen lebensbedrohlichen Schlag versetzt. In diesem Augenblick, während seine blauen Augen auf mir ruhen, spüre ich sein bedingungsloses Vertrauen, ein unsichtbares Band, geknüpft aus Liebe und Nähe. Statt panisch zu werden, bin ich hoch konzentriert. Mein Blick geht zu meiner Mutter, die verunsichert neben Petra am Medizinschrank lehnt, dann weiter zu Dr. Schramm. Er zeigt auf zwei Röntgenbilder, die an einem Leuchtkasten hängen, auf denen das Rückgrat meines Vaters aus zwei Richtungen gut zu erkennen ist.
»Durch das Umkippen des Rollstuhls im Bus nach hinten und den brachialen Aufprall Ihres Vaters mit dem Hinterkopf auf den Boden ist es zu einer Fraktur des vierten und fünften Wirbelkörpers gekommen«, erklärt er. Mit einem Stift kreist er die betroffene Stelle ein. »Unterhalb dieser beiden Rückenwirbel laufen die Nervenstränge, die es uns ermöglichen, Arme und Beine zu bewegen.«
Sogar für mein ungeschultes Auge ist ein feiner Riss auf dem grau schattierten Röntgenbild deutlich zu erkennen. Und die Wirbel sehen irgendwie weggerutscht aus.
»Sie sprachen am Telefon von einer Not-OP. Gibt es andere Optionen?«, frage ich und spreche das Offensichtliche aus: »Mein Vater ist über achtzig Jahre alt, sein Körper ist nach der langen Parkinson-Erkrankung stark geschwächt.«
Dr. Schramm ist das bekannt, auch wenn er nicht die medizinische Vorgeschichte meines Vaters im Detail kennt. Mit Bestimmtheit in der Stimme erwidert er: »Für uns ist die Operation alternativlos.« Und schiebt erklärend nach: »Wir würden in einer OP die beiden Wirbel mit langen Metallschrauben entlang der Wirbelsäule fixieren. Diese verbleiben im Körper. Nehmen wir keine Stabilisierung vor, könnte es bei einer unbedachten Bewegung, zum Beispiel beim An- und Ausziehen, zu einer Lähmung aller vier Extremitäten kommen.«
Querschnittslähmung also, das fehlt noch. Petra ist als Physiotherapeutin geübt im Umgang mit Querschnittsgelähmten und Schlaganfallpatienten. Jetzt fragt sie: »Drücken die Wirbel auf den Spinalkanal?«
»Ja.« Und den Kern ihrer Frage ahnend, fügt Dr. Schramm hinzu: »Wir werden erst nach der Operation beurteilen können, ob drastische Ausfallerscheinungen bei der Mobilität dauerhaft entstanden sind.«
Ich bin unendlich dankbar, Petra in dieser Nacht an meiner Seite zu wissen.
»Ich würde Sie jetzt kurz alleine lassen, damit Sie sich besprechen können.« Der Arzt geht Richtung Tür. Es ist klar, er möchte bald eine Entscheidung.
Ich sehe meinen Vater an, unsere Blicke verhakt.
»Papa, hast du Schmerzen?«
»Nein.«
Die gleiche Antwort in all den Jahren. Nie ein Klagen oder Resignation, stoisch akzeptiert er sein Los. Zugleich scheinen die Schmerzmittel zu wirken.
»Hast du verstanden, was der Arzt gesagt hat? Zwei deiner Rückenwirbel sind durch den Sturz gebrochen.« Es ist ungewiss, ob mein Vater, nach dem schweren Trauma, bedingt durch den Schock und die Stunden in der Notaufnahme, etwas von dem verstanden hat, was im Raum besprochen wurde. Auch wenn seine kognitiven Fähigkeiten nach über zwanzig Jahren mit Parkinson noch einigermaßen fit sind, ist das möglicherweise alles doch ein bisschen viel. Meine Mutter, Petra und ich sind uns schnell einig: Die OP ist unumgänglich, aber heute Nacht wird nicht operiert. Dem Chirurgen werden, ebenso wie meinem erschöpften Vater, ein paar Stunden Schlaf guttun. Was wir ahnen: Die Risiken des Eingriffs liegen weniger bei der Operation selbst als bei den damit verbundenen Strapazen. Wie wird der Körper die Narkose verarbeiten? Wird es körperliche Folgeschäden durch diese und die mehrstündige Operation geben? Ich mache mir große Sorgen, ob der Körper meines Vaters überhaupt noch Kraftreserven für den Heilungsprozess hat. Die Angst und die Bürde der Entscheidung kann meiner Mutter und mir niemand nehmen.
»Wir würden der Operation zustimmen, aber erst morgen früh. Ein paar Stunden Schlaf schaden nicht«, sage ich dem Arzt, nachdem er zurück ist. »Wie wird sie ablaufen?«
»Aufgrund der Komplexität des Eingriffs werden wir zu zweit operieren.« Dass ihm ein mehr als sechsstündiger Eingriff bevorsteht, wissen wir zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht. Die lange Risikoaufklärung, die man oft am Tag vor einer Operation erhält, schrumpft heute Nacht auf wenige Minuten zusammen. Während meine Mutter und ich als Bevollmächtigte für meinen Vater die vielen Seiten der Einwilligungserklärung unterzeichnen, spüre ich: Heute Nacht möchte ich meinen Vater nicht alleine lassen. Ich gebe die Papiere einer Arzthelferin, drücke meinem Vater die Hand und umarme zum Abschied meine Mutter, Marianne und Petra. Sie werden nach Hause fahren, meine Mutter wird morgen wiederkommen.
Als mein Vater mit mir im Schlepptau auf die Abteilung Innere Medizin der Uniklinik geschoben wird, ist es kurz vor zwei. Ein paar seiner Sachen, die meine Mutter noch zu Hause eingepackt hatte, einen Pyjama und eine Zahnbürste, hole ich heraus. Die Schwester zieht ihm jedoch ein grün gepunktetes Krankenhausnachthemd mit offener Rückseite an und schließt ihn an eine Vielzahl von Kontrollgeräten an. Für mich stehen ein gelblicher Plastikstuhl und eine dünne Polyesterdecke neben seinem Bett bereit. Mein Nachtquartier. »Danke, das reicht völlig«, quittiere ich das der routinierten Nachtschwester, die uns daraufhin alleine zurücklässt. Ich ruckle den Plastikstuhl etwas näher an das Krankenbett meines Vaters und halte seine Hand. Irgendwann schläft er erschöpft ein. In diesem Augenblick schwappt eine Welle an Emotionen, die ich die letzten Stunden weggedrückt hatte, um stark zu sein, über mich. Es hört nicht auf. Die Parkinson-Krankheit hat schon viele Schicksalsschläge für ihn und uns als Familie mit sich gebracht. Die Trauer darüber, was er alles erleiden muss, lässt brennende Tränen in meinen Augen aufsteigen. Diese beschissene Krankheit. Und jetzt noch ein Sturz! Ich würde alles dafür geben, sein Leid für ihn zu schultern. Mich in wenigen Stunden auf den Operationstisch legen, um ihm die erneuten Strapazen zu ersparen. Ich würde ihm ein paar meiner Rückenwirbel schenken, wenn die Medizin schon so weit wäre, wie Erwin Bach seiner Frau Tina Turner eine Niere. Manchmal fällt es mir schwer, Unabänderliches zu akzeptieren.
Als mein Vater neben mir wach wird, scheint der Tag fad durch die grauen Lamellenfenster. Während die Operationsschwester ihn für den OP-Saal vorbereitet, möchte ich noch etwas loswerden: »Papa, wir sehen uns. Ich bin hier. Die ganze Zeit. Wir haben dich lieb.«
»Wie, Operation?«, fragt er, als er in den Patientenaufzug geschoben wird.
»Dein Sturz hat ein paar Wirbel gebrochen.« Bevor ich mich richtig verabschieden kann, schiebt die Schwester meinen Vater in den Aufzug. Er sieht verwirrt und verloren aus.
Die Stunden, in denen meine Mutter und ich vor der Tür mit der Aufschrift »Operationssaal, kein Zutritt« warten, dehnen sich. Wieder einmal wird mir schmerzhaft bewusst: Das Leben ist voller Krisen, wir können sie nicht vermeiden. Und ich kann meinen Vater nicht davor beschützen. Das Gefühl der Machtlosigkeit setzt mir sehr zu. In meiner langjährigen Begleitung meines Vaters habe ich verstanden: In der Pflege gehören dramatische Veränderungen zu unserem Familienalltag. Lungenentzündung, Wirbelfraktur, Koma. Wir haben nur in der Hand, wie wir darauf reagieren. Immer wieder versuchen wir aufs Neue, die bestmögliche Entscheidung im jeweiligen Augenblick zu treffen. Aufgrund von Fakten, gelernten Erfahrungen und im Gefühl, was sich mein Vater wünschen würde.
1Die Krise tritt ein
In den 2000er-Jahren
Parkinson – das Wort, das alles verändert
Im Falle meines Vaters fehlten meiner Mutter und mir die feinen Antennen, um früh zu erkennen, dass sein langsamer Gang und die ständige Müdigkeit Zeichen für eine unheilbare Erkrankung seines Nervensystems und nicht dem Stress zugeschrieben waren, ein Unternehmen zu leiten. Anfangs waren es kleine Dinge, die wir nicht ernst nahmen. Eine verschlossene Bürotür für ein kurzes Nickerchen, heimlich. Die hängenden Schultern. Seine Handschrift, die zu einem unleserlichen Haufen aus Punkten verkümmerte, ähnlich Vogeldreck auf einer Gartentischdecke. Seine Stimme wurde rauer, Räuspern sein ständiger Begleiter, als müsste er einen inneren Widerstand überwinden, jedes Wort ein wenig erkämpft. Und er verlernte, eine Pointe mit dem richtigen Timing zu erzählen. Nicht besorgniserregend, oder?
Es ist 2002, ich bin auf Heimatbesuch aus Chicago. Meinem einzigen, denn meine Auslandstätigkeit für einen Hamburger Handelskonzern bringt nur zehn spärliche Tage Urlaubsanspruch pro Jahr mit sich. Zu kurz für häufige Heimflüge über den Atlantik.
Die Freude, ihr einziges Kind einmal für ein paar ruhige Tage um sich zu haben, war meinen Eltern im Gesicht abzulesen, als ich ankam und das Haus betrat. Als ich vor der Garderobe am Eingang stehe, in der mein Vater neben seinen Mänteln auch seinen Geldbeutel und seine Schlüssel deponiert, entdecke ich sie: die Packung Tabletten. Ein schlichtes weißes Etikett, kaum auffällig. Ich nehme den Beipackzettel heraus – und das Wort »Parkinson« lässt mich kurz erstarren. Mit der Packung in der Hand gehe ich durch die Küchentür, wo meine Eltern um den Tisch sitzen.
»Wollt ihr mir etwas sagen?«, platzt es aus mir heraus.
»Es ist noch frisch, die Diagnose«, sagt er leise, mit einer Spur Resignation in der Stimme.
Wie, Diagnose? Ich sehe, wie er unruhig auf dem Polstersitz hin und her rutscht, seine Augen auf den Boden gerichtet. Meine Mutter streicht ihm über die Hand, und in ihrem Blick liegt etwas, das ich in all den Jahren bei ihr noch nie gesehen habe: Unsicherheit, mehr noch Hilflosigkeit. »Wir wollten, dass du dich nicht sorgst, du bist ja so weit weg«, sagt sie schließlich. »Aber leider ist es, wie es ist.« Dieser Satz hallt bis heute in mir nach. Es ist, wie es ist.
Noch bevor ich wusste, was Parkinson mit sich bringt, hatte ich das Gefühl, als würde von mir verlangt werden, endgültig erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen, mit zweiunddreißig. All die Jahre war mein Vater für mich wie ein Fels in der Brandung – unerschütterlich, kraftvoll, voller Leben. Keine drei Tage fiel er in seinem ganzen Berufsleben wegen Krankheit aus. Und jetzt, mit Anfang sechzig, sollte er plötzlich krank sein? Schwer zu glauben. Das innere Bild von Michael J. Fox, dem Schauspieler aus Zurück in die Zukunft, blitzte kurz auf, er war mit Parkinson konfrontiert und trieb seitdem die Erforschung dieser Krankheit voran. Aber das hier war nicht Michael J. Fox, das war mein Vater. Der Gang zum Neurologen, zu dem ihn mein Onkel gedrängt hatte, hatte die Gewissheit gebracht. Einmal auf einem Strich geradeaus laufen, die Reaktionsfähigkeit der Muskeln und Nerven testen, kognitive Fragen beantworten und ein Schlucktest mit dem Medikament Levodopa.
Peng, abgestempelt – »unheilbar«. Verunsichert fragte ich mich: Wie lange spürt er schon, dass sich etwas in ihm verändert? Warum hat er nichts gesagt? Heute weiß ich, er zögerte das Unabwendbare hinaus, indem er nicht zum Arzt ging und seine Sorgen nicht mit uns teilte.
Die Monate nach diesem Gespräch in der Küche fühlten sich an, als würde ich alles durch einen grauen, diffusen Schleier sehen. Einerseits stand mein Kopf nicht still. Bekommen alle Parkinson-Patienten dieses Zittern? Ist die Krankheit wirklich nicht heilbar? Hatten meine Mutter und ich nicht sehen wollen, dass mein Vater sich veränderte? Andererseits war da so ein dumpfes Gefühl, eine nagende Vorahnung. Etwas, das man nicht greifen konnte, und doch war es da. Dass seine Krankheit eine langjährige Pflege mit sich bringen sollte, war mir nicht bewusst. Das scheint vielen nahestehenden Personen bei einer schweren, überraschenden Diagnose so zu gehen. Sosehr man sich auch sträubt, es gibt einen Unterschied zwischen üblichen Alterserscheinungen und dauerhaften Einschränkungen, die Pflege nach sich ziehen.
Lange Zeit war ich hin- und hergerissen zwischen dem Drang, jede Behandlungsmöglichkeit zu durchleuchten, und dem Bedürfnis, darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Es siegte die erste Variante, denn Aktionismus war immer schon meine bewährte Überlebensstrategie, im Beruf oder im Privaten. Irgendwas musste man doch tun können, um diese teuflische Krankheit aufzuhalten und meinem Vater seine Beweglichkeit und damit seine Freiheit zu bewahren. Nach dem Motto »Viel hilft viel« (von wegen!) las ich jede Parkinson-Studie, abonnierte Parkinson-Newsletter und las in Internetforen still mit, in denen sich Betroffene und Angehörige über Krankheitsverläufe, mutmaßliche Heilmittel oder Therapien austauschten.
Anfang der 2000er-Jahre war die klinische Forschung längst noch nicht so weit fortgeschritten wie heute. Was ich lernte, war, dass Morbus Parkinson (so der offizielle Name) eine neurodegenerative Erkrankung war, bei der sich Alpha-Synuclein-Proteine im Gehirn aggregieren und verklumpen, was zum Absterben von Nervenzellen, besonders häufig von Dopamin herstellenden Neuronen, führt. Diese Nervenzellen sind im menschlichen Körper für die Produktion von Dopamin verantwortlich, einem Neurotransmitter, der Bewegungen und andere wichtige Funktionen steuert. Derzeit sind rund 400000 Deutsche von Parkinson betroffen. Die Ursachen, die für das Ausbrechen der Krankheit verantwortlich sind, versucht man immer noch zu identifizieren. Bislang weiß die Forschung: In 15 Prozent aller Fälle sind genetische Veränderungen als Auslöser bekannt, bei 85 Prozent tritt die Krankheit ohne solche auf. Besonders Männer, so erfuhr ich, seien betroffen, und sechzig ein typisches Alter, in dem die ersten Symptome zutage treten.
Wir waren uns nicht sicher, ob mein Großvater Karl, der Vater meines Vaters, der gelegentlich bei uns im Sessel wegnickte, an einer Form von Altersparkinson litt. Leider konnte man nicht einfach wie bei anderen Krankheiten Blut mit einem kleinen Röhrchen abnehmen und anhand der biologischen Marker dann sagen: hopp oder top.
Nach und nach beobachtete ich an meinem Vater typische Symptome, von denen ich gelesen hatte, wie Muskelsteifheit (das konnte man gut sehen, denn er schlenkerte beim Gehen plötzlich nicht mehr mit den Armen) oder sein zögerlicher, leicht nach vorn gebeugter Gang mit kurzen, kleinen Schritten. Der Verlust des Geruchssinns und ein Zittern, Tremor genannt, blieben ihm zum Glück erspart. Da meine Eltern von jeher viel und ausdauernd Sport trieben, keiner von beiden rauchte oder übermäßig viel Alkohol trank, war die Konstitution meines Vaters ansonsten gut.
Wie und welche Alterungs- und Abbauprozesse bei dieser Krankheit beteiligt sind, war noch ungeklärt, auch, ob Umweltfaktoren wie Pestizide aus der Landwirtschaft und Industriechemikalien eine Rolle spielten. Auf dem Golfplatz, auf dem meine Eltern seit den Siebzigerjahren jedes Wochenende verbrachten, wurde viel mit Düngern und Unkrautvernichtungsmitteln gearbeitet, um die grünen Fairways für die Golfrunden unkrautfrei zu halten. Meine Mutter war überzeugt, dass die vielen Tage, die mein Vater auf den gedüngten Fairways verbrachte, Mitauslöser sein konnten. Ob das nun einen Einfluss gehabt hatte oder nicht, mir zeigte es, wie sehr die Wissenschaft noch im Nebel stocherte. Sie warf mehr Fragen auf, als sie löste. Und gerade in Deutschland erhielt die Krankheit, trotz einer starken Zunahme an Fallzahlen, zu wenig finanzielle Unterstützung für Forschungsprojekte. Die Erkenntnis war bitter: Mein Vater und wir waren als seine Familie weitestgehend auf uns alleine gestellt.
Unser Umgang mit Krisen
In vielen Fällen kommt die Krise ohne Vorwarnung, wie ein kräftiger Hagelschauer im Sommer. So auch bei uns. Durch einen Sturz, einen Knochenbruch, eine schwere Krankheit oder einen drastischen gesundheitlichen Abbau. Dann können wir plötzlich nicht mehr wegsehen und müssen uns eingestehen: Wir sind gefordert, uns neben unserem eigenen um ein zweites Leben zu kümmern.
Sven, ein Bekannter aus dem Rheinland, der als selbstständiger Zauberkünstler mit Mitte fünfzig auf Kreuzfahrtschiffen und großen Events auftritt, erzählt mir auf einer Geburtstagsfeier von Freunden von dem schnellen gesundheitlichen Verfall seiner vierundachtzigjährigen Mutter. Nach einem chirurgischen Eingriff in einer Düsseldorfer Klinik, leider nicht der erste, war die alte Dame stark geschwächt. Sven traf die Nachricht, dass seine Mutter vorzeitig entlassen werden sollte, da die Klinik ihr Bett benötigte, völlig unvorbereitet – während einer beruflichen Schiffsreise im Mittelmeer. Panisch fragte er sich, wo seine Mutter in der Zwischenzeit bleiben könnte. So schnell er vermochte, flog er nach Hause, und mit viel Verhandlungsgeschick durfte sie einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Trotz der Telefonate mit dem Sozialdienst traf ihn der Zustand seiner Mutter völlig unvorbereitet.
»Sie konnte weder stehen noch sich allein bewegen. Die Entlassungspapiere bescheinigten dagegen einen ›guten Allgemeinzustand‹. Unfassbar, oder?«, erzählt er.
Ich nicke und trinke einen Schluck Apfelschorle.
Sven schüttelt entrüstet den Kopf: »Zu Hause alleine wohnen, völlig unmöglich! Was denken die sich eigentlich?«
Für die Erkenntnis, dass er sofort handeln musste, blieb ihm wenig Zeit: Grundpflege, Kochen, Umsetzen in den Toilettenstuhl, Betreuung organisieren. Alles alleine, da so schnell kein mobiler Pflegedienst zu organisieren war. An einen Hausnotrufdienst, den seine Mutter mittels Rufknopf in dem Moment, in dem sie Hilfe benötigt hätte, hätte verständigen können, dachte er nicht.
»Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn deine Mutter stundenlang alleine auf dem Sofa zubringen muss, ohne auf die Toilette gehen zu können, wenn ich nicht da bin?«
Ehrlicherweise konnte ich das nicht. Noch nicht. Ausgeliefert zu sein in einer Situation, in der man sich nicht selbst helfen kann, muss schlimm sein. Bis auf einen kurzen Krankenhausaufenthalt vermochte sich mein Vater immerhin noch selbstständig zu bewegen, wenn auch langsam. Und mein Vater, anders als Svens Mutter, lebte nicht alleine. Aber bei diesem Gespräch ahne ich, was uns noch bevorstehen konnte.
»Wie kann es sein, dass das Krankenhaus dich nicht rechtzeitig vorgewarnt hat?«, hake ich nach. »Wäre das nicht Aufgabe des Sozialen Dienstes, den es ja in jeder Klinik gibt, gemeinsam mit den Angehörigen eine gute Anschlusslösung zu finden?«
Sven seufzt. »Bei der Entlassung hat eine junge Ärztin nur kurz die Papiere für meine Mutter unterzeichnet, mir diese mit den Rezepten für die dringenden Medikamente in die Hand gedrückt – und weg war sie. Nur der Krankentransport nach Hause wurde von dort organisiert. Wenigstens das.«
Mit Glück fand Sven ein paar Tage später einen mobilen Pflegedienst, der die Seniorin zweimal täglich besuchte, während er tagsüber arbeitete, nun aber nicht mehr auf einem Schiff. Ein Einzelschicksal? Nein. Aber eines, das zeigt, wie dringend Lösungen gefunden werden müssen, wenn Pflege von einem Tag auf den anderen notwendig wird.
Svens Mutter hatte wie meine Eltern frühzeitig eine Vorsorgevollmacht schriftlich aufgesetzt (wichtig: unterschreiben!), mittels der sie ihren Sohn als Bevollmächtigen eingesetzt hatte. So darf er im Ernstfall rechtliche, finanzielle und medizinische Entscheidungen treffen und bekommt von den Ärzten Auskunft über die medizinischen Fakten.
Für jeden Menschen, den ich bisher getroffen habe, ist die Diagnose »Pflegefall« ein Schock. Und in jedem löst sie andere Emotionen aus. Wie wir auf plötzliche dramatische Veränderungen in unserem Leben reagieren und wie wir sie bewältigen, hängt viel damit zusammen, wie wir gelernt haben, frühere Notsituationen zu meistern. Flucht, Erstarren oder Angriff – in extremen Ausnahmesituationen entscheidet unser Gehirn blitzschnell, was die beste Option ist, um heil aus der Sache zu kommen. Es sind genetisch verankerte Überlebensstrategien.
Welches Verständnis und welche Zuwendung wir also als Kinder erfahren haben, als wir Schmerzen empfanden oder Traurigkeit, beeinflusst, wie wir auf Krisen reagieren. Studien belegen, dass unsere Widerstandsfähigkeit wächst, wenn wir im Laufe unseres Lebens positive Erfahrungen beim Nehmen von Hürden machen. Kinder, die, als sie krank waren, in ihrem Schmerz ernst genommen wurden, sind als Erwachsene besser gewappnet, mit Ausnahmesituationen und gesundheitlichen Herausforderungen umzugehen. Erst jetzt, selbst durch meinen Vater betroffen, verstehe ich besser, dass sich viele in einer solchen Situation, in der jemand, den wir lieben, schwächer wird, überfordert und unvorbereitet fühlen.
Nachfragen bringt Licht ins Ungewisse
Nach der Erstdiagnose meines Vaters passierte erst einmal einige Jahre nichts Besonderes. Alle paar Monate ging er zu einem Check-up zu seinem niedergelassenen Neurologen und ließ sich einmal die Woche von Frau Behrendt, einer Physiotherapeutin, mit der er viel lachte, fünfundvierzig Minuten traktieren. Er nahm die ihm verordneten Tabletten, die den fehlenden Dopamin-Botenstoff im Gehirn ersetzen sollten, spielte weiterhin wöchentlich Tennis und Golf (Skifahren nicht mehr möglich) und produzierte Dekostoffe in Italien, die er an Handelsunternehmen vertrieb. Was war schon dabei, nicht mehr Ski zu laufen, ging doch noch vieles andere. Reisen, Ausflüge machen, nette Runden mit Freunden.
Währenddessen arbeitete ich für eine italienische Modefirma, in der ich als Marketingchefin inspirierende Menschen traf und spannende Projekte umsetzte. Ich verknallte mich in Tom, den kreativen Kopf einer Düsseldorfer Werbeagentur, der mir jede Nacht Musiktracks schickte. Sehr charmant und leider sehr vergeben. Meine Mutter und ich waren gut darin, die Gewitterwolken am Familienhimmel zu verdrängen. Tabletten und viel Bewegung würden es schon richten.
Bei keinem der Termine beim Neurologen war ich dabei, lebte ich damals doch im Rheinland, genauer gesagt in Düsseldorf, und irgendwie vergaßen meine Eltern bei den Arztgesprächen nachzufragen, ob es nicht mehr zu tun gab, als auf einer Gymnastikmatte zu turnen oder viermal am Tag Tabletten einzunehmen.
Irgendjemand im Bekanntenkreis erzählte meinen Eltern etwas von einem Gehirnschrittmacher, der, im Kopf implementiert, Impulse an das Gehirn senden könnte, um die fehlenden Nervenreize zu stimulieren. Es gab nur Einzelberichte darüber, und die Vorstellung eines solchen Geräts machte nicht nur mir ein mulmiges Gefühl. Sah ich meine Eltern, die ich ungefähr alle sechs bis acht Wochen besuchte, fiel mir auf, dass mein Vater schneller müde wurde und weniger Gesichtsmimik hatte, sonst aber war er mein Dad. Nur zwischen den Zeilen fing ich kleine Wortfetzen meiner Mutter auf. Papa rudert nachts so mit den Armen. Mein Vater langte im Schlaf regelmäßig mit den Armen quer über den Körper meiner Mutter, was weniger ein nächtlicher Liebesbeweis war, sondern als eine Verhaltensstörung in der REM-Phase seines Schlafs gewertet werden konnte. Papa hat Probleme mit der Verdauung. Wer will das von seinen Eltern schon hören?
Ich erinnere mich an ein Wochenende, bei dem ich in meinem alten Kinderzimmer im ersten Obergeschoss schlief. Wie häufig hatte ich meine Zahnpasta vergessen und lief morgens um sieben, leise, um meine Eltern nicht zu wecken, zu ihrem Schlafzimmer, um mir im dahinterliegenden Bad eine neue Tube zu nehmen. Ich drückte die Klinke herunter – und die Tür war verschlossen. Verschlossen? Noch immer verwundert ging ich nach unten in die Küche und fing an, das Frühstück vorzubereiten.
Als meine Mutter im Frotteemantel in die Küche kam, fragte ich: »Sag mal, warum ist denn eure Schlafzimmertür abgeschlossen?«
»Papa hat heute Nacht schlecht geträumt und Tiere an der Wand gesehen.«
Es blieb bei dieser einen Episode. Die Dopamin-Ersatzmedikamente konnten aufgrund ihrer starken Dosierung, wie wir später im Beipackzettel lasen, Halluzinationen hervorrufen. Was mein Vater alles in Kauf nahm, um »normal« zu funktionieren, wurde mir da erst klar.
Beim Recherchieren fand ich heraus, dass sich am Donnerstagnachmittag eine wöchentliche Angehörigengruppe zum Austausch mit anderen Parkinson-Betroffenen in einer Klinik in der Stadt traf.
»Wäre das nicht etwas für dich?«, fragte ich nicht nur einmal meine Mutter bei einem unserer Telefonate.
»Ich weiß nicht« lautete ihre Antwort. Begeisterung klang anders.
Andererseits: Ich wehrte mich auch gegen ihre wohlgemeinten Empfehlungen, wenn sie mir gerade nicht ins Konzept passten. Doch ich ging davon aus, es könnte ihr guttun, sich mit Personen auszutauschen, die auch Partner oder Familienmitglieder haben, die an Morbus Parkinson erkrankt waren. Schließlich raffte sie sich doch dazu auf, an einem solchen Treffen teilzunehmen.
»Wie war’s?«, wollte ich danach wissen.
»Die Runde war ganz gut, wir saßen bei Kaffee zusammen. Doch es gibt wirklich schwere Parkinson-Verläufe.« Es folgte ein kleiner Seufzer, und sie kam zum Kern: »Aber eigentlich möchte ich das nicht hören. Und schon gar nicht sehen.«
Damit war die Sache erledigt. Ich konnte verstehen, dass sie – gefangen mit ihrem Ehemann in dieser Endschlossschleife mit ungewissem Ausgang – mit diesem »Elend« (wie mein Vater es halb spielerisch, halb ernst nannte), das noch eintreffen konnte, nicht konfrontiert werden wollte. Wer konnte es ihr verdenken, ich gewiss nicht.
Mich beschäftigte die Frage, in welchen Schüben sich seine Gesundheit verschlechtern würde. Wie lange wird er noch Sport treiben, noch reisen, noch aufrecht gehen können? So viel seiner Lebensfreude hing von einem aktiven, einem sozialen Leben gemeinsam mit meiner Mutter ab. Kein Arzt erzählte uns in den ersten zehn Jahren nach der Diagnose etwas zu dem Verlauf oder zu neuen Behandlungstherapien jenseits der täglichen Medikamente und der Physiotherapie. Und irgendwie fragte keiner von uns dreien nach, da sich mein Vater noch wacker schlug – ob aus Respekt vor der ärztlichen Kompetenz in Weiß oder aus Naivität, keine Ahnung. Ich vermute, wir vertrauten einfach dieser Institution Arzt und dem, wofür sie stand. Lange Ausbildung, Wissen, Kompetenz.
Denke ich heute darüber nach, versuche ich besser zu verstehen, was uns abhielt. Im Nachhinein betrachtet macht es mich sprachlos, wie wenig Aufklärung, konkrete Handlungsempfehlungen oder Hintergrundwissen wir von den behandelnden Ärzten an die Hand bekamen und wie wenig wir selbst das Steuer übernahmen. Wir glaubten den Ärzten und stellten die ausgesprochenen Empfehlungen lange nicht infrage. Auch das Wort »Pflege« fiel in diesem ersten Jahrzehnt nie. Weder kam es uns in den Sinn, noch sagte ein behandelnder Mediziner zu meiner Mutter: »Achtung, Ihr Mann wird bald ein Pflegefall!« Niemand nützt Panikmache, aber ich glaube daran, dass es Sinn macht, mit offenem Visier durchs Leben zu gehen und gewissen, unabwendbaren Dingen mutig in die Augen zu sehen.
Da Parkinson noch nicht gut erforscht war, stützten wir uns auf private Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis – jemand nannte uns den Namen eines renommierten, auf Parkinson spezialisierten Neurologen (damals definitiv nur Männer). Wie sehr hätte ich mir damals gewünscht, dass jemand von den behandelnden Ärzten uns eine Liste mit auf Parkinson spezialisierten Kliniken und Reha-Einrichtungen in die Hand gedrückt hätte. Oder hätten sie gesagt: Ihr Vater und Sie als Familie haben ein gesetzliches Recht auf Beratung durch einen Berater der Pflegekasse. So waren wir auf uns und auf unser privates Netzwerk angewiesen.
Was Sie aus meiner Erfahrung mitnehmen können:
Es ist wichtig, sich gemeinsam mit Ärzten und Betreuern offen und ehrlich darüber auszutauschen, wie sich die Bedürfnisse der betroffenen Person ändern – sei es körperlich, seelisch oder kognitiv –, um gute Lösungen zu finden.
Ärzte, medizinische Fachabteilungen und Krankenkassen sind je nach Schwerpunkt kompetente Ansprechpartner für Fragen zum Gesundheitszustand, Behandlungstherapien und Leistungen (wenn die pflegebedürftige Person einer Herausgabe der Informationen an Familienmitglieder zugestimmt hat). Insbesondere Fach- und Hausärzte können ein Bild skizzieren, vor welchen Herausforderungen unsere Liebsten stehen, was uns hilft, diese besser zu verstehen. Auch wenn vollständige Transparenz über alle medizinischen Fakten, Krankheitsverläufe und Therapien eine Illusion ist.
Zudem empfiehlt es sich, eine Liste an Fragen über Hintergründe und mögliche Verläufe einer Erkrankung bis zu empfohlenen Maßnahmen, die die Lebensqualität und die Selbstständigkeit der betroffenen Person verbessern können, vor dem nächsten Arzttermin zusammenzustellen und diese anzusprechen.
Es ist hilfreich, sich einen konkreten Plan für die anstehenden Organisationsaufgaben und Termine zu machen, bei denen wir als Bezugspersonen die pflegebedürftige Person unterstützen wollen: Welche Aufgaben und Termine stehen an, von regelmäßigen medizinischen Check-ups, Behandlungsroutinen, Nachbestellen von Medikamenten und Hilfsmitteln bis hin zu Überweisungen und Anträgen.
Gefühle wie Scham, Überforderung und Ohnmacht sowie der Wunsch, wegzuschauen, sind menschlich, wenn ein geliebter Mensch Fürsorge und Pflege benötigt. Reagieren Sie mit Verständnis für sich selbst und den anderen, bevor Sie die nächsten Schritte angehen.
Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Pflegeleitfaden.
2Die Fassade bekommt Risse
In den 2010er-Jahren
Kleine Stürze, großes Schweigen
Aus dem Nichts kommt eines Tages der Anruf meiner Mutter. Ich sitze in meinem Büro in Düsseldorf und arbeite an einer PowerPoint-Präsentation für eine Kundenschulungsreihe.
»Papa ist gestürzt. Auf der Treppe hatte er eine Stufe übersehen.«
Natürlich gibt es im Haus meiner Eltern, gebaut in den Achtzigerjahren, Treppen und insgesamt viel Wert auf Optik und wenig Funktionalität.
»Ist es schlimm? Wie geht es ihm?« Ich versuche, die Sorge nicht übermäßig mitschwingen zu lassen, auch wenn ich beunruhigt bin.





























