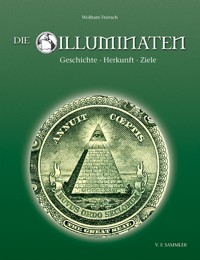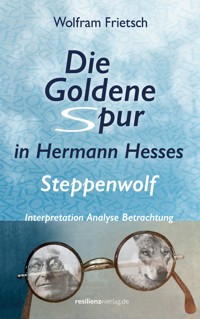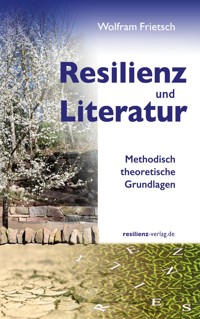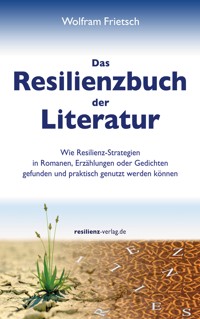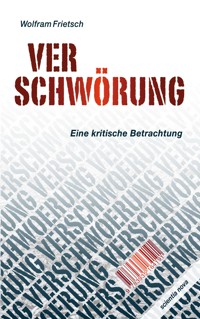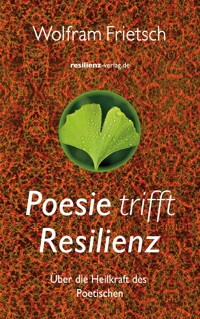
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: resilienz-verlag.de
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Alltag ist Prosa. Der besondere Moment im Alltag ist Poesie. Poesie wirkt wie ein Gespräch unter guten Freunden und wie Trost für die Seele. Deshalb kann von der heilenden Kraft des Poetischen gesprochen werden. Alle Literatur entspringt der Lebenswelt. Somit basiert jeder Text und jedes Gedicht auf Lebenserfahrung, die lesbar ist. Das Lesen erfolgt hier mit dem Schlüssel der Resilienz. Resilienz ist Widerstandskraft und Strategie in schwierigen Lebenssituationen. Dieses Buch ist kein Ratgeber, sondern ein Buch über gelebte Resilienz-Erfahrungen, die dazu beitragen, sich in der Welt wieder geborgen zu wissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Ginkgo
Gedichte . Lyrik . Poesie
Gedicht und Poesie
Brücken bauen
Aufbau des Buches
Reise in das Seelenland
Wie hängen Poesie und Resilienz zusammen?
Interpretatorische Ansätze
Resilienz und der Andere
Wolle die Wandlung
Poesie trifft auf Resilienz
1. Zuversicht
Böse und Gut
Trost und Hilfe
..
Resilienz der Zuversicht
..
2. Selbstbestimmung
Vergänglichkeit und Leben
Prometheus
Selbstbestimmung
Resilienz der Selbstbestimmung
3. Gestaltung
Gestaltung und Resilienz
Begriff und Wirklichkeit
Gesundung durch Abschied
Resilienz der Gestaltung
4. Spiritualität
Nicht getrennt sein
Im Ganzen sein
Resilienz der Spiritualität
5. Angst überwinden
Überwindung durch Treu und Redlichkeit
Jahrmarkt der Eitelkeit
Angst vor dem Beherrschenden
Resilienz der Vermeidung
6. Miteinander
Geborgenheit aus der Natur
Zeitloser Ort
Resilienz des Miteinander
Ein Plädoyer für die Dichtkunst
Abschließendes zu Poesie und Resilienz
Was ein Gedicht ist
Wegdichten
Überforderung des Lesers
Noch ein Wort
Woraus ein Gedicht besteht
Resilienz ist mehr als ein Begriff
Tabelle der Resilienzfaktoren
Resilienzfaktoren aus der Forschung
Nachwort
Literaturliste
Poesie trifft Resilienz
Über die Heilkraft des Poetischen
Was morgen ist,
auch wenn es Sorge ist,
ich sage: Ja!
Wolfgang Borchert, GW, 389
Ginkgo
Ginkgo biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt,
Sind es zwey die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt.
Solche Frage zu erwiedern
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern
Daß ich Eins und doppelt bin.1
Die Zweiheit ist eine grundlegende Konstante der Welt. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Alles ist von Zweiheit durchdrungen. Doch was ist das Eine? Es ist der Untergrund der Zweiheit. Die Dualität, wie sie sich im Ginkgo-Blatt manifestiert, kann sich nur aufgrund der Einheit des Blattes als eine Zweiheit zeigen. Das Duale und das Eine sind nur scheinbar getrennt. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung.
Johann Wolfgang von Goethe findet die Zweiheit in einem Ginkgo2-Blatt: „Ist es Ein lebendig Wesen / Das sich in sich selbst getrennt“. Das Ginkgoblatt ist in zwei Bereiche geteilt, die als Dualität aufgefasst aber als Einheit wahrgenommen werden.
Das Blatt wird für Goethe zu einem Spiegel seiner selbst: „Fühlst du nicht [.. . ] Dass ich Eins und doppelt bin?“ Er spricht hier von einem Gefühl, nicht vom Denken oder Erkennen. Es ist ein Gefühl, dass die Gegensätze der Welt im Grunde eins sind. Siegfried Unseld schreibt über das Gedicht:
Das Gedicht, in drei Strophen zu jeweils vier Versen in vierhebigen Trochäen, thematisiert den Auftrag des Schriftstellers. Die erste Strophe fragt nach dem „geheimen Sinn“ dieses „Baum’s Blatt“, eine auffallende, deiktische Alliteration. Die zweite Strophe formuliert das Paradox von Einheit und Zweiheit als Rätsel. In der dritten Strophe dann – als Antwort auf den „geheimen Sinn“ – der „rechte Sinn“, die Auflösung des Rätsels.3
Goethe, der sich als Kollektivwesen bezeichnet – „Mein Werk ist das eines Kollektivwesens, und es trägt den Namen Goethe“4 –, spricht von Einheit und Dualität. Wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau ausgeklammert bleibt und die Frage nach der Zweiheit des Menschen und seiner Sehnsucht nach dem Einssein gestellt wird, verweist dieses Gedicht auf die Sehnsucht nach Einheit.
* * *
Poesie ist das Intimste, das es in der Literatur gibt. Dichter füllen keine Säle oder Hallen. Ein Gedicht ist ein Zwiegespräch, deshalb passen Gedichte auch nicht in ein neoliberales Weltsystem, das Effizienz über Menschlichkeit, Profit über Nachhaltigkeit und Effektivität über Spiel stellt. Fortschritt ist das Zauberwort, das seit Jahrhunderten Wirtschaft, Politik und Kultur vorantreibt.
Zählt in der Buchbranche wirklich die Qualität der Bücher oder geht es eher um Verkaufszahlen? Ist ein guter Film nicht der, der von Millionen Menschen weltweit gesehen wird? Das handwerkliche Können von Indiana Jones ist unbestritten, aber was bleibt außer der reinen Unterhaltung in uns zurück? Übertrifft die immer komplexer werdende Geschichte der Star Wars-Filme die inhaltliche Sprengkraft und die damit einhergehende Individuationsthematik der ersten drei Filme, als Luke Skywalker und die Seinen erkannten, dass Kampf nicht die Lösung sein kann?
Ist eine Serie wie Ein Herz und eine Seele, die in den 1970erJahren live vor Publikum gespielt wurde und mit ihren provokanten Dialogen auch heute noch für Irritation oder zumindest Kopfschütteln sorgt, nicht wesentlich höher zu bewerten als Friends oder Big Bang Theory, deren Lacher auf den Punkt genau eingespielt sind und deren Dialoge von einem Autorenteam sorgfältig so komponiert werden, dass sie „wirken“ müssen?
Die Diskussion um Künstliche Intelligenz führt noch weiter weg vom Gedanken der Poesie, denn ein Gedicht ist und bleibt immer etwas Einzigartiges. Würden wir die Gedichte von Hölderlin, Rilke, Celan, Heine oder Goethe quantitativ addieren, kämen wir nicht einmal in die Nähe des wortgewaltigen Oeuvres der Thomas-Mann-Romane. Aber Quantität schlägt nicht Qualität. Beides, das erzählerische Romanwerk und die lyrische Verknappung, können nebeneinander bestehen. Das ist entscheidend, dass Lyrik, Poesie oder Gedicht gleichberechtigt neben Roman, Drama und Erzählung existieren können.
Im Grunde ist uns die Welt fremd geworden. Zwar war sie das schon immer, aber heute können wir benennen, was uns fremd geworden ist. Als fremd gilt, was nicht mehr zweckmäßig sein wird und sinnvoll ist das, was uns durch die nächste Zeitenwende führt. Gleichzeitig fühlen wir uns gedrängt, uns von einem Konzept zu verabschieden, das mit Schlagworten wie Kosten-Nutzen-Optimierung, Gewinnmaximierung oder auch Effektivität und Fortschritt umschrieben wird, heute aber nur noch als Ignoranz gegenüber der Biosphäre gelten muss. Die Poesie hingegen erlaubt uns, den Moment immer wieder neu zu entdecken, was eigentlich ein Merkmal von Nachhaltigkeit darstellt. Der Fortschritt führt an solchen Momenten geradewegs vorbei.
Wenn Resilienz als Widerstandsfähigkeit definiert wird, dann bedeutet das, in eine Welt eingebettet zu sein, die uns umgibt und die alles enthält, was ist: Mensch und Tier, Natur und Kosmos, Ungeziefer und Bakterien. Optimistisch formuliert es der Bestsellerautor Jeremy Rifkin in seinem 2022 erschienenen Buch Das Zeitalter der Resilienz. Leben neu denken auf einer wilden Erde. Er schreibt:
Das Zeitalter des Fortschritts ist zu Ende und das Zeitalter der Resilienz bricht an. Alles, was wir zu wissen meinten, was wir glaubten und auf das wir uns verlassen haben, gilt nicht mehr. Wir stehen am Beginn einer neuen Reise, auf der wir neu über unsere Spezies und ihren Platz auf der Erde nachdenken müssen und die Natur unsere Schule ist. Der Übergang vom Zeitalter des Fortschritts zum Zeitalter der Resilienz bewirkt schon heute ein philosophisches und psychologisches Umdenken und einen Einstellungswandel. Es handelt sich um einen Umbruch, der die vollständige Neuausrichtung unserer Verortung in Raum und Zeit verlangt. (Rifkin, 11)
Rifkin erteilt der „Effizienz“ eine deutliche Absage. Effizienz stürzt uns in den „Ruin“, zerstört Gesellschaft, Miteinander und Umwelt oder Mitwelt. „Immer höher, immer weiter“ kann nicht der Ruf der neuen Zeit sein. Eher sind die leisen Töne gefragt, die Gedanken über die Dinge, das Zwischenmenschliche oder das Ungewöhnliche, das Einfache, das Vertraute, das neu gedacht und neu erfahren werden muss. Dazu Rifkin:
Wenn im Zeitalter des Fortschritts die Effizienz den Takt vorgab, dann ist es im Zeitalter der Resilienz die Anpassungsfähigkeit. Die Umorientierung von der Effizienz zur Anpassungsfähigkeit ist die Voraussetzung, um unsere Entfremdung von der Erde zu überwinden und uns in die Vielzahl der irdischen Akteure einzugliedern – eine Neuorientierung menschlichen Handelns auf einem zunehmend unberechenbaren Planeten. [...] Der Übergang von der Effizienz zur Anpassungsfähigkeit geht mit umfassenden Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft einher, etwa der Verschiebung von Produktivität zu Erneuerbarkeit, von Wachstum zu Wohlstand, von Eigentum zu Zugang, von Märkten mit Käufern und Verkäufern zu Netzwerken mit Anbietern und Nutzern, von linearen Prozessen zu kybernetischen Prozessen, von vertikaler zu lateraler Integration, von zentralisierten zu dezentralen Wertschöpfungsketten, von Unternehmenskonglomeraten zu agilen, hoch technisierten kleinen und mittelgroßen Genossenschaften, verlinkt in variablen Gemeingütern, von geistigem Eigentum zu Open Source, von Nullsummenspielen zu Netzwerkeffekten, von der Globalisierung zur Glokalisierung, vom Konsumismus zu Ökosystemdienstleistungen, vom Bruttoinlandsprodukt zu Indikatoren der Lebensqualität, von negativen externen Effekten zur Kreislaufwirtschaft, von der Geopolitik zur Biosphärenpolitik. (Rifkin, 12)
Kapital wird zu „ökologischem Kapital“, der uns umgebende Raum wird nicht mehr ausgebeutet, sondern einfühlend genutzt. Nicht mehr (m)ich allein zählt, sondern wir alle sind Prozesse aus allem, was ist. Niemand ist eine Insel, niemand ist allein: „Wir sind buchstäblich Teil des Planeten, und diese Tatsache sprengt die lieb gewonnene Vorstellung vom Menschen, der sich über die Natur erhebt“ (Rifkin, 14).
War es ein umwälzender Paradigmenwechsel, als das geozentrische Weltbild vom heliozentrischen Weltbild abgelöst wurde, so suchen wir heute nach einem Leben, das auch das heliozentrische Weltbild ablösen kann. Wir sind nicht mehr von unserem Universum oder unserer Milchstraße umgeben, sondern von Myriaden von Welten. Ist die Suche nach Außerirdischen nicht die stille Hoffnung auf eine Bestätigung, das dunkle, kalte Universum auch außerhalb der menschlichen Sphäre mit Leben erfüllt zu wissen? Aliens als Projektion der inneren Hoffnung auf eine vernetzte und verbundene Welt, deren Zentrum aber was ist?
Die Sehnsucht nach Zusammenhang, drückt sich als Hoffnung aus. Gedichte sind Momente dieser Hoffnung.
Gedichte stellen einen Zusammenhang zwischen der Welt und dem Menschen her. Ihre Zeitlosigkeit und stille Wirkkraft machen sie zu einem idealen Vertreter der Resilienz. Gerade an und in der Poesie erfahren wir die Welt und ihr tiefes Geheimnis neu. Es sind Verse, die die Menschen seit Jahrhunderten auf ihrem Weg begleiten. Sie vermitteln den Eindruck, ahnungsvoll etwas von der Reise und dem Ziel aufzeigen zu können, wohin uns das noch im Dunkeln liegende Leben zu führen vermag.
Poesie ist das Licht in der Dunkelheit, eine Stimme der Beharrlichkeit mit einer einzigen Botschaft.
1 „Gingo [sic] biloba“ aus: Westöstlicher Diwan, 1819, 1. aufl age.
2 Goethe verwendete auch die Schreibweise Gingo.
3 Siegfried unseld: Goethe und der Ginkgo. Ein Baum und ein Gedicht. Frankfurt 1998, 62.
4 Jeremy adler: Goethe. Die Erfindung der Moderne. Eine Biographie. München 2023, 152.
Gedichte . Lyrik . Poesie
Auf dem Tische Brot und Wein. Georg Trakl
Mein Großvater war keiner, dem Poesie in die Wiege gelegt worden war. Er hatte kein leichtes Leben, machte aber das Beste aus seinen Möglichkeiten. Früh wurde seine Familie auseinander gerissen und die Kinder auf Onkel und Tanten verteilt. Er wuchs bei einem Onkel auf und sah seine Geschwister erst nach Jahren wieder. Manche ihrer Namen hatte er sogar vergessen. Mein Opa erlebte den Ersten und Zweiten Weltkrieg, war Aushilfsbriefträger, machte eine Lehre und heiratete. Gemeinsam mit meiner Oma wurde ein Geschäft aufgebaut, das Jahrzehnte bestand. Er erlebte den Zusammenbruch mehrerer Währungssysteme, den Niedergang des Kaiserreiches, die Wirren der Weimarer Republik, die NS-Diktatur und die Entwicklung Deutschlands zur Demokratie. Er besaß religiöse Bücher, ob er sie gelesen hat, weiß ich nicht; er war ein geschickter Handwerker, saß einige Jahre im Gemeinderat, gehörte örtlichen Vereinen an und lebte sein Leben als Vater von drei Töchtern und Großvater von drei Enkelkindern. Er war nüchtern und stur. Ein echter Schwarzwälder. Große Gefühlsregungen waren ihm fremd. Nach seinem Tod fand ich in einem seiner Briefe an meine Großmutter folgende Zeilen, die eine ganz andere Seite von ihm offenbaren:
Du bist mein, ich bin dein.
Dessen sollst du gewiss sein.
Du bist eingeschlossen
in meinem Herzen,
verloren ist das Schlüsselchen:
Du musst auch für immer darinnen bleiben.
Dû bist mîn, ih bin dîn.
a
des solt dû gewis sîn.
a
dû bist beslozzen
b
in mînem herzen,
b
verlorn ist das sluzzellîn:
a
dû muost ouch immêr darinne sîn.
a
Die Originalverse wurden 1180, also vor über tausend Jahren, verfasst. Es ist bis heute eines der bekanntesten Liebeslieder. Den Verfasser kennen wir nicht. Ob es sich tatsächlich um ein Liebesgedicht oder ein religiöses Gedicht handelt, kann nicht eindeutig entschieden werden. Es ist aber bemerkenswert, dass so wenige Zeilen so viele Jahrhunderte überdauert haben und die Menschen immer noch berühren.
Es ist möglich, dass mein Großvater mit diesen Zeilen, die er aus einem Schützengraben des Ersten Weltkriegs schrieb, das Herz meiner Großmutter erobert hat. Immerhin waren die beiden fast 40 Jahre lang verheiratet, bevor meine Oma starb. Mein Großvater überlebte sie um fast 20 Jahre. Geheiratet hat er nicht mehr.
Aber was macht dieses Gedicht zu einem so besonderen und die Zeit ignorierenden Gedicht?
Es berührt durch seine Einfachheit das Herz. Sehen wir näher hin. Es findet sich ein schlichtes Reimschema (aa bb aa) und nur eine Strophe. Das langgezogene und betonte „î“ lenkt eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich. Ansonsten sind keine besonderen Merkmale auszumachen außer einer rhythmisierten Grundmelodik, in der sich Jambus und Daktylus abwechseln. Wird das Metrum mitbetrachtet, dann zeigt sich das Gedicht komplexer als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Es hat eine originelle Form, die mit dem eher simpel gehaltenen Inhalt kontrastiert.
Das angesprochene Reimschema kennt man von Büttenreden oder launigen Versvorträgen. Bekannt ist es beispielsweise aus Goethes Faust:
Da steh ich nun, ich armer Tor!
a
Und bin so klug als wie zuvor;
a
Heiße Magister, heiße Doktor gar
b
Und ziehe schon an die zehen Jahr
b
Herauf, herab und quer und krumm
c
Meine Schüler an der Nase herum
c
Genau so stellt man sich ein Gedicht vor und versucht dies nachzuahmen, beispielsweise für einen Geburtstagsspruch:
Wir wünschen dir, noch viele Jahr
und dass du kommst mit uns gut klar.
Du bist ein Freund, den wir gern seh’n
sonst würden wir zu ’nem andern geh’n.
Zweierlei fällt auf. Zuerst der überaus simple Reim (Jahr / klar; seh’n / geh’n) und die Hilflosigkeit beim Versmaß (statt „gerne“ heißt es „gern“ und statt „einem anderen“ heißt es: „’nem andern“). Die Verse sind nicht das, was künstlerisch wertvoll genannt werden kann, aber sie erfüllen ihren Zweck.
Nur wenige von uns sind zum Dichter berufen. Alle anderen schreiben Gedichte, wenn überhaupt, nur zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit oder einem Geburtstag. Einfach sollen sie sein und unterhaltsam bis witzig; dennoch, es ist eine Aufgabe, die so manchen ins Schwitzen bringt. Das Wichtigste ist der Reim, heißt es. Gedichte müssen sich reimen. Das mag stimmen oder auch nicht, denn ein Gedicht ist weit mehr als Reim und Metrum, ein Gedicht ist Poesie.
Im Film Der Club der toten Dichter von 1989 lässt der Englischlehrer John Keating, gespielt vom legendären Robin Williams, seine Schüler sämtliche Seiten aus einem Lehrbuch herausreißen, die Anweisungen zum Verständnis eines Gedichts enthalten. Keating plädiert für die Unmittelbarkeit, Kraft, Schönheit und Macht von Versen. Es geht ihm um das persönliche Erleben und nicht um das Auswendiglernen von Stoff.
Im Film werden Gedichte von Walt Whitman, Henry David Thoreau oder Robert Frost zitiert. Keating, ganz in seinem Element als Anwalt der Poesie, lässt sich von seinen Schülern mit dem Vers O Captain! My Captain! ansprechen, ein Vers aus Walt Whitmans gleichnamigem Gedicht von 1865. Der Film stellt der konservativen Lehrmeinung eine revolutionäre Selbstbestimmung gegenüber. Oder um es mit Walt Whitmans Versen auszudrücken: „Du bist hier, damit das Leben blüht / und die Persönlichkeit [...]“
Gedicht und Poesie
Poesie ist eine kulturelle Errungenschaft, die sich von bloßer Meinungsäußerung unterscheidet. Wir sprechen nicht: „Oh Edler, reiche mir die Butter fein .. . “, sondern sagen: „Bitte gib mir die Butter.“
Wir sagen nicht: „Du freundlicher Geselle, wie du uns kutschierest in aller Schnelle zum nächsten Haus der weinseligen Freude, soll ein Geschenk für Gaumen und Herzen sein!“ Sondern wir instruieren den Taxifahrer, uns zur nächsten Kneipe zu fahren. Das klingt nicht nur prosaisch. Das ist es auch.
Der Alltag ist Prosa. Der besondere Moment im Alltag ist Poesie. Und doch ist es nicht ganz so einfach. Denn jeder von uns hört jeden Tag Gedichte und erfreut sich daran. Wir hören mehr Reime als Generationen früher, nehmen mehr Poesie in uns auf, als Menschen vor hundert Jahren und wir fühlen uns von Poesie getröstet, gestärkt, berührt, inspiriert oder herausgefordert. Die Rede ist von all den Liedern und Songs, die wir im Radio oder über eine Streaming-App empfangen. Jedes Lied ist ein Gedicht. Und manchmal ist ein Dichter auch Sänger oder Nobelpreisträger wie Robert Allen Zimmermann, besser bekannt als Bob Dylan.
Sobald wir bei Liedern mitsingen, werden wir zu Mit-Dichtern. Vielleicht verändern wir sogar einige Verse, damit sie unterhaltsamer klingen oder singen „alberne“ Schlager nach, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Wie sonst könnten Bierzeltmelodien („Oans, zwoa, gsuffa“) oder Ballermann-Hits („Hölle, Hölle, Hölle“) oder Songs wie „Atemlos“ überleben? Im Prinzip sind es Gedichte, über deren Qualität man gar nicht erst urteilen sollte. Gedichte begegnen uns jeden Tag, nicht nur zu bestimmten Anlässen. Sind Gedichte zu einem Teil unseres Lebens geworden? Auf jeden Fall! Sie sind nicht nur Teil davon, sondern begleiten uns als Ratgeber, Spaßmacher, Taktgeber, Helfer in der Not oder Inspiratoren. Es gibt auch Gedichte, die etwas Besonderes ausdrücken, sodass sie für uns eine wichtige Bedeutung bekommen. Nehmen wir an, wir haben als Kind vor dem Einschlafen gebetet: „Müde bin ich, geh’ zur Ruh’, Schließe meine Äuglein zu. Vater laß die Augen dein über meinem Bette sein. [...]“, dann hat das nicht nur unsere Kindheit geprägt, sondern gibt uns auch heute noch einen Moment an Geborgenheit zurück.
Außerdem hat jeder ein Gefühl dafür, ob ein Gedicht ihn anspricht oder nicht. Man muss mit dem Dichter nicht übereinstimmen. Ja, wir müssen überhaupt nichts von Reim, Versmaß oder Metrik verstehen. Allein die Aussage „das gefällt mir“ zeigt eine Verbindung, die man zwar benennen, aber nicht näher begründen kann. Ich weiß, dass es Zweckgedichte gibt, also solche für einen bestimmten Anlass. Ich weiß, dass es auch Gedichte gibt, die etwas ausdrücken, das nicht an eine Absicht gebunden ist, sondern mehrdeutig und vielschichtig wirkt. Sobald wir uns fragen, warum das so ist, werden wir von einem Virus befallen, der sich in einer unbestimmten Sehnsucht manifestiert. Wir müssen wissen, warum es uns berührt. Und wir können noch ein Schritt weiter gehen: wir müssen wissen, warum und wofür wir ein Gedicht verwenden können. Als Selbstzweck? Als Mittel für etwas anderes? Als Hilfestellung, um eine Lebenssituation, ein Gefühl, eine Sehnsucht oder eine Hoffnung auszudrücken? Wenn Letzteres der Fall ist, kann das Gedicht zum Ratgeber werden, ohne ein Ratgeber zu sein, denn ein Gedicht weiß nicht, welchen Rat es gibt. Es kennt weder unsere Befindlichkeit noch unsere Probleme.
Wir können also die „Schönheit“ der Worte genießen, ohne zu wissen, wie ein Gedicht aufgebaut ist. Was kümmert es uns, wie eine Halskette oder eine Krawatte hergestellt wurde? Wir kaufen sie, verschenken sie oder benutzen sie. Oder wir holen ein Schmuckstück immer wieder hervor und betrachten es, ohne sagen zu können, warum. Wir bewundern die Reinheit einer Perle oder den Schliff eines Diamanten oder wir sehen unsere alte Kinderzeichnung und sind nicht fasziniert davon, wie sie gemacht wurde, sondern von der Erinnerung, die sie festhält. Sie wurde vor „ewigen Zeiten“ von uns selbst angefertigt. Das ist berührend und bestimmt die Beziehung, die wir zum Bild haben. Dadurch, dass wir etwas, das für uns von Bedeutung ist, immer wieder betrachten, entsteht eine Verbindung, die uns spiegelt. Wir finden uns darin wieder. Marcel Proust schrieb einmal:
Ich würde nach „Originalausgaben“ suchen, das heißt nach denjenigen, aus denen ich von diesem Buch einen originalen Eindruck erhalten hatte, denn die folgenden Eindrücke sind das ja nicht mehr. Romane würde ich in Einbänden von ehemals sammeln, denjenigen aus der Zeit, in der ich meine ersten Romane las [...]
Proust interessiert sich nur für solche Erstausgaben, wie er sie einst zum ersten Mal in den Händen gehalten hatte, weil sie für ihn Bindungen, Gefühle und Emotionen speichern. Das kann ein Buch oder ein beliebiger Gegenstand der Kindheit sein. Es muss eine Bedeutung für ihn gehabt haben. Und die Struktur eines Gedichtes, sozusagen sein Bauplan, hat eine solche Bedeutung. Bei einem Computer nützt es wenig, die Bauanleitung zu studieren und seinen Schaltplan genau zu kennen, wenn ich mit dem Computer ein Bild bearbeiten oder einen Satz schreiben möchte. Ein Schaltplan hat zwar einen gewissen ästhetischen Reiz, aber für die Möglichkeit, das Gerät zu benutzen, ist das unerheblich. Wichtig für ein Gedicht sind die Form oder die rhetorischen Mittel. Deshalb möchte ich neben dem Inhalt und dem Gehalt darauf eingehen, was den funktionalen Aspekt eines Gedichtes ausmacht. Meine Hoffnung ist, dass ein Gedicht dann mehr geschätzt werden kann und eine tiefere Verbindung zur Kraft der Poesie entsteht.
Brücken bauen
Warum Poesie? Warum Gedichte? Warum Lyrik?5 Gedichte (Poesie) sind sprachlich und stilistisch prägnante Texte. Sie vermeiden lange Beschreibungen, sind formal gut durchdacht und äußerst präzise in ihrem Ausdruck. Gedichte mögen auf den ersten Blick an ein Poesiealbum erinnern, aber das sagt noch nichts darüber aus, was ein Gedicht ist. Gedichte sind Poesie. Als ein Aspekt des Poetischen verklären sie den Augenblick, indem sie etwas berühren. Der Augenblick wird zu Poesie. Poesie kann ein Mahl, eine Begegnung, eine Stimmung, ein Abend, ein besonderer Moment sein. Poesie kann aber auch aus Worten bestehen, in einem Text, der sich auf komprimierte Art und Weise mitteilt. Es geht um den poetischen Moment im Gedicht, der über das Gedicht hinausweist, weil er etwas mitteilt und das Gedicht zu etwas Besonderem wird, weil es sagt, was vorher nicht gehört wurde.
Ein Gedicht wird zur Poesie, wenn ich mich mit ihm anfreunde. Poesie wirkt wie ein Gespräch unter guten Freunden und wie ein Trost für die Seele. Deshalb kann man von der Heilkraft der Poesie sprechen, einer Kraft, die mich zu dem werden hilft, was ich bin oder sein soll.
Jedes Gedicht hat eine Form, einen Inhalt und eine Bedeutung. Es trägt zugleich Leben in sich, mit dem wir in Beziehung treten können. Das erlebende Lesen eines Gedichts ist ein subjektiver und allgemeiner Faktor. Es ermöglicht, die Besonderheit eines Gedichtes zu begreifen. Es gilt, die in den Gedichten ausgedrückten Gedanken zu verstehen und einen Prozess in Gang zu setzen, der sich als ein Erfahrungsfeld offenbart.
Aufbau des Buches
Das Potenzial dieser Arbeit liegt in einer literarischen, möglicherweise philosophischen Studie. Zusätzlich ließe sich ein psychologischer Aspekt von fachkundiger Seite ausarbeiten.
Mein Ansatz kommt aus der Literatur, genauer gesagt aus der Literaturwissenschaft. Ich sehe zahlreiche Entsprechungen meines Ansatzes mit der literaturwissenschaftlichen Forschung, jedoch ist Letztere bislang ohne die Berücksichtigung des Resilienz-Aspektes ausgekommen.
Der Anhang enthält Informationen zu Aufbau und Technik eines Gedichts sowie eine Übersicht über die Resilienzfaktoren. In der Wissenschaft sind elf Resilienzfaktoren von Bedeutung, die ich in diesem Zusammenhang auf sechs zusammengefasst habe.
Meiner Meinung nach kann der aufmerksame und interessierte Leser6 in der Auseinandersetzung mit Resilienz und Poesie oder Resilienz und Literatur eine geistige Heimat finden, die ihm die Möglichkeit bietet, Gedichte mit anderen Augen zu sehen und für sich und sein Leben neu zu entdecken. Ein durchaus sinnstiftendes Unterfangen.
5 Es ist hier nicht wichtig, zwischen Poesie, Gedicht oder Lyrik zu unterscheiden. Sie haben unterschiedliche Bedeutungen, aber eines ist ihnen gemeinsam: es handelt sich um Poesie, die wir von Prosa und Epik abgrenzen.
6 Nicht immer einfach ist es, sich an das zurecht betonte Gendering zu halten. Wo im Text das verwendete „wir“ auftaucht, meint es jeweils Lesende und autor.
Reise in das Seelenland
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. [...]
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse
Leben ist Kunst und alle Kunst ist Leben. Poesie ist Kunst und Leben. Aus dem Lebendigen entstanden, kann ihre Geschichte verworren oder unklar sein, so ist sie dennoch poetisch. Wie jeder Text ist jedes Leben lesbar. Dazu muss das Leben entziffert oder decodiert werden. Hier geschieht das unter dem Aspekt von Resilienz. Um einen Eindruck von der Bedeutung der Resilienz im Gedicht zu vermitteln, wird jedes Gedicht als Resilienzstrategie interpretiert. Dieses Buch ist kein Ratgeber, sondern ein Buch über gelebte und in Gedichten ausgeformte Resilienz-Erfahrungen.
Der Begriff Resilienz beinhaltet die Aufforderung, sich dem Leben zu stellen. Die Welt, wie sie ist, ist lebendig. Sich vor ihr zu verstecken, ist genauso unmöglich, wie aus ihr zu fliehen. Es gilt, sich der Welt und dem Leben zu stellen.
Jedes Menschenleben ist geprägt von Schicksalsschlägen, Disharmonien, inneren Konflikten, Defiziten, Störungen oder Krankheiten. Wir spüren sie an uns selbst oder erkennen, dass etwas nicht mehr stimmt wie es stimmen sollte. Die Suche nach Ursachen, führt uns nach innen. Was ist mit mir? Warum fühle ich mich so?