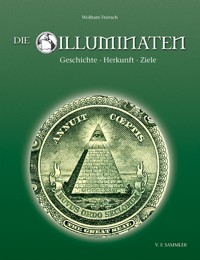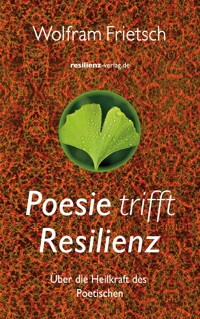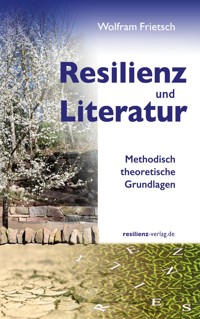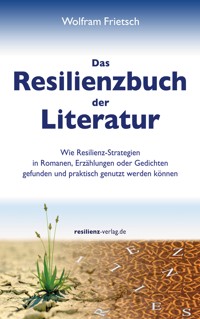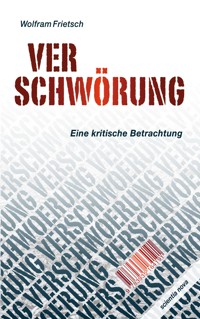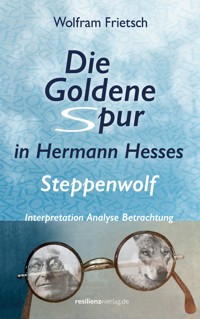
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: resilienz-verlag.de
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hermann Hesse beschreibt in seinem 1927 erschienenen Roman Der Steppenwolf die Midlife-Crisis des 50-jährigen Privatgelehrten Harry Haller. Erzählt wird die Geschichte seines Lebens zwischen bürgerlicher Existenz und Künstlertum, Verzweiflung, Leiden an sich selbst, Depressionen, Selbstmordgedanken, Selbsterkenntnis, Verliebtsein und Jazzmusik. Ein Buch für den interessierten Leser, für den Schulunterricht, für jemanden, der Hilfe bei der Lektüre sucht ... Aus dem Inhalt: Die Radiomusik des Lebens Hermann Hesse und die Entstehung des Steppenwolf Kommentar und ausführliche Inhaltsangabe Personen - Leitmotive - Dualismus Psychologische Behandlung Hesses bei Josef Bernhard Lang Der musikalische Bauplan des Romans Individuation und Selbstwerdung in Hesses Steppenwolf Aussagen zum Roman Psychologisch motivierte Deutung nach Carl Gustav Jung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert, drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.
Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte; wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau’s? Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte. Wehe –: abwesender Hammer holt aus!
Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung; und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.
Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.
Rainer Maria RilkeDie Sonette an Orpheus, Zweiter Teil
Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man. Auf, laßt uns den Geist der Schwere töten!
Friedrich NietzscheAlso sprach Zarathustra, „Vom Lesen und Schreiben“
Inhaltsverzeichnis
„Alle Deutungen sind Bergungen“
Einleitung
Inhaltsangabe
Die Radiomusik des Lebens
Eigensinn, Bürgertum, Künstler, Zeit
Lebensreform und Eigensinn
Die Goldenen Zwanziger
Radiomusik
Werk – Wirkung – Missverständnisse
Romantische Literaturtradition
Naivität und Bürgertum
Hesse bis heute
Hermann Hesse: 1877 bis 1962
Hermann Hesse und die Entstehung des Steppenwolf
Hesse und die Psychologie
Gnosis
C.G. Jung
Josef Bernhard Lang
Hesse in Basel und Zürich
Nach Erscheinen des Romans
Harry Haller, der andere Hermann Hesse
Halluzinogene Drogen
Leitmotive im Steppenwolf
Die Zeitlosigkeit des Steppenwolf
Kommentar und ausführliche Inhaltsangabe
Bauplan des Steppenwolf
Einleitung: Vorwort des Herausgebers (7–32)
Harry Hallers Aufzeichnungen (33–53)
Traktat (54–86)
Verzweiflung (87–111)
Hermine (111–203)
Maskenball (203–222)
Magisches Theater (222–278)
Personen – Leitmotive – Dualismus
Harry Haller
Zwei Seelen
Selbst-Mord
Der Roman als Spiegel
Steppenwolf
Unsterbliche
Hermine
Pablo
Anhang
Der musikalische Bauplan des Romans
Die Sonatenform
I. Satz: Bürger – Steppenwolf
Exposition
Durchführung
Reprise
II. Satz: „Hermine“
III. Satz: Magisches Theater
Nachtrag
Individuation und Selbstwerdung in Hesses Steppenwolf
Individuation Steppenwolf
Der Individuationsprozess
Persona
Schatten
Anima
Hermine
Selbst
Pablo
Unsterbliche
Magisches Theater
Chymische Hochzeit
Hieros gamos
Gegensatzpaare als Prinzipien des Romans
Aussagen zum Roman
Hermann Hesse zu seinem Steppenwolf
Zeitkritik
Selbstsuche
1968er-Generation
Nachwort
Literaturauswahl
Schreibutensilien vom Arbeitstisch in Montagnola (im Hermann-Hesse-Museum Calw)
„Alle Deutungen sind Bergungen!“
Gibt es nicht schon genügend Bücher zum Steppenwolf von Hermann Hesse? Warum dann noch dieses hier? Meine Antwort: … Eines Abends ging ich in dunkler Stimmung aus dem Haus und bekam eine Broschüre überreicht, die genau dieses Buch darstellen wird. Für den Abendspaziergang brauchte ich Jahre und für die Lektüre des Büchleins und die Übertragung in diese Welt ebenso lang. Nun entschloss ich mich, zu Hause, all das zu veröffentlichen, was ich erfahren hatte, auch in der Hoffnung, dass es hilfreich sein werde für andere …
In der Tat sind es altruistische Gründe, die die Herausgabe dieses Buches prägen; zum anderen scheint es an der Zeit, die Gedanken niederzuschreiben, die sich in mir im Laufe der Jahre zum Steppenwolf angesammelt haben. Damit kann ein wichtiges Kapitel meines Lebens abgeschlossen werden.
In einer Zeit, in der Gründe wichtiger scheinen als Handlungen, gelang es hier, die Gründe dagegen oder dafür wegzuschreiben und einfach das zu tun, was getan werden musste. Harry Haller hat das Lachen gelernt. Und er wird sich bemühen, das Spiel des Lebens besser zu spielen. Ich denke, dass dies gute Gründe sind. Damit wäre dann auch alles dazu gesagt.
(Eintrittsraum im Hermann-Hesse-Museum Calw)
Vorwort
Für den Schulunterricht, für den interessierten Leser, für jemanden, der Hilfe bei der Lektüre sucht.
Der Roman ist nicht einfach zu lesen oder leicht zu durchschauen. Sehr viele unterschiedliche Handlungs- und Bedeutungsstränge sind darin verwoben. Sie ergeben zwar auf den ersten Blick ein stimmiges Bild, das sich aber bei näherer Betrachtung als nicht ganz so stimmig herausstellt. Um Inhalt, Gehalt und Problematik des Romans besser darstellen zu können, habe ich folgendes Vorgehen gewählt: Zuerst wird der Inhalt des Romans geklärt. Dann gehe ich auf die Entstehung des Steppenwolf ein, die biografische Situation des Autors Hermann Hesse, den sozialen und historischen Kontext und jene Beweggründe Hesses, welche geprägt durch die psychologische Behandlung bei J.B. Lang, mit Auslöser für den Roman waren.
Eine von mir kommentierte wiedergebende Interpretation des Werkes schließt sich an. Darin werden Leitmotive, Beweggründe, Probleme, Fragen und Handlungsmuster aufgezeigt. Ich orientiere mich eng am Text im Sinne einer kritischen, teilweise werkimmanenten [sic] hermeneutischen Textanalyse. Es folgt im Anschluss daran die Charakteristik der handelnden Personen.
Im Anhang gehe ich auf die Frage ein, wie der musikalische Bauplan des Romans im Sinne der Sonatenform gedeutet bzw. entschlüsselt werden könnte. Diese von Hesse gemachte Bemerkung bereitet Probleme und sollte nicht unreflektiert schlagwortartig übernommen werden. So einfach ist es nicht, den Roman lapidar als Sonate zu bezeichnen.
In einem weiteren Teil nehme ich eine – im Sinne C.G. Jungs – psychologisch motivierte Deutung der „Tötung“ Hermines vor. Hier bediene ich mich einer komplexen Symboldeutung. Sie zeigt auch, dass sich aus einfachen und scheinbar klaren Aussagen komplexe psychologische Wahrheiten bergen lassen, die einer Zwiebel vergleichbar, Schicht um Schicht abgehoben werden können. Ein Ende ist ebenso wenig absehbar, wie eine letztgültige Deutung.
Alle Deutungen sind Bergungen von Gedanken, Meinungen, Aussagen ... Die Gefahr des Verlustes droht dabei ebenso wie das Risiko, dass etwas geborgen wird, was besser im Meer der Deutungsmöglichkeiten verblieben wäre. Das ist das Wagnis, das jeder eingeht, der Literatur über Literatur anfertigt.
Gaggenau, im August 2017
Schreibutensilien vom Arbeitstisch in Montagnola Hesses Schreibmaschine in Gaienhofen am Bodensee (heute im Hermann-Hesse-Museum Calw)
Inhaltsangabe
Der 1927 erschienene Roman Der Steppenwolf von Hermann Hesse behandelt die Midlife-Crisis des 50-jährigen Privatgelehrten Harry Haller. Erzählt wird dessen Geschichte eines Lebens zwischen bürgerlicher Existenz und Künstlertum, Verzweiflung, Leiden an sich selbst, Depressionen, Selbstmordgedanken, Selbsterkenntnis, Verliebtsein und Jazzmusik.
Der Roman besteht aus mehreren Teilen:
dem Vorwort des Herausgebers,
den Aufzeichnungen Harry Hallers und
dem „Tractat vom Steppenwolf“,
der ausführlichen Beschreibung der Begegnung Hallers mit Hermine, seiner „Seelenverwandten“,
den Abschnitten über den Maskenball und
dem letzten Teil, das Magische Theater.
Das „Vorwort“ ist aus der Sicht eines anonymen Herausgebers geschrieben, der als Neffe der Vermieterin identifizierbar wird. In ihrem Haus bewohnt Haller neun oder zehn Monate (!) lang zwei Dachzimmer. Durch das Vorwort lernt der Leser Harry Haller aus einer „neutralen“ und beobachtenden Perspektive kennen, erhält einen Eindruck über seine Lebensgewohnheiten und wird über dessen plötzliches Verschwinden informiert.
Die sich daran anschließenden, von Harry Haller selbst verfassten „Aufzeichnungen“, machen den Leser mit seiner inneren Welt, seinen Kämpfen und Leiden bekannt. Haller ist in sich entzweit. Er sieht sich als Mensch und als Steppenwolf. Haller beschreibt den Steppenwolf als (s)eine zweite, einsame Natur, die in ihm ein lebensfremdes und ästhetisierendes Dasein fristet.
Während eines Abendspazierganges sieht Harry Haller an einer Wand eine Schrift aufleuchten („Eintritt nur für Verrückte“) und erhält in der Folge von einem Unbekannten den „Tractat vom Steppenwolf“, eine Abhandlung, die eigens für ihn geschrieben zu sein scheint und in der es um sein Steppenwolfdasein geht. Die genaue Analyse seiner Lage durch den Traktat lässt Harry Haller noch mehr verzweifeln.
Haller, der im Begriff ist, Selbstmord zu begehen, trifft in einem Gasthaus auf Hermine, sie ist „Freudenmädchen“ oder Prostituierte, die ihn an seinen Jugendfreund Hermann erinnert. Hermine führt Haller in die Welt des Tanzes ein und vermittelt ihm Lebensfreude und Unbeschwertheit. Hermine ist aber auch – wie Harry Haller – geprägt von der Sehnsucht, aus dem Leben zu scheiden. Sie macht Haller früh darauf aufmerksam, dass er sie töten werde, ohne näher darauf einzugehen wie und wann. Später stellt sie ihm ihre Freundin Maria vor, mit der Haller auch eine sexuelle Beziehung eingeht. Mit Hermine ist die nicht der Fall!
Hermine macht ihn mit dem Musiker Pablo, mit Jazz und modernem Tanz bekannt. Mehr und mehr freundet er sich an mit dieser Welt des Vergnügens und des Augenblicks. Eine Einladung zu einem Maskenball folgt mit dem Versprechen, Hermine in der „Hölle“ zu treffen. Harry Haller taucht in eine innere Phantasiewelt ab, ein „Magisches Theater“, von dem man nicht genau weiß, ob es real ist oder nur in Hallers Einbildung existiert. Letzteres ist wahrscheinlicher, weil es aus einer skurrilen Mischung von phantastischen Begebenheiten, Wunschphantasien und bildhaften Einblicken in das Seelenleben besteht. Pablo ist derjenige, der Haller in diese geheimnisvolle Welt einführt und ihn mit dem imaginären Dasein der „Unsterblichen“ bekannt macht, wozu Mozart und Goethe zählen.
Das Magische Theater besteht aus vielen Türen. Hinter jeder Tür erwartet Haller eine Facette seiner Persönlichkeit. Endlich gelangt er in den Raum, wo er auf Hermine zu treffen hofft. Er findet Pablo und Hermine nach erfolgtem Beischlaf. Mit einem imaginären Messer ersticht er Hermine. Dafür wird er von Pablo und den „Unsterblichen“ mit dem Auslachen bestraft. Harry wird auch verurteilt, das Lachen zu lernen und Wunschvorstellungen und Phantasien nicht durch intellektuelle Reflexionen zu verderben. Harry Haller schöpft neuen Lebensmut und ist bereit, das Spiel des Lebens neu zu spielen.
Die Radiomusik des Lebens
Eigensinn, Bürgertum, Künstler, Zeit
Hermann Hesse stellt den „Eigensinn“ über den Gehorsam, der als „die“ deutsche Tugend vor und nach dem Ersten Weltkrieg galt. Seine Zeilen: „Wer eigensinnig ist, gehorcht einem anderen Gesetz, einem einzigen, unbedingt heiligen, dem Gesetz in sich selbst; dem Sinn des ‚Eigenen‘... Nur der Held ist es, der den Mut zu seinem eigenen Schicksal findet“, die er 1919 unter dem Pseudonym Emil Sinclair schreibt, bezeugen seinen „gefährlichen“ Individualismus. Nicht von ungefähr erschienen diese Worte in Vivos voco – Zeitschrift für neues Deutschtum. Diese Zeitschrift steht für die Sehnsucht nach einer pazifistischen und der Lebensreform nahestehenden Lebensweise. Hesse zeigt sich auch im „Internationalen Versöhnungsbund“ aktiv, einer 1914 gegründeten Organisation für Frieden, Gewaltlosigkeit und Menschenrechte, die ab 1919 auch in Deutschland zu wirken begann.
Lebensreform und Eigensinn
Hesse handelt konsequent. Er setzt die Vorstellung einer alternativen Lebensweise mit seiner ersten Frau und den drei Kindern um. Sie verzichten auf Komfort und leben mit einfachen Mitteln, ohne fließendes Wasser, Strom und mit einem Garten, der der Selbstversorgung dient. So verbringt die junge Familie drei Jahre von 1904 bis 1907.
Vor dem Kriegsausbruch im Jahre 1914 appelliert Hesse an die Intellektuellen Deutschlands, sich nicht auf nationalistische Polemik einzulassen. Doch Pazifismus, Lebensreform und Versöhnung sind Begriffe, die in der Zeit um den Ersten Weltkrieg nicht passend erscheinen. Hesse wird angefeindet. Er gilt als Vaterlandsverräter. Hassbriefe folgen. In Theodor Heuss, dem später ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, findet er einen Freund in seiner Haltung, ebenso wie im französischen Schriftsteller Romain Rolland.
Nach dem Ersten Weltkrieg wird das Verhältnis der Öffentlichkeit ihm gegenüber nicht besser. Er beschließt, Deutschland zu verlassen.
„Über gute und schlechte Kritiker“ (Manuskript im Hermann-Hesse-Museum Calw)
Die Goldenen Zwanziger
Deutschland ist nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Weg zur Demokratie aber auch ein gespaltenes Land. Das deutsche Nationalgefühl bleibt ungebrochen. Die „Dolchstoßlegende“, das deutsche Heer sei im Kampf ungeschlagen und wurde nur von der Politik durch einen aufgezwungenen Waffenstillstand am 11. November 1918 besiegt, prägt eine ganze Generation und bestärkt sie trotzig in ihrem Glauben an nationalistische Werte. Das ist ein schleichendes Gift für die junge Demokratie.
Das Vertrauen in die Weimarer Republik ist gering. Es herrscht Uneinigkeit über die politische Richtung, die die Republik einschlagen soll. Immer wieder erschüttern Putschversuche den jungen Staat. Ein Rechtsruck zu radikalen, antidemokratischen Kräften ist absehbar. Die Höhe der Reparationszahlungen, die stagnierende Wirtschaft, außenpolitische Schwierigkeiten, Konflikte mit den geografischen Nachbarn ... tragen dazu bei, die Begeisterung für demokratische Werte innerhalb der Weimarer Republik zu schwächen. Ende der 1920er-Jahre steht die Republik an einem Scheideweg und die endgültige Richtung hin zur Diktatur wird 1933 mit der Machtübernahme der NSDAP festgelegt.
Hesse verfolgt die letzten Jahre der Weimarer Republik von der sicheren Schweiz aus. Er erlebt aus der Entfernung, was sich im Deutschen Reich tut. Die Schweizer blicken in den 1920er-Jahren ihrerseits aber auch nach Berlin, indem sie die neue Mode, die freien Lebensformen und die Vergnügungssucht imitieren.
Berlin ist dabei das Zentrum einer lärmenden und ausschweifenden Jugend. Man spricht vom „Tanz auf dem Vulkan“. Das Leben wird in vollen Zügen genossen und die Nacht zum Tag gemacht. Alles ist schnelllebig und hektisch. Jazz, neue Tänze, Gigolos, Eintänzer, Damenbands, Drogen ... kommen in Mode. Frauen emanzipieren sich, provozieren eine männlich geprägte Welt durch Kleidung (Hosenanzug), Haarschnitt (Bubikopf) und Benehmen. Es gilt aufzufallen und Aufmerksamkeit zu erregen.
Sport wird wichtig. Großveranstaltungen locken Scharen von Besuchern an. Phänomene der „Masse“ und der „Öffentlichkeit“ rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. Arbeitslosigkeit und Verstädterung sind weitere Themen. Die Verelendungstheorie von Karl Marx scheint sich zu bewahrheiten: das Kapital ballt sich in den Händen weniger und es entsteht ein wachsendes Proletariat, das mit wenig zufrieden sein muss und auf seine Chance wartet, sich zu wehren. Bis dahin wird jedoch gefeiert.
Radiomusik
Neben den neu entstehenden Lichtspielhäusern (Kinos) wird das Radio zum wichtigen Medium. Bert Brecht analysiert in verschiedenen Essays die Bedeutung des Radios: „Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. [...] Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm daran. Noch schlimmer sind Zuhörer daran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat.“ Er bemängelt die einseitige Kommunikation. Hesse kritisiert im Steppenwolf das Radio ebenfalls:
Und daß dies alles, ebenso wie heute die Anfänge des Radios, den Menschen nur dazu dienen werde, von sich und ihrem Ziele weg zu fliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und nutzlosem Beschäftigtsein zu umgeben (135).
Doch er verlegt den Akzent darauf, dass das Radio den Menschen von sich selber ablenke. Radiomusik verderbe den Livecharakter eines Werkes. Sein Protagonist Harry Haller ist entsetzt, als Mozart das Radio anstellt, um Musik zu hören. Für Haller unerklärlich, denn eine solche Übertragung zerstöre „die edle Struktur dieser göttlichen Musik“ (271). Genau das Gegenteil sei der Fall, erwidert Mozart:
Wenn Sie dem Radio zuhören, so hören und sehen Sie den Urkampf zwischen Idee und Erscheinung, zwischen Ewigkeit und Zeit, zwischen Göttlichem und Menschlichem (272).
Das Radio wird zum Synonym für den Zeitgeist, eine Metapher für den Menschen der 1920er-Jahre, der eingebettet in eine Welt der Erscheinungen, dennoch in die Lage versetzt werden solle, die Idee hinter den Täuschungen wahrzunehmen, die Ewigkeit in der Zeit zu erleben.
Wenn Haller aufgefordert wird, die Radiomusik des Lebens zu hören, um dahinter den Geist zu verehren (135), dann weist dies über reinen Zeitvertreib und Unterhaltung hinaus. Selbst in jenen unscheinbaren Momenten des „billigen“, zerrinnenden, wahllosen Vergnügens steckt die Möglichkeit, das Unmögliche, das Unendliche, das Unsterbliche (das Ewige) zu erahnen. Hesse deutet den Radioapparat anders als Bert Brecht und sieht eine Tiefe, die viele Zeitgenossen nicht sehen wollen oder können.
Werk – Wirkung – Missverständnisse
Hesses Blick richtet sich weg vom Deutschen Reich und weg von der latenten Bedrohung des Eigensinns. Äußere Anfeindungen, familiäre Schicksalsschläge, Depressionen und Krankheit … führen dazu, dass Hesse Deutschland verlässt und sich in der Schweiz ansiedelt. Seinem Werk tut dies keinen Abbruch. Sein 1919 erschienener Roman Demian wird ein Riesenerfolg. Weitere folgen, ehe er 1946 den Nobelpreis für Literatur erhält.
Ende der 1960er-Jahre wird Hesses Werk in den Hippiekreisen der USA populär. Die Band „Steppenwolf“ nennt sich nach dem gleichnamigen Roman und landet mit „Born tobe wild“ einen weltweiten Hit. Er ist die Titelmelodie von Easy Rider – einem Film über zwei Aussteiger, die mit ihren Motorrädern ziellos durch die Vereinigten Staaten fahren. Eine Theatergruppe „Steppenwolf Theatre Company“ wird 1974 gegründet.
Romantische Literaturtradition
Hermann Hesse ist von einer romantischen Literaturtradition geprägt. Er wird früh von Dichtern wie Novalis (1772–1801), Clemens Brentano (1778–1842), Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857) oder Ludwig Tieck (1773–1853) inspiriert. Gleichzeitig schätzt er Goethe, Schiller und die Gedanken des damals noch neuen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844–1900). Nietzsche gilt als freier Denker, der sich von geistigen und moralischen Beschränkungen loszumachen sucht. Seine Kulturkritik, seine Kritik an der christlichen Religion, seine symbolisch-bildhafte Sprache – wie in Also sprach Zarathustra (1883–1885) – inspirieren bis heute. Nietzsches These „Gott ist tot“, was meint, dass der Mensch Gott getötet habe – „Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet [sic], – ihr und ich“1 – ist eine Anklage an den Verlust all dessen, was Menschsein ausmacht. Nietzsche prangert die Überheblichkeit des Menschen an, die nur in einer Katastrophe enden wird. Der Steppenwolf interpretiert das Wort Nietzsches „Ein Werk auf die Katastrophe hin bauen“2 in seinem Roman dahingehend, dass aus einer Katastrophe, einem Zusammenbruch, etwas Neues entsteht.
Naivität und Bürgertum
Wie Nietzsche steht auch Hesse in einem radikalen und zeitweilig arglos anmutenden Verhältnis zur Welt. Hesse besingt in seinen Gedichten die Natur, hängt der Sehnsucht nach einem natürlichen Leben nach (Knulp) oder sucht Auswege im eigenen Inneren, weil die Welt, so wie sie sich zeigt, keine Alternative zu geben vermag (Demian, Siddharta).
Die Enttäuschung Hesses, sein repräsentativ-dichterisches Leiden an der Welt, seine immer wieder präsente aufkeimende Hoffnung, werden durch den Bezug auf Psychologie und Mythologie, Mystik und Märchen offenbar. Neben der Zeitkritik hält er die Sehnsucht nach einer besseren, friedvolleren Welt in seinem Werk aufrecht. Beide Seiten der Welt beschreibt der Autor. Das mag manchen mit ein Grund dafür sein, ihm Naivität oder Einfalt unterstellt zu haben. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Der Bürger Hermann Hesse, er existiert in der Kritik am Bürgertum. Hesse ist ebenso weit weg von der bürgerlichen Welt wie er ihr nahesteht: er ist von ihr fasziniert und irritiert. Er meidet sie, sucht alternative Lebensformen, revoltiert gegen den Gehorsamkeitsgeist und leidet an einer Zeit, in der der Einzelne und dessen Sehnsucht nach „Eigensinn“ von der Gesellschaft und deren Vermassung und Gleichschaltung beherrscht wird.
Hesse bis heute
Hesse schärft den Blick für das Allzumenschliche, blickt schon früh auf Dichtung und Philosophie des Ostens (Indien, China, Japan), verliert aber die kleinen Schwächen des Alltags nicht aus dem Blick. Er leidet am Alter, leidet an der Krankheit, leidet am Leiden. Hesse gilt vielen als Prophet. Andere wiederum fühlen sich von ihm unangenehm berührt und leugnen, ihn jemals gelesen zu haben.
Er hat sich oft für Künstler, Zeitgenossen und vor allem junge Autoren eingesetzt. Sein Verleger Siegfried Unseld, jahrzehntelanger Leiter des Suhrkamp-Verlages, dem bedeutenden und einflussreichen Intellektuellen-Verlag der Nachkriegszeit, gibt zu, dass es Hesse war, dessen Titel in Millionenauflagen den Verlag immer wieder gerettet haben.3 Und es war dadurch möglich, immer wieder auch junge Autoren zu publizieren.
Bis heute ist Hesse ein umstrittener Autor. Vergleichsweise zeigt sich die Publikationsliste an wissenschaftlicher Sekundärliteratur zu seinem beinahe gleichaltrigen Freund Thomas Mann unüberschaubar, während eine solche zu Hesse kaum vorhanden ist. Ein bedauerlicher Mangel, der sich in absehbarer Zeit auch nicht beheben lassen wird. Hesse, so die Vermutung, ist literaturwissenschaftlich nicht opportun. Möglich, dass dem wissenschaftlichen Blick dabei etwas Wesentliches entgeht. Möglich, dass Hesse es dem Leser zu leicht macht und dieser dabei das übersieht, was sich an Menschlichem in der Tiefe des Werkes verbirgt.
Zudem verführten Aussagen, wie jene von Marcel Reich-Ranicki, einem der einflussreichsten Literaturkritiker der letzten Jahrzehnte dazu, Hesses Steppenwolf beispielsweise als eine zu überwindende Lektüre abzutun: „Als ich ihn in meiner Jugend zum ersten Mal las, war ich entzückt, nach der zweiten Lektüre enttäuscht und nach der dritten entsetzt.“4 Viele teilen diese Meinung. Man meint sich an das Bonmot des englischen Mathematikers und Philosophen Bertrand Russell erinnert: „Wer in seiner Jugend kein Kommunist war, hat kein Herz, wer es im Alter noch immer ist, hat keinen Verstand.“ Das könnte ohne weiteres auf Hesse übertragen werden: Wer in seiner Jugend Hesse liest, ist seiner Zeit voraus; wer ihn im Alter immer noch liest, hinkt ihr hinterher. Das Traurige dabei ist, damit wird man weder dem Werk Hermann Hesses gerecht noch kann so dessen Besonderheit geschätzt werden.
Ein Roman wie Der Steppenwolf, der inhaltlich und formal anspruchsvoll ist und sich nicht einfach so nebenbei lesen oder abtun lässt, muss erlebt werden. Dass er zu solcher Fehleinschätzung verleitet, bedürfte der näheren Begründung. Es könnte einer als zu naiv anmutenden Sprache geschuldet sein. Der Roman jedenfalls ist vielschichtig und komplex. Er erzählt die Geschichte der Midlife-Crisis eines fast 50-Jährigen; er erzählt die Reise in das Unbewusste, den Bilderreichtum der Seele; er erzählt die Begegnung mit der durch Drogen ausgelösten Innenwelt; er erzählt von Konflikten mannigfaltiger Art, zwischen Trieb und Geist, Bürger und Künstler, Unsterblichen und Sterblichen, Frau und Mann und er erzählt von der Zeitkrankheit der 1920er-Jahre:
Ich sehe in ihnen aber etwas mehr, ein Dokument der Zeit, denn Hallers Seelenkrankheit ist – das weiß ich heute – nicht die Schrulle eines einzelnen, sondern die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation, welcher Haller angehört, und von welcher keineswegs nur die schwachen und minderwertigen Individuen befallen scheinen, sondern gerade die starken, geistigsten, begabtesten (30).
Keine leichte Lektüre und vor allem keine, die sich durch ein erstmaliges Lesen erschließt. Vieles wird durch eine poetische Sprache, die stellenweise sentimental scheint, überdeckt. Doch der sezierend-kritische Blick auf die Gesellschaft und den Menschen ist da. Es gibt die Analyse, die auf Tiefe aus ist, die Probleme benennt und Außenseitern eine Stimme leiht. Und doch, das ist das Merkwürdige, das, was bei der Lektüre zu lernen ist: man verliert nicht die Hoffnung auf Aussöhnung und Versöhnung aus den Augen. Bei all der Düsternis, die Zuversicht bleibt zumindest als Verheißung. Vielleicht ist der unbedingte, wenn auch verborgene Optimismus von Hesse das, was zum Widerspruch reizt und eine zweite oder dritte Lektüre „unerträglich“ macht. Denn die Welt ist doch anders! Ist sie das? Muss sie es sein?
Schreibtischstuhl Hesses aus Montagnola und Bronzebüste Hesses von Otto Bänninger, 1957 (im Hermann-Hesse-Museum Calw)
Hermann Hesse 1877 bis 1962
2. Juli 1877
geboren in Calw als zweites Kind von Marie (geb. Gundert) und Johannes Hesse; Der Vater ist Missionar u.a. in Indien, dann Gehilfe seines Schwiegervaters Hermann Gundert im Calwer Verlagsverein.
1886–1891
Schulbesuch;
1891–1892
Seminarist im evangelisch-theologischen Klosterseminar Maulbronn;
Oben: Hesses Mutter Marie, geb. Gundert. Rechts: Geburtshaus in Calw und Hesse als Vierjähriger (Hermann-Hesse-Museum Calw).
1892