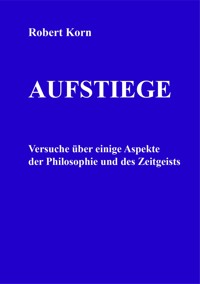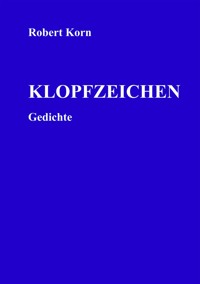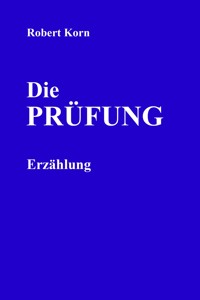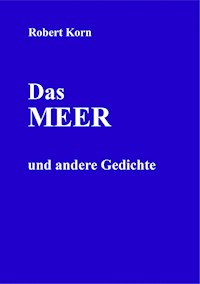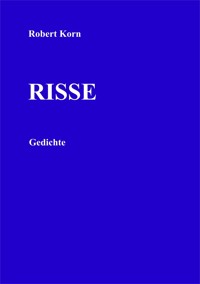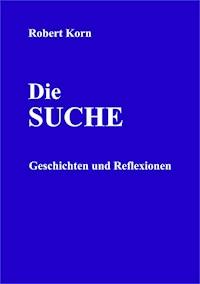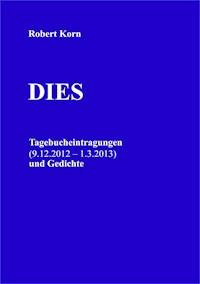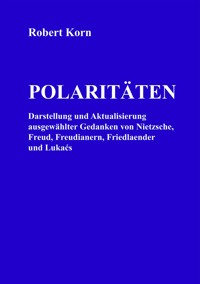
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In dem Buch "Polaritäten" geht es um ausgewählte Gedanken von Denkern, die sich mit wichtigen Polaritäten auseinandergesetzt haben. So findet sich bei Nietzsche etwa die Polarität der "Starken" und "Schwachen", bei Freud die von "Lust"- und "Realitätsprinzip", bei Friedlaender die Polarität von "Weib und Mann" und beim jungen Lukács die von "Aktivität und Kontemplation". Der Verfasser der "Polaritäten" legt in seinem Text die von ihm ausgewählten Gedanken nicht nur anhand von vielen Zitaten dar, sondern setzt sie auch zu Erscheinungen der Gegenwart wie etwa der des "Shitstorms" in Beziehung. Der Polaritätsbegriff, von dem sich die genannten Denker leiten lassen, steht in einem Gegensatz zu dem, was man heutzutage gemeinhin unter "Polarisierung" versteht, d.h. zu einer Form von Polarisierung, die, mit Salomo Friedlaender zu sprechen, "pathologisch" ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Polaritäten
Darstellung und Aktualisierung ausgewählter Gedanken von Nietzsche, Freud, Freudianern, Friedlaender und Lukaćs
Robert Korn
Imprint
Robert Korn Polaritäten © 2024 Robert Korn
Erschienen bei www.epubli.de, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Konvertierung: Sabine Abels | www.e-book-erstellung.de
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
G.W.F. Hegel
I. Friedrich Nietzsche
Aktivität und Reaktivität
Die Starken und die Schwachen
Ressentiment und schlechtes Gewissen
Vom asketischen Ideal zum Übermenschen
„Maß und Mitte“
II. Sigmund Freud
Unbehagen im Denken
Verneinungslust
Entstellung
Selbstkritik
Fetischismus
Synthese
Hysterie
Paranoia
Humor
Ersatz
Charakterologie
III. Salomo Friedlaender
Polares Denken
„Der Respekt vor sich selber“
Bosheit
„Donner der Sexualität“
IV. Georg Lukács
Ordnung und Entsagung
Abstrakter Idealismus, romantisches Lebensgefühl und konkreter Idealismus
V. Literaturverzeichnis
G.W.F. Hegel
„Der Nordpol am Magnet kann nicht sein ohne den Südpol und der Südpol nicht ohne den Nordpol. Schneidet man einen Magnet auseinander, so hat man nicht an dem einen Stück den Nordpol und am anderen den Südpol.“
Friedrich Nietzsche
Aktivität und Reaktivität
Nietzsche unterscheidet zwischen der „eigentlichen Aktivität“ und der „‚Anpassung‘“, die er als „eine Aktivität zweiten Ranges, eine bloße Reaktivtät“ begreift. Die eigentliche Aktivität ist nach Nietzsche durch „die spontanen, angreifenden, übergreifenden, neu-auslegenden, neu-richtenden und gestaltenden Kräfte“ bestimmt.
Der von ihm so genannte „Wille zur Macht“ „bewirkt“, wie Gilles Deleuze in einem Aufsatz über die Philosophie Nietzsches betont, „daß die aktiven Kräfte bejahen, sogar ihren eigenen Unterschied bejahen“. In „ihnen ist“, erläutert Deleuze weiter Nietzsches Begriff der „aktiven Kräfte“, „die Affirmation primär und die Negation ist nichts als eine Konsequenz“.
Nietzsches Verständnis der wahren Aktivität lässt sich am besten anhand der künstlerischen Tätigkeit verdeutlichen. Beginnt doch jeder Künstler seine Arbeit damit, dass er ja sagt zu einer bestimmten Konzeption. Auch wenn sein Werk schließlich nicht so ausfällt, wie er es anfänglich geplant hat, ergeben sich doch die von dem Künstler vorgenommenen Korrekturen letzten Endes nur als eine Konsequenz aus der Bejahung seiner ursprünglichen Konzeption.
Im Gegensatz zur „eigentlichen Aktivität“ bedarf die „bloße Reaktivität“, so Nietzsche, „äußerer Reize, um überhaupt zu agieren“. Der nach Nietzsche für das Leben grundlegende „Wille zur Macht“ bedingt, dass die „bloße Reaktivität“ „von vornherein“, wie er formuliert, „Nein“ sagt „zu einem ‚Außerhalb‘, zu einem ‚Anders‘, zu einem ‚Nicht-selbst‘“. In den rein reaktiven Kräften ist deshalb Nietzsche zufolge die Negation primär und die Bejahung in ihnen ihr immer nur untergeordnet.
Wer etwa auf bestimmte Formen des Zeitgeists lediglich reagiert, vermag sie zwar zu bejahen, seine Bejahung kann hier aber einzig, wenn man Nietzsches Gedanken der Reaktivität ernst nimmt, die bloße Folge einer übergeordneten Verneinung sein.
So ließe sich etwa die Bejahung von Zeitgeistformen bei jemandem u.U. dadurch erklären, dass sie das bloße Ergebnis einer grundlegenden Negation all dessen ist, was die eigene berufliche Karriere behindern könnte, wie eben zum Beispiel die Äußerung nonkonformistischer Vorstellungen. Wer diese primäre Negation vor sich selbst oder anderen verbergen will, wird sicherlich mit umso größerem Nachdruck zu den Zeitgeistformen ja sagen.
Wenn einer dagegen die Zeitgeistformen „von vornherein“, also unbegründet, verneint, so muss seine Negation abstrakt ausfallen. Diesen Mangel wird er dann in der Regel dadurch auszugleichen versuchen, das er seine Kritik emotional besonders heftig äußert.
Nach Nietzsche haben in dem die Geschichte bestimmenden „Willen zur Macht“ bisher die reaktiven, verneinenden Kräfte triumphiert. Diesen Triumph „nennt Nietzsche ‚Nihilismus‘ oder“, um Deleuze erneut zu zitieren, „den Triumph der Sklaven“, d. h. der Menschen, die entgegen ihren eigenen Möglichkeiten bloß reagieren, anstatt selbständig zu agieren.
Deleuze betont in seinem Aufsatz, dass nach Nietzsche „der Sklave nicht aufhört, Sklave zu sein, indem er sich die Macht nimmt“.
Die allgemeine Sklaverei kann Nietzsche zufolge nur überwunden werden durch eine Umwertung aller nihilistischen Werte. Die dabei entstehenden Werte, so muss man hier schlussfolgern, würden alle Formen des Lebens gutheißen, die Ausdruck der „eigentlichen Aktivität“ des Menschen sind.
Erst aus der Bejahung dieser aktiven Lebensformen kann sich dann eine wirksame Negation der bloß reaktiven Formen des Lebens ergeben, zu denen etwa das Appeasement zählt. Ein wahrhaft aktives Denken ist auch in der Lage, eine sich viril spreizende Macht als eine bloße und damit nihilistische Reaktion auf Erscheinungen zu entlarven, die angeblich oder auch wirklich dekadent sind.
Die Starken und die Schwachen
Stark ist nach Nietzsche einer, der das Leben so vorbehaltlos bejaht, dass er auch noch ja sagt „zum Leiden selbst, zur Schuld selbst“.
Letzteres könnte man so deuten, dass jeder, der möglichst rückhaltlos lebt, auch bereit ist, um des Lebens willen eine gewisse Schuld auf sich zu nehmen.
Um alles Fragwürdige des Daseins zu erkennen, „dazu“, betont Nietzsche, „gehört Mut und, als dessen Bedingung, ein Überschuss an Kraft“. Je mutiger und damit kraftvoller bzw. stärker man ist, desto mehr, sagt Nietzsche, „nähert man sich der Wahrheit“.
Warum aber bedarf es des Mutes, um die Wahrheit zu erkennen? Weil sie nach Nietzsche diejenigen „Seiten des Daseins“ betrifft, die, wie er weiter schreibt, „von den Christen und den anderen Nihilisten“ abgelehnt werden. Zu diesen Seiten gehört vor allem jedes starke, sinnliche und zugleich auch lebensbejahende Verlangen.
Die im Sinne Nietzsches „Schwachen“ unterscheiden sich von denen, die er als „Starke“ bezeichnet, durch ihre, wie er formuliert, „Feigheit und Flucht vor der Realität“. Diese Flucht werten die von Nietzsche beschriebenen Schwachen um, indem sie sie zum „Ideal“ erheben. Dadurch können sie dann, so führt Nietzsche weiter aus, die Aktivitäten der Starken moralisch abwerten.
Nietzsche zufolge gelingt es den nach seinem Begriff Schwachen schließlich sogar, das „Leben selbst“, um es mit Deleuze auszudrücken, „von seiner Macht und allem, was es vermag“, zu trennen. „Das Lamm“, fügt Deleuze hier noch hinzu, „sagt: ich könnte alles tun, was der Adler macht, ich aber habe das Verdienst, mich zurückzuhalten“.
Ein solches Verdienst nehmen heute etwa diejenigen für sich in Anspruch, die sich „Radikalpazifisten“ nennen. Sie wollen in ihrem Gesinnungsstolz nicht wahrhaben, dass sie sich durch ihre grundsätzliche Ablehnung von Gewalt oftmals viel schuldiger machen als all die, die um der Freiheit willen bereit sind, u.U. auch militärisch gegen einen Aggressor vorzugehen.
Ressentiment und schlechtes Gewissen
„Jeder Leidende nämlich“, sagt Nietzsche, „sucht instinktiv zu seinem Leid eine Ursache“. Hierbei, präzisiert Nietzsche, sucht der Leidende „einen für Leid empfänglichen schuldigen Täter …, an dem er seine Affekte tätlich oder in effigie auf irgendeinen Vorwand hin entladen“ könne.
Diese „Affekt-Entladung“ ist nach Nietzsche „der größte Erleichterungs-, nämlich Betäubungsversuch des Leidenden“. Genau darin allein, so vermutet Nietzsche, liege „die wirkliche physiologische Ursächlichkeit des Ressentiments, der Rache und ihrer Verwandten“.
Dem Versuch, den Schmerz durch Affekte, also heftige Erregungen, zu betäuben, steht die Anstrengung entgegen, durch eine möglichst genaue Ermittlung der Ursachen des Schmerzes diesen auch wirklich zu beheben. Dazu aber müssen die Leidenden mithilfe der Vernunft ihrer, wie Nietzsche formuliert, „entsetzlichen Bereitwilligkeit und Empfindsamkeit in Vorwänden zu schmerzhaften Affekten“ widerstehen.