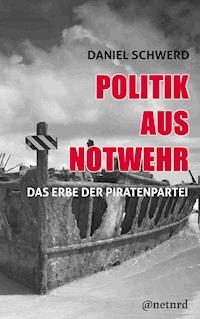
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter Aufstieg und ein genauso rasender Zusammenbruch: Die Piratenpartei. Daniel Schwerd berichtet aus sechs Jahren Parteizugehörigkeit über Erfolge, doch auch offen und ehrlich über die Gründe für das Scheitern dieser Internetpartei. Und er zieht ein Fazit, welche Lehren man aus diesem Experiment ziehen kann. „Ihr werdet Euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen“ schrieb Max Winde „@343max“ 2009 bei Twitter. Und fasste damit den größten Erfolg der Piratenpartei zusammen: Eine Generation von Menschen, nämlich die im Internet sozialisierten, politisiert zu haben. Doch es zeigte sich, dass die „Netzgemeinde“ nicht homogen ist. Es gab nicht einmal ein gemeinsames Wertegerüst. Und das war die Hauptursache für das Scheitern der Piratenpartei, für die gesellschaftliche und politische Erfolglosigkeit der Internetgemeinde insgesamt. Teil des Internets, Teil der Netzgemeinde zu sein allein macht nämlich niemanden zu einem besseren Menschen. Wofür sollte das eigentlich alles gut sein und woran ist es letztlich gescheitert? Und schließlich: Welches sind die Lehren, die man aus dem Experiment „Piratenpartei“ ziehen kann? Wie könnte eine neue, zukünftige Bewegung oder auch eine bereits bestehende von den gewonnenen Erkenntnissen profitieren? Und wie geht es jetzt weiter? Es geht um Mechanismen und Ereignisse in einer Partei und in der Politik, um komische und traurige Vorkommnisse, flüssige Demokratie, Zombie-Bügeleisen, Netzpolitik, Schwarmintelligenz und Lernen durch Schmerz – nur eben ohne Lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Kindern: <3
Ihr seid der Grund, wozu ich das alles tue.
Meiner Mutter: <3
Du bist der Grund, warum ich das alles tue.
Andrea: <3
Du bist der Grund, warum ich das alles tun kann.
Das Buch
Ein rasanter Aufstieg und ein genauso rasender Zusammenbruch: Die Piratenpartei. Daniel Schwerd berichtet aus sechs Jahren Parteizugehörigkeit über Erfolge, doch auch offen und ehrlich über die Gründe für das Scheitern dieser Internetpartei. Und er zieht ein Fazit, welche Lehren man aus diesem Experiment ziehen kann.
Der Autor
Daniel Schwerd, Mitglied im Landtag NRW, macht dort Netz- und Medienpolitik sowie Politik rund um den digitalen Wandel – einst für die Piraten, mittlerweile als fraktionsloser Abgeordneter für die LINKE. Diplom-Informatiker und selbstständiger Internet-Unternehmer, gehört der Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW an; schreibt regelmäßig zu netzpolitischen Themen in Blogs und Zeitschriften; engagiert sich für Teilhabe aller an politischen und gesellschaftlichen Prozessen, für Netzpolitik und gegen Überwachungswahn im Internet.
Inhalt
Statt eines Vorwortes
Politik aus Notwehr
2009
Zensursula und Stasi 2.0
Piraterie
Die erste Eintrittswelle
Mein erster Parteitag
2010
Plötzlich Politiker
Kein Programm
Die NRW-Strukturkriege
Personenwahlen als Parteitagssimulation
Der Kreisverband Köln
Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
2011
Richtungsentscheidung oder nicht?
Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik
Der unfassbare Erfolg in Berlin
Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht
Blauäugig, Gutgläubig, Einfältig
Flüssige Demokratie
2012
Politik mal ander5
ACTA
Ein schiefes Bett und ganz viel Erleichterung
Komprimierter Wahlkampf
Plötzlich Parlamentarier
Größtenteils harmlos
Die Grenzen der Transparenz
Politik 1.0
Das tut uns leid
2013
Der Gaza-Streifen ist kein Konzentrationslager
Irgendwie jüdisch-sein
Aufstellung in der Pampa
Summer of Love
Der Ball auf dem Elfmeterpunkt
Lernen durch Schmerz, nur ohne Lernen
Zombie-Bügeleisen aus der Hölle
Der Zwang zur Konformität
Die verpasste Chance der SPD
Asyl für Edward Snowden
Der 30C3
2014
Solidarität gibt’s leider nicht
Thanks Bomber Harris
Piratlinksliberal
Marina Kassel
Foyerpiraten
512K
Das „politisch korrekte“ Beleidigen von Nazis
Basisentscheid offline
2015
Innerparteiliche Beteiligung am Ende
Tu cuoque
Ordnungsmaßnahme als Beschäftigungstherapie
Dysfunktionale Fraktion
Schwammintelligenz
Alles wie immer
2016
Einzelkämpfer
Aufbruch in Fahrtrichtung Links
Was bleibt
Lehren aus dem gescheiterten Experiment
These 1: Basisdemokratie funktioniert nicht ohne elektronische Unterstützung
These 2: Ein Demokratie-Update braucht direkte und delegative Elemente
These 3: Regelwerk ersetzt nicht Haltung
These 4: Partizipation zuzulassen bedeutet nicht, sich nicht abzugrenzen
These 5: Transparenz ist kein Selbstzweck
These 6: Man braucht Köpfe mit Themen
These 7: Humanes und solidarisches Miteinander ist nötig
These 8: Schwarmintelligenz gibt’s nicht
These 9: Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik – und umgekehrt
Statt eines Nachwortes
Statt eines Vorwortes
Ich sitze bei knapp vierzig Grad im Schatten unter dem Balkon, hier auf dem Monte Clamottone in Umbrien, schwitze, und schreibe mir eine Last von der Seele. Ich schreibe hier über ein Kapitel Vergangenheit, denn die Entscheidung, die Piratenpartei zu verlassen, steht bereits fest. Es ist nur noch das Wie und das Wann, welches mir unklar ist. Es beschäftigt mich auch, was ich mir nach einem Austritt an Angriffen und Bösartigkeiten werde anhören müssen. Denn dass ich dafür einen Sturm der Entrüstung ernten werde, ist absehbar.
Seit vielen Jahren kommt unsere Familie hierher in dieses Haus auf dem Berg in Umbrien, möglicherweise dieses Jahr zum letzten Mal: Mein Stiefvater und seine Brüder, die das Haus von ihren Eltern erbten, wollen jetzt verkaufen. Nachdem selbst die Enkel langsam das Interesse am Urlaub auf dem Berg verlieren, und die Zweitwohnungssteuer in Italien erheblich angezogen worden ist, lohnt sich das Ferienhaus immer weniger. Sentimentalität alleine reicht da nicht.
Seit 1975 war das Haus im Besitz der Großeltern, die sich das mittelalterliche Haus als Ruhesitz zugelegt und liebevoll restauriert hatten, als der „Alte“ pensioniert worden war. In den folgenden Jahren waren wir viele Male hergekommen, auch nachdem die Stiefgroßeltern hochbetagt gestorben waren. So ist auch unser Sommerurlaub in diesem Jahr vielleicht eine Art Abschied.
Ich konnte nächtelang nicht richtig schlafen, immer wieder formulierte ich in meinem Kopf Partei-Austrittsbegründungen und Blogartikel, die erklären sollen, warum ich nicht mehr Teil von etwas sein kann, das in den letzten sechs Jahren mein Leben bestimmte. Und mir wurde klar, dass es so einfach nicht funktionieren würde: Nicht so, nicht in einem Blogpost. Ich würde sehr viel weiter ausholen müssen.
Ich war Teil von einem einzigartigen Ereignis, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich durfte den rasanten Aufstieg und den genauso rasenden Zusammenbruch einer Bewegung erleben – denn das Projekt „Piratenpartei“ ist gescheitert. Ob nun endgültig oder nur vorerst, vermag ich nicht zu sagen – mir ist jedenfalls unklar, wo die Ressourcen für eine Wiedergeburt überhaupt herkommen sollten. Ich persönlich muss jedoch in jedem Fall hier einen Schlussstrich ziehen.
Dabei fühlt es sich gar nicht an, als würde ich die Partei verlassen – die Partei ist mir unterwegs abhanden gekommen, sie ist nach und nach verschwunden.
„Ihr werdet Euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen“ twitterte Max Winde unter dem Twitter-Account @343max am 18. Juni 2009. Und fasste damit bereits den größten Erfolg der Piratenpartei zusammen: Eine Generation Menschen, nämlich die im Internet sozialisierten, politisiert zu haben. Eine Generation, von der es immer hieß, sie habe an Politik kein Interesse. Doch das war falsch: Sie wollte sehr wohl etwas ändern, als ihr Lebensraum Internet in Gefahr geriet. Und sie wollte die Art ändern, wie Politik gemacht wird: Ein Demokratie-Update.
Dabei war diese Generation alles andere als gleichalt: Von jugendlichen JuPis, der Jugendorganisation der Piraten, die in ihrem politischen Bewusstsein und in der Strukturiertheit ihrer politischen Rede die erwachsenen Piraten beeindruckten; bis zu Rentnerinnen und Rentnern mit faszinierenden Lebensläufen, Erfahrung, Starrsinn oder Milde waren alle Altersstufen vereint. Und nicht nur über unterschiedliche Altersstufen erstreckte es sich: Das Gefühl, auf einer gemeinsamen Wellenlänge zu schwingen, stellte sich stets umgehend ein.
Doch es zeigte sich, dass die „Netzgemeinde“ nicht homogen ist. Es gibt nicht mal ein gemeinsames Wertegerüst. Man ist sich noch nicht einmal sicher, ob man ein gemeinsames Wertegerüst überhaupt benötigt. Und das wiederum ist meines Erachtens die Hauptursache für das Scheitern der Piratenpartei, für die gesellschaftliche und politische Erfolglosigkeit der Internetgemeinde insgesamt.
Teil des Internets, Teil der Netzgemeinde zu sein allein macht niemanden zu einem besseren Menschen. Die Leute, die Du im Internet kennen lernst, können Dich genauso enttäuschen wie alle anderen auch. Genauso wenig, wie ein freier Markt sich den Bedürfnissen der Menschen passend selbst reguliert, genauso wenig verbessert es die Gesellschaft automatisch, wenn man Technologie einsetzt: Es bedarf in beiden Fällen der aktiven Gestaltung.
Die Piratenpartei, wir alle haben es vergeigt. Wir haben das Projekt in den Sand gesetzt. Der Kahn ist abgesoffen. Das ist eine Affenschande: Es gab ein Zeitfenster, in dem alles möglich schien. Wir trieben die etablierte Politik für einige Monate vor uns her. Beobachter wie Akteure: Alle sind sich einig, dass sich im parlamentarisch-politischem System dringend etwas ändern muss, und eigentlich war das unsere Aufgabe. Klar, wir hatten auch Gegenwind: Verlage und Medienunternehmen haben gegen Piraten lobbyiert. Und der politische Mitbewerber hat manche unserer Themen für sich entdeckt, gekapert und für sich genutzt. Aber, mal ehrlich, wer hätte erwartet, dass es keinen Gegenwind gibt? Niemand (26) hat gesagt, dass es einfach werden würde.
Und für die gesammelten Niederlagen der Piratenpartei sind wir alleine verantwortlich: Das desaströse Bild, die gegenseitige, öffentliche, permanente Zerfleischung. Die Abgrenzungsprobleme. Der Punkt, wo aus liebenswertem Dilettantismus unentschuldbare Schlamperei wurde. Wo sich eine Mehrheit der Partei nicht entscheiden konnte, eine politische Partei zu sein, sondern an der Parteisimulation festhielt.
Dieses Manuskript habe ich Freunden und Familie gegenüber als mein „Therapiebuch“ bezeichnet. Ich versuche darin, die Gründe für Erfolge und Niederlagen der Piratenpartei zu analysieren und meine persönlichen Erfolge und Niederlagen, die ich als Teil dieser Partei erlebt habe, selbst ein wenig besser zu verstehen. Der Text soll einen Einblick in die Piratenpartei aus der Perspektive eines Insiders geben und ist selbstverständlich aus meiner ganz persönlichen, damit also auch subjektiven Sicht geschrieben. Einen Anspruch auf alleinige Wahrheit kann er nicht haben, andere Beteiligte werden womöglich zu anderen Schlüssen kommen. Wenn man dabei meine persönliche Empfindsamkeit (Piraten würden sagen: Mein Mimimi) wahrnimmt: Das ist dann so und war nicht zu vermeiden. Man sehe es mir bitte nach.
Politik aus Notwehr
Ich war schon immer politisch interessiert – als Jugendlicher der 80er Jahre war ich mit den Friedensdemonstrationen im Schatten des Kalten Krieges aufgewachsen. Ich habe verfolgt, wie daraus die Grünen entstanden sind. Ich kann mich auch noch gut an den deutschen Herbst zuvor erinnern, als die Diskussion um die Gefahren der Rasterfahndung begann. Als Kinder spielten wir „Baader-Meinhof-Bande und Polizei“. Die Debatte im Deutschen Bundestag anlässlich des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt am 01. Oktober 1982 hörten wir stundenlang in einer Radiosendung im Bus während einer Schulklassenfahrt nach Oberaudorf bei Rosenheim, nahe der österreichischen Grenze. Danach kam die endlose, bleierne Ära Kohl, und die schnell enttäuschten Hoffnungen nach dem Regierungswechsel zu rot-grün. Es folgten die Golfkriege, der elfte September 2001 und die verhängnisvollen militärischen Interventionen in Afghanistan und im Irak.
Nach dem Zusammenbruch des „real existierenden“ Sozialismus schaltete der Kapitalismus in den Turbo-Gang. Die Nuller Jahre waren geprägt von sich weiter vergrößernder sozialer Spaltung: Der Neoliberalismus gebärdete sich auch deshalb so dreist, weil es keinen Gegenentwurf mehr gab. Die Agenda 2010, die von der rot-grünen Bundesregierung umgesetzt wurde, vergrößerte die soziale Spaltung in Deutschland weiter. Die gesamte deutsche Politik versammelte sich in der „alternativlosen“ Mitte. Mich machte das wütend.
Als der Kapitalismus den Bogen überspannte, und Banken weltweit mit Milliarden gerettet werden mussten, hofften viele, dass sich der Wind dreht und Banken in die Schranken verwiesen werden: Wer zu groß zum Scheitern ist, stellt auch ein zu großes Risiko dar. Doch diese Hoffnungen wurden zerschlagen, die Beharrungskräfte des Systems waren zu groß. Verluste wurden weiter sozialisiert und Risiken auf die Gemeinschaft abgewälzt, während Gewinne weiter privatisiert wurden. Durch das Internet schienen sich die genannten Prozesse eher noch weiter zu beschleunigen.
Ich hatte sehr zeitig Berührung mit dem Internet. In den 90ern beschäftigte ich mich mit elektronischer Musik und den zugehörigen elektronischen Instrumenten – meine erste Webseite, die ich auf dem damals populären kostenlosen Dienst für Webspace „Geocities“ im Jahr 1996 veröffentlichte, drehte sich um meine Musik. Eigentlich bin ich ganz froh, dass man diese Webseite nicht mehr findet, sie war der reinste Augenkrebs, mit Sternenhimmel-Hintergrundbild, blinkenden Symbolen und sich bewegendem Text. Ich studierte damals Informatik an der Fernuniversität Hagen – im Studium hatte man mit dem Internet noch keine Berührung – und arbeitete parallel dazu als Datenbankprogrammierer und Methoden- und Modelle-Spezialist in einer Versicherung. Ich programmierte zu dem Zeitpunkt Großrechner in COBOL, einer Programmiersprache aus den 60er Jahren. In der Versicherung spielten damals selbst PCs praktisch keine Rolle – erst recht nicht also das Internet. Ich hörte noch Ende der 90er Jahre vom Vertriebsvorstand meines Arbeitgebers das Argument, dass man niemals auf den Vertrieb im Internet setzen könne, da man ja die Makler nicht vor den Kopf stoßen wolle. Ich wollte aber mit der spannenden neuen Programmiersprache JAVA programmieren und mit und im Internet arbeiten, also verließ ich die Versicherung und wechselte nach der Jahrtausendumstellung im Jahre 2000 zu einer Internetagentur.
Damals im neuen Markt notiert, war mein Arbeitgeber im Jahr 2003 bereits insolvent. Es hatte sich gezeigt, dass reines Umsatz- und Personalwachstum auf Dauer nicht gutgehen konnte. Just in dieser Zeit platzte die Internetblase insgesamt. Auch damals war es für mich ein einmaliges Erlebnis, Teil des derartig rasanten Auf und Ab gewesen zu sein.
Und: Es ereignete sich der elfte September.
Unmittelbar nach dem Attentat brach das Internet zusammen. Buchstäblich keine Internetseite war mehr erreichbar. Informationen erreichten uns zur Arbeitszeit in der Agentur nur per Email, Radio und Fernseher. An produktive Arbeit war an jenem Tag nicht mehr zu denken. Am Nachmittag trafen wir uns alle im Besprechungsraum, vereint in unserer Fassungslosigkeit. Jemand vermutete, dass noch am Abend die US-amerikanischen Bomber aufsteigen und Afghanistan bombardieren würden. Es kam so, allerdings erst einige Monate später.
Wie tief diese Vorkommnisse unsere Welt, und auch gerade das Internet verändern würden, ahnten wir in diesen Tagen bereits. Auch wenn wir uns nicht vorstellen konnten, wie sehr. Und dass mal eine Bewegung entstehen würde, eine politische Partei, die zu einem guten Teil auf die damals eingeleiteten Veränderungen zurückzuführen ist, war nicht vorhersehbar.
Das Internet mit all seinen Facetten hatte mich in dieser Zeit gefangen genommen. Erst nebenberuflich und angestellt, später selbstständig war ich darin tätig, gleichzeitig spielte sich jedes meiner Hobbies dort ab. Ich lernte Menschen über das Internet kennen und lieben. Es wurde zu meinem Lebensraum.
Es entstanden neue Industrien, das Internet kollidierte mit einer alten Industrie nach der anderen – manche davon ging sang- und klanglos unter, wie beispielsweise die Reiseagenturen; andere stemmten sich lautstark dagegen, wie etwa die Medienbranche.
Anfang der Nuller Jahre machte das Schlagwort vom „Rechtsfreien Raum Internet“ die Runde. Das war so polemisch wie falsch: Schon damals war das Internet stärker reguliert als das physische Leben. Neben allen Gesetzen, die für alle gleichermaßen galten, gab es auch noch spezielle Regelungen für das Internet, beispielsweise das Telemediengesetz und die Impressumspflicht. Mit einer Fülle von Rechtsnormen konnte man als durchschnittlicher Internetbewohner auf einmal ungewollt Bekanntschaft machen: Wettbewerbsrecht, Abmahnungen, Markenrecht, Urheberrecht, Fragen des „geistigen Eigentums“. Ich erhielt als EBay-Nutzer, als Internet-Unternehmer, als Betreiber von Internetseiten zahllose Abmahnungen. Die ersten zwei davon habe ich bezahlt: Als EBay-Verkäufer hatte ich einmal kein Impressum angegeben, und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen meines Online-Shops waren fehlerhafte Klauseln, weil ich mir diese AGB – natürlich – irgendwo aus dem Internet kopiert hatte, so als Einzelunternehmer: Das war Lehrgeld, das ich zu bezahlen hatte.
Die Kosten dieser beiden Abmahnungen überstiegen meine damaligen Jahresgewinne bei weitem. Ich war nahe dran, meine Internet-Unternehmungen insgesamt aufzugeben. Diese Reaktion wäre sicher nachvollziehbar gewesen – doch welch einen Fehler hätte ich damit begangen, schließlich konnte ich einige Jahre später meine ganze Existenz darauf aufbauen. Viele andere kleine Internet-Gründer aber haben wegen Abmahnungen aufgegeben, dieser Hinweis sei mir als Anmerkung zur Innovationsfreundlichkeit und Gründerkultur in Deutschland erlaubt.
Die zahlreichen Abmahnungen, die ich danach erhielt, waren der erstarkenden Abmahnindustrie geschuldet. Rechtlich waren sie so verbindlich wie eine Bitte um Spenden, in der Szene wurden sie als anwaltliche Bettelbriefe bezeichnet. Ich erhielt eine Abmahnung des Rechtsvertreters eines verurteilten Mörders, der den Namen seines Klienten aus der Wikipedia entfernen wollte, die ich verlinkt hatte. Ich erhielt eine Abmahnung wegen des Bildes eines Turnschuhes, auf dem ein dem Adidas-Streifen ähnlicher Streifen gedruckt war, welches jemand in mein Kleinanzeigenprojekt hochgeladen hatte. Jemand beauftragte einen Anwalt, weil einer meiner Kunden einen zweizeiligen Reim von ihm geklaut haben sollte. All diese Anwälte ignorierten die Freistellung für fremde Inhalte, die das Telemediengesetz vorsieht – denn einer muss ja stets verantwortlich gemacht werden, bei uns in Deutschland. Und alles, was möglicherweise schiefgehen kann, muss vorher bedacht und geregelt sein.
Das „geistige Eigentum“ feierte Urständ. Das @Zeichen, der Buchstabe „D-“, der Begriff „Webspace“ galten als markenrechtlich geschützt und führten zu Abmahnwellen. Anwaltskanzleien sahen ihre Chance, und beschafften sich das Vertretungsrecht solchen Eigentums – dabei spielte es dann keine Rolle, ob es sich um Marken oder Medien wie Stadtpläne, Fotos, Filme oder Musik handelte, denn echte oder vermeintliche Rechtsverstöße fand man zuhauf per Suchmaschine im Internet. Die Umsätze einzelner Kanzleien mit Abmahnungen überschritten dreistellige Millionenbeträge.
Das deutsche Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht stammt aus einer Zeit, die ohne elektronische Medien auskam, die dadurch entstandenen Nutzungsveränderungen sind in diese Regeln größtenteils immer noch nicht eingearbeitet. Und in den Nuller Jahren wurde die Internetgemeinde immer verzweifelter, weil die Gesetzgebung und Politik die Notwendigkeit der Veränderung dieser Normen einfach nicht einsah.
2009
Rund um das Haus sind Regentonnen aufgestellt, denn Wasser ist knapp in dieser Ecke Italiens: Im Sommer versiegt die Quelle am Berg, die dem Haus ihr Frischwasser liefert. Dann ist man auf die Reserven in der Zisterne angewiesen, bis im Herbst die Regenzeit anfängt und die Quelle wieder zu sprudeln beginnt. Die Großeltern, stammend aus einer Generation, die zwei Kriege erlebt hatte, hamsterten daher Brauchwasser in Badewanne und Waschkübeln.
Die Regentonnen sollten den Garten über den Sommer bringen – denn auf seine geliebten Rosen wollte der alte Herr nicht verzichten. Die aber brauchen auch im trockenen Sommer ihr Wasser.
Als wir die ersten Jahre mit unseren Kindern die Ferien dort verbrachten, haben wir in Mückengitter vor den Fenstern investiert, denn die Regentonnen waren die reinsten Brutkästen für Mücken. Und so ist es auch dieses Jahr: Fiese winzige Mücken perforieren uns an Armen und Beinen.
Zensursula und Stasi 2.0
2009 erreichte die Verzweiflung der Internetgemeinde an der Ignoranz der Politik einen ersten Höhepunkt. Das Internet, so wurde es allseits dargestellt, war voll mit Kinderschändern, Vergewaltigern und Bombenlegern. Und damit endlich mal jemand an die Kinder denkt, kam die Idee eines Stoppschildes im Internet auf. Die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen, bald „Zensursula“ genannt, setzte sich an die Spitze einer Bewegung, die den Zugang zu Webseiten sperren wollte, von denen dokumentierter Kindesmissbrauch, vulgo: „Kinderpornografie“, verteilt wurde.
Das war nicht nur technischer Unsinn, weil diese Art Sperren bereits mit Windows-Bordmitteln einfach zu umgehen ist: Dies stellte ungefähr dieselbe Verhinderung von Straftaten dar wie die Absperrung durch ein rot-weißgestreiftes Flatterband. Die Seiteneffekte von „Overblocking“, also dem Risiko der Sperrung unbeteiligter Seiten, dem Entstehen einer Zensurinfrastruktur, die dann gewiss weitere Zensurbegehrlichkeiten wecken würde, bis hin zum Verhindern tatsächlicher Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch und deren Dokumentation sind da noch gar nicht berücksichtigt: Der Gesetzentwurf war nicht nur nutzlos, er war sogar ausgesprochen kontraproduktiv.
Die Politik ignorierte jedoch sämtliche Technikexperten. Sie stampfte gewissermaßen mit dem Fuß auf und sagte „Ich will aber“. Am technischen Lösungsversuch eines gesellschaftlichen Problems wurde unbeirrt festgehalten. Eine Tendenz, die man in den Folgejahren immer wieder beobachten konnte.
Das Gesetz nannte sich „Zugangserschwerungsgesetz“. Da offenbar auch den Politikern klar geworden war, dass der Zugang durch die von ihnen vorgesehenen Maßnahmen nicht zu verhindern war, dachte man sich diesen Neusprech-Namen aus. Auch das politisch motivierte, künstliche Beugen von Wortbedeutungen war ein typisches Vorgehen, welches die Antipathie, die Politikverdrossenheit vergrößerte.
Zur selben Zeit verschärfte sich die restriktive Innenpolitik weiter. Seit Ende 2007 gab es die Vorratsdatenspeicherung, für die der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble verantwortlich zeichnete. Sämtliche Verbindungdaten elektronischer Kommunikation wurden gespeichert, jeder Internetnutzer stand damit unter Generalverdacht. Schäubles Konterfei im schwarzweißen Scherenschnitt zierte die populären „Stasi 2.0“-Logo-T-Shirts. Zusammen mit dem gleichgestalteten „Zensursula“-Logo Ursula von der Leyens wurden sie zu den Icons der Netzbewegung, die sich zunehmend politisierte.
Internetkompetenz war in den etablierten Parteien absolute Fehlanzeige. Das begann schon auf der rein technischen Ebene: Keine Partei bot überhaupt Partizipationsmöglichkeiten im Internet an. Nicht einmal alle Informationen waren überhaupt online zu finden. Politiker wussten buchstäblich nicht, worüber sie sprachen: Wenn Interviewer Politiker nach der Bedeutung von Internetbegriffen wie „Browser“ fragten, war die Antwort immer ein garantierter Lacher.
Piraterie
Ab 2006 wurden weltweit Piratenparteien aufgebaut. Ausgehend von der Filesharing-Webseite „The Pirate Bay“ in Schweden, wo die erste Piratenpartei am 1. Januar 2006 entstand, folgten sukzessive Piratenparteien über den ganzen Globus. Am 10. September 2006 wurde die deutsche Piratenpartei in Berlin gegründet.
„Piraterie“, das war die diffamierende Bezeichnung der Medienindustrie für Urheberrechtsverletzungen durch das (unerlaubte) Verteilen digitaler Werke, dem „Filesharing“. Für viel Geld schaltete die Branche Kino- und Print-Kampagnen, welche Raubkopierer als ruchlose Verbrecher darstellen sollten. Dabei ist bereits der Begriff “Raubkopieren” schon ein Sprachmonster – Opfer eines Raubes, also einem mit körperlicher Gewalt verbundenen Überfall, werden durch die Gleichsetzung dieser Tat mit der unerlaubten Vervielfältigung eines digitalen Werkes verhöhnt. Wer in den Lauf einer Waffe geblickt hat, dürfte für diese Art der Dramatisierung wenig Verständnis haben. Dabei gab es eine Bezeichnung für die unerlaubte Vervielfältigung geschützter Werke – sie lautet “Urheberrechtsverletzung”. Aber das klang offenbar nicht bösartig genug.
Durch diese Kampagnen hatte die Medienindustrie es geschafft, dass Urheberrechtsverletzungen international ähnlich schwer mit Strafe bedroht wurden wie ein tatsächlicher Raub. Es war aus Strafgesichtspunkten sinnvoller, die gewünschte CD im Laden zu stehlen, als sie auf illegalem Weg zu kopieren – dies verdeutlicht die in diesem Punkt vorherrschende Hysterie. Urheberrechtsverstöße werden allerdings nur sehr selten strafrechtlich, sondern in aller Regel zivilrechtlich abgewickelt – also als Schadenersatzverfahren zwischen dem Rechtsverletzer und dem Rechteinhaber.
Das tatsächliche Problem für die Industrie bestand in der hohen Anzahl von Kopien durch die massenhafte Verbreitung im Internet. Jedoch reagierte sie lange Zeit nicht mit entsprechenden Angeboten, die es den Nutzern erlauben würde, den de-facto-Standard des Filesharings, oder später den des Streamings auf legale Weise auszuüben – stattdessen versuchte man, durch Medienkampagnen und Abmahnwellen Abschreckung zu verbreiten. Es mussten erst Unternehmen aus anderen Branchen kommen, um diese Angebote zu schaffen, wie damals Apple mit ihrem iTunes.
Genauso offensiv betrieb die Medienindustrie Lobbyismus und Politikerbeeinflussung – mündend in Gesetze, die die Rechte der Nutzer immer weiter einschränkten. Und wo das nicht gelang, wurde dem Nutzer die Abwesenheit seiner Rechte suggeriert. Dies übrigens so erfolgreich, dass selbst der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) unwidersprochen in einem Interview im November 2009 behauptete, es gäbe “kein Recht auf Privatkopie”. Damit liegt er nämlich falsch – dieses Recht gibt es sehr wohl, es findet sich in §53 des Urheberrechtsgesetzes. Zu seinen Gunsten könnte man annehmen, dass er das Gesetz tatsächlich nicht kannte – was allerdings auch ein Armutszeugnis für einen Kulturstaatsminister wäre. Er wäre damit jedenfalls nicht alleine, denn kaum jemand weiß, dass man von einer CD, die man regulär gekauft hat, selbstverständlich eine Kopie anfertigen kann und an einen Freund verschenken darf – ganz legal.
Für dieses Recht auf Privatkopie zahlt man sogenannte Urheberrechtsabgaben, zum Beispiel auf CD-Rohlinge, aber auch auf Drucker, Scanner, CD-Brenner und PCs. Warum es nicht gelingen soll, beispielsweise mit dieser Art von Abgaben Downloads und Filesharing-Angebote und dann später das Streaming zu legalisieren, konnte von der Rechteverwertungsindustrie niemand erklären.
Die Piraten nahmen die Diffamierung, die die Medienindustrie den Nutzern digitaler Medien pauschal verliehen hatte, auf und wollten sie ins Positive wenden: Denn immerhin denken viele Menschen dabei eher an die Piraten der Karibik und Johnny Depp als die vor der Küste von Somalia.
Die erste Eintrittswelle
Bis 2009 spielte die Piratenpartei noch keine nennenswerte Rolle, doch war sie tatsächlich die einzige Partei, der die Netzgemeinde Kompetenz in den Fragen von Überwachung und Zensur des Internets zutraute. In der Europawahl am 7. Juni 2009 erreichte sie mit 0,9% einen Achtungserfolg in Deutschland. Aus dem Gründungsland Schweden wurden sogar zwei Piraten in das Europaparlament entsendet, nachdem die Partei dort 7,1% erreicht hatte: Christian Engström und – nach einer Erweiterung des Parlaments – Amelia Andersdotter. Das war etwa die Zeit, in der ich auf die Piraten aufmerksam wurde.
Es war der Moment, in dem ich dachte, man kann nicht immer nur jammern, man muss auch vielleicht selbst etwas tun, wenn sich etwas ändern soll.
Und ich war nicht der einzige, der so dachte: Im Sommer 2009 stieg die Mitgliederzahl der Piratenpartei von unter 1000 auf über 15.000. Das ging an der Partei nicht spurlos vorbei: Lange Zeit wurde versucht, die Organisation mit den bisherigen Mitteln fortzuführen – doch dazu später mehr. Man könnte also letztlich sagen, dass die Piratenpartei ihren Durchbruch Ursula von der Leyen verdankt.
Ich stellte im Internet fest, dass es einen Kölner Stammtisch der Piraten gab. Am 5. Juli abonnierte ich die zugehörige Kölner Mailingliste, und ging an einem Montag im Juli 2009 auf den ersten politischen Stammtisch meines Lebens.
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld, genannt BüZe, ist Treffpunkt für Konzerte, Aufführungen und den Karneval im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Für etwa 15 Euro konnte man für einige Stunden einen größeren Besprechungsraum mieten, vorgesehen für vielleicht vierzig Personen.
Der Raum war brechend voll. Buchstäblich jeder Platz war besetzt. Von draußen nahm man einen Stuhl mit hinein und stellte ihn an eine freie Stelle, oder nahm gleich auf der Fensterbank Platz. Und von Woche zu Woche wurde der Raum voller. Bis Ende September waren bis zu 100 Personen anwesend, jede Woche dutzende neuer Gesichter, die ich zuvor noch nicht gesehen hatte.
Üblich war eine Vorstellungsrunde: Jeder sagte ein paar Worte zu seiner Person und zu seiner Motivation. Die wenigsten waren bereits Piratenparteimitglied, und niemand hatte Parteierfahrung. Manche erzählten von studentischen oder alternativen Politikhintergründen, aber die meisten Menschen waren wie ich auch aus Entsetzen über die Pläne zur Einführung einer Internetzensur hergekommen. Es dominierte schwarz: T-Shirts mit Bedruckung, Kapuzenpullover, bunte Haare und Pferdeschwänze. Aber: Es überwogen auch Männer. Sicher 90% der Anwesenden waren männlich.
Die, die ich als die Meinungsführer identifizierte, waren, so fand ich heraus, selbst auch erst ein paar Wochen länger als ich dabei: Dieser Stammtisch war überhaupt erst 2009 entstanden. Offenbar gab es bereits einmal einen gemeinsamen Köln-Bonner Piratenstammtisch bis 2008, der aber dann mangels Beteiligung eingeschlafen war.
Außerdem fand ich mich unmittelbar im Wahlkampf zur Bundestagswahl wieder. Ohne Umschweife konnte man an Infoständen teilnehmen, selbst wenn man noch keinerlei Erfahrung hatte. Plakate mussten aufgehängt werden. Gleichzeitig fragte man mich, ob ich nicht eine aktivere Rolle spielen wollte. Das schmeichelte mir damals sehr: Es blieb nicht das letzte Mal, dass mir eine solche Frage gestellt wurde.
Ich fühlte mich sehr wohl: Obwohl die unterschiedlichsten Persönlichkeiten anwesend waren und auch sehr viele Leute unterschiedlichen Alters, hatte man gleich das Gefühl, auf einer Wellenlänge zu liegen. Jeder hatte denselben Wert, man konnte direkt loslegen, mitreden und mitmachen. Ich dachte, wer mit demselben Hintergrund aus dem Internet kommt, müsste doch auch dasselbe Wertegerüst teilen. Welch ein Irrtum.
Im September füllte ich schließlich meinen Mitgliedsantrag aus. Am ersten Oktober 2009 erhielt ich die Bestätigung, mit der Mitgliedsnummer 8547 aufgenommen worden zu sein. Ich bekam eine Plastik-Mitgliedskarte, auf der aufgedruckt war:
"Der Besitzer dieses Dokuments ist berechtigt, sich seines Verstandes zu bedienen, Informationen zu produzieren, replizieren und konsumieren, sich frei und ohne Kontrolle zu entfalten – In Privatsphäre und Öffentlichkeit". Ich war jetzt auch offiziell Pirat.
Die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag fand am 27. September 2009 statt. Die Piratenpartei erzielte mit 2,0% einen weiteren Achtungserfolg. Sie war nun die „größte der kleinen“ Parteien. Sehnlichst wünschten wir uns in der Berichterstattung einen eigenen, orangenen Balken – doch das sollte noch zwei Jahre dauern. Und er war dann auch schnell wieder verschwunden.
Das stürmische Wachstum durch diese erste Eintrittswelle ebbte zwar ab, aber die nun zusammengefundenen Piraten hatten noch kein gemeinsames Programm und nur ein grobes Ziel: Die Freiheit des Internets. Und man kannte einander nicht – ein Umstand, der bei Personenwahlen immer wieder zu Problemen führen würde.
Mein erster Parteitag
Nach der Wahl ist vor der Wahl: Im Frühjahr 2010 sollte die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Natürlich wollten Piraten zu dieser Wahl ebenfalls antreten. Und so besuchte ich meinen ersten Landesparteitag der Piratenpartei: Am 7. und 8. November 2009 in Gelsenkirchen auf Schalke.
Der Piratenparteitag war für mich ein faszinierendes Ereignis: Wie ein Stammtisch, nur sehr viel größer, eine Art großes Klassentreffen von Leuten, die man sonst allenfalls über das Internet kannte, und nur zu solchen Gelegenheiten überhaupt im „echten Leben“ persönlich treffen konnte. Die Beschäftigung mit Anträgen oder innerparteilichen Wahlen war oft nur Nebensache.
Ich lernte die Rituale eines Parteitages kennen: Wahlen zur Versammlungsleitung, Geschäftsordnungsanträge, die man mit zwei erhobenen Armen anzeigte, Rednerschlangen mit Argumenten, die sich endlos wiederholten, Anträge auf Begrenzung der Redezeit, Schließung der Redeliste und Formale Gegenrede. Ritualhafte Fragen, ob die Kandidaten einer Wahl genug Zeit gehabt hatten, sich der Versammlung vorzustellen, weil irgendjemand gehört hatte, zu wenig Zeit zur Vorstellung zu geben wäre später ein Anfechtungsgrund. Parteitage waren unfassbar chaotisch und bisweilen unfassbar komisch, größtenteils unstrukturiert, die Teilnehmer unvorbereitet. Da es kein Delegiertensystem gibt, konnte jeder zu einem Parteitag kommen und direkt mitbestimmen. Das führte dazu, dass eine gewisse Zeit- und Geldelite sich die Freiheit nehmen konnte, zu Parteitagen zu fahren – und eine Handvoll komischer Kauze, die zur allgemeinen Erheiterung oder zur allgemeinen Entrüstung immer wieder auftauchten und für alle möglichen Positionen kandidierten.
Besonders faszinierte mich jedoch auf meinem ersten Parteitag Twitter: Neben der Debatte, der Rede und Widerrede an den Mikrophonen im Saal entspann sich eine zweite, vielstimmige, unsichtbare Debatte auf Twitter. Unter dem Hashtag #LMVNRW (für Landesmitgliederversammlung Nordrhein-Westfalen) diskutierten An- und Abwesende über den Parteitag, über Anträge, Kandidaten und Redebeiträge. Dabei ging es in den 140 Zeichen eines Tweets oft sehr viel schärfer, pointierter und polarisierender zur Sache. Da war plötzlich eine zweite, unsichtbare, elektronische Diskussionsebene neben der öffentlichen.
Twitter, der elektronische Kurznachrichtendienst, war in den ersten Jahren eine Piratendomäne: Die meisten deutschsprachigen politischen Tweets kamen von Piraten. In ganz kurzer Zeit konnten so relevante Informationen innerhalb der Piratenblase unter den Nutzern, die einander folgten, verteilt werden. Und auch nicht ganz so relevante Nachrichten: Katzenbilder und dumme Sprüche, Aufreger und Gerüchte. Geteilt wurde, was emotional ansprach: Und so ist Twitter bis heute der ideale Empörungsverstärker.
Ein „Shitstorm“ ist ein Hagel von negativen Nachrichten, der sich anlässlich eines solchen Aufregers über jemanden ergießen kann – ich selbst habe mehr als einen Shitstorm abbekommen. Die Zeichenbegrenzung auf 140 Zeichen bei einem Tweet sorgt dafür, dass alle Aussagen immer schlagzeilenartig verschärft werden müssen, und der Kontext eines Tweets geht beim Weiterverteilen verloren. Zwischentöne können nicht transportiert werden – Tweets können gründlich missverstanden werden. Twitter ist daher für Diskussionen gänzlich ungeeignet, dennoch probiert man es immer wieder.
Ich las die Nachrichten mit, die mit dem Parteitags-Hashtag gekennzeichnet waren, war angefixt, und richtete mir einen politischen Twitter-Account ein: @netnrd





























