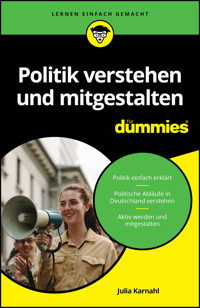
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Mitdenken, Mitreden, Mitgestalten – so funktioniert Politik
Kann man Demokratie messen? Was ist Populismus? Und was bedeutet das Widerstandsrecht? Diese und alle anderen Fragen rund um Politik in Deutschland beantwortet dieses Buch. Julia Karnahl erklärt, warum Politik alle angeht. Ihr erfahrt, wie die politische Macht verteilt wird, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie wichtig internationale Bündnisse für Deutschland sind. Außerdem lernt ihr, welche Möglichkeiten ihr habt, mitzugestalten: ob bei Wahlen, in Parteien oder Jugendparlamenten, über Bürgerbegehren oder Petitionen oder auch durch politischen Protest.
Ihr erfahrt
- Was im Grundgesetz steht und warum das so wichtig ist
- Wie Gesetze in den Ländern, im Bund und in Europa entstehen
- Wofür die verschiedenen Parteien stehen
- Wie ihr auf viele verschiedene Arten politisch aktiv werden könnt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Politik verstehen und mitgestalten für Dummies
Schummelseite
DAS POLITISCHE SYSTEM DEMOKRATIE
Politik bedeutet, dass eine Gemeinschaft sich Regeln gibt.
Es gibt verschiedene politische Systeme, die sich dadurch unterscheiden, wie die Macht verteilt ist.
In einer Demokratie geht die Macht vom Volk aus. Das zeichnet moderne Demokratien aus:
PartizipationRepräsentationPluralismusGrundrechteRechtsstaatlichkeitGewaltenteilungDAS GRUNDGESETZ
Das politische System Deutschlands ist im Grundgesetz festgehalten. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und wurde 1949 verabschiedet. Das sind die wichtigsten Elemente des Grundgesetzes:
Grundrechte: unter anderem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Freiheit, auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Gleichberechtigung, auf Glaubensfreiheit, auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auf Berufsfreiheit, auf Eigentum und auf AsylDeutschland ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat und ein Bundesstaat, der in mehrere Bundesländer aufgeteilt ist.DIE GEWALTENTEILUNG
Die Gewaltenteilung ist eine der wichtigsten Grundsäulen unserer Demokratie. Die Staatsgewalt wird nicht von einer Institution ausgeübt, die diese Macht missbrauchen könnte, sondern auf verschiedene Gewalten aufgeteilt, die sich gegenseitig kontrollieren:
Bundestag und Bundesrat sind die Legislative: Sie machen die Gesetze.Die Bundesregierung und die Verwaltung sind die Exekutive: Sie führen die Gesetze aus.Das Bundesverfassungsgericht und die weiteren Gerichte sind die Legislative: Sie legen die Gesetze aus und sprechen Recht.SO KÖNNT IHR EUCH EINBRINGEN
Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ihr euch mit euren Ideen und Vorstellungen einbringen könnt:
Wahlen: Repräsentation bedeutet, dass die Bürger Politiker und Parteien wählen, die ihre Interessen vertreten, also an ihrer Stelle politische Entscheidungen treffen.Direkte Demokratie: zum Beispiel Volksbefragung, Volksbegehren, Volksentscheid, BürgerrätePetitionenAustausch mit Politikern: zum Beispiel Bürgersprechstunden, Bürgerdialoge, EinwohneranfragenEngagement in einer ParteiEngagement in Vereinen, Verbänden, BewegungenPolitischer Protest: zum Beispiel Demonstrationen, Aktionen, Boykott, Streik, ziviler Ungehorsam
Politik verstehen und mitgestalten für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverillustration: Jacob Lund - stock.adobe.comKorrektur: Geesche Kieckbusch
Print ISBN: 978-3-527-72193-1ePub ISBN: 978-3-527-84767-9
Über die Autorin
Politik hat Julia Karnahl schon immer interessiert. Sie fand es spannend, verschiedene politische Ideen kennenzulernen und darüber nachzudenken: Welche Vorstellungen hatten die Menschen früher und wozu hat das geführt? Nach welchen politischen Werten leben wir heute? Und welche Zukunftsvisionen haben wir? Sie hat auch immer gerne mit anderen darüber diskutiert und manchmal gestritten, wie die Gesellschaft aussehen sollte, in der wir leben.
Nach der Schule hat die Autorin Politikwissenschaften studiert, dazu Literatur und Theaterwissenschaften. Während des Studiums hat sie zum einen journalistisch gearbeitet, zum anderen im Bereich Verlag und Sachbuch.
Als sie mit der Uni fertig war, ist sie zur Jugendzeitschrift SPIESSER gegangen und hat dort erst den Bereich Gesellschaft und Politik, dann die ganze Redaktion verantwortet.
Später hat Julia Karnahl lange bei der Kinder- und Jugendkommunikationsagentur jungvornweg gearbeitet. Dort war sie für den Bereich politische Bildung verantwortlich. Unter anderem hat sie die Jugendseite des Deutschen Bundestages mitmischen.de und die Social-Media-Kommunikation der Berliner Landeszentrale für politische Bildung umgesetzt.
Jetzt arbeitet sie bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und entwickelt dort den Bereich Demokratieförderung mit weiter.
Sie ist absolut überzeugt davon, dass wir Menschen am glücklichsten sind, wenn wir unser Leben und unser Umfeld aktiv mitgestalten. Dazu möchte sie ermutigen. Deshalb hat sie dieses Buch geschrieben. Weil sie glaubt, dass es wichtig ist, dass möglichst alle Menschen verstehen, wie Politik funktioniert, und vor allem auch erkennen, wie sie daran teilhaben und sich einbringen können.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Konventionen in diesem Buch
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Was ihr nicht lesen müsst
Wie es weitergeht
Teil I: Politik und Demokratie – von Macht, Fairness und Selbstbestimmung
Kapitel 1: Was genau ist eigentlich Politik?
Jede Gemeinschaft muss sich Regeln geben
Wie die Macht verteilt wird
Warum es Staaten gibt
Kapitel 2: Was eine Demokratie ausmacht
Im Kern geht es um Selbstbestimmung
Freiheit, Fairness, Raum zum Mitmachen: Demokratie-Basics
Warum es so wichtig ist, Minderheiten zu schützen
Kann man Demokratie messen?
Das ist keine Demokratie – von Diktatur bis Anarchie
Aktuelle Herausforderungen für die Demokratie
Kapitel 3: Demokratie in Deutschland: Das Grundgesetz legt das Wichtigste fest
»Nie wieder«: Warum es das Grundgesetz gibt
Die Würde des Menschen ist unantastbar – was bedeutet das?
Gleiche Rechte für alle
Deutschland: demokratisch, sozial, föderalistisch
Darf das Grundgesetz verändert werden?
Wächter über das Grundgesetz: Das Bundesverfassungsgericht
Kapitel 4: Wer was bestimmt: Die drei Gewalten
Gesetze machen: Bundestag und Bundesrat
Gesetze ausführen: Bundesregierung und Verwaltung
Recht sprechen: Die Gerichte
Und wozu gibt es einen Bundespräsidenten?
Teil II: Kompromisse finden – wie viel Streit gut ist
Kapitel 5: Viele Interessen, viel Konfliktpotenzial
Von links nach rechts: Das politische Meinungsspektrum
Die Parteien und wofür sie stehen
Verband, Gewerkschaft, NGO: Andere Interessensvertretungen
Wer wie Einfluss auf Entscheidungen nimmt
Kapitel 6: Zusammen ist man stärker: Koalitionen
Mehrheiten finden, um entscheiden zu können
Fluch und Segen von Koalitionen
Ohne Mehrheit regieren: Die Minderheitsregierung
Kapitel 7: Aus Prinzip dagegen? Die Opposition
Oberstes Ziel: Die Regierung kontrollieren
Wie viel Macht hat die Opposition wirklich?
Kapitel 8: Wir müssen reden: Debattenkultur
Jeder darf seine Meinung sagen – aber zivilisiert
Meinungsfreiheit hat Grenzen
Debatten im Parlament
Kapitel 9: Welche Rolle Medien und Öffentlichkeit spielen
Warum Medienvielfalt wichtig ist für die Demokratie
Vom wachsenden Misstrauen gegenüber den Medien
Politische Diskussionen in den sozialen Medien
Teil III: Regeln, die für alle gelten – so entstehen Gesetze
Kapitel 10: Regeln für Deutschland, die Bundesländer und die Kommunen
Was der Bund und was die Länder entscheiden
Wie die Bundesländer organisiert sind
Was die Kommunen entscheiden dürfen
Kapitel 11: Der Weg eines Gesetzes
Wer an der Gesetzgebung beteiligt ist
Die Ursprungsidee: Der Gesetzentwurf
Vom Entwurf bis zur Abstimmung: Was im Bundestag passiert
Letzte Schritte bis zum fertigen Gesetz
Kapitel 12: Deutschland im Kontext der Weltpolitik
Warum internationale Bündnisse deutsche Politik so stark prägen
Deutschland und Europa
Globale Bündnisse: UNO, NATO & Co.
Teil IV: Eure Stimme zählt – wie ihr euch einbringen könnt
Kapitel 13: Wer wählen darf und was das bringt
Das Prinzip Repräsentation
Wie Parlamentswahlen funktionieren
Wer darf wählen?
Wer darf gewählt werden?
Große Entscheidung: Unterschiedliches Wahlverhalten
Warum Menschen nicht wählen gehen
Kapitel 14: Partizipation: Möglichkeiten, gehört zu werden
Partizipation bedeutet Mitmachen
Mit Politikern sprechen
Eine Idee, viele Unterstützer: Petitionen
Direkte Demokratie in Deutschland
Beteiligungsmöglichkeiten speziell für junge Menschen
Kapitel 15: Politisches Engagement, mit oder ohne Partei
Einer Partei beitreten – gar kein so großer Schritt
Ju+: Die Jugendorganisationen der Parteien
Vereine, Verbände, Bewegungen: Wo ihr euch noch engagieren könnt
Kapitel 16: Protest ist auch politisches Verhalten
Demo, Streik, Aktion: Formen des Protests
Was kann Protest bewirken?
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 17: Zehn dumme Sätze über Politik
Politiker sind faul und korrupt
Politik wird von alten weißen Männern gemacht
Bundestagsdebatten sind nur Show
Die etablierten Parteien sind sich so ähnlich, dass es egal ist, wen man wählt
Der Staatsapparat schluckt nur sinnlos viel Geld
Die großen politischen Entscheidungen haben nichts mit meinem Leben zu tun
Der Bundestag hat keine echte Macht, alle Entscheidungen kommen von der Regierung
Die Medien sind nicht wirklich kritisch, sondern geben nur die Meinung der politischen Elite wieder
Deutschland ist keine echte Demokratie, der Wille des Volkes zählt nichts
Ich kann sowieso nichts ändern
Kapitel 18: Zehn gute Fragen an Politiker
Was empfinden Sie derzeit als größte Herausforderung für Deutschland?
Wie sind Sie auf Social Media aktiv?
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, politisch aktiv zu werden?
Welche politische Entscheidung haben Sie bereut?
Mit wem würden Sie gerne mal politisch streiten und warum?
Was belastet Sie an Ihrem Beruf am meisten?
Was sollte sich in den nächsten 20 Jahren in Deutschland unbedingt ändern?
Was tun Sie konkret für junge Menschen?
Wer inspiriert Sie?
Was möchten Sie von mir wissen?
Kapitel 19: Zehn streitbare Zukunftsideen für Politik in Deutschland
»Smart Governance«
»Experimentelles Regieren«
»Humble Government«
Politiker per Los
»Monitorial Citizenship«
Bedingungsloses Grundeinkommen
Verpflichtendes demokratisches Jahr
Wählen ab 14
Ordentlich streiten lernen
Digitale Abstimmungen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Staats- und Herrschaftsformen
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Die sogenannte Ewigkeitsklausel legt fest, welche Teile des Grund...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Die drei Gewalten in Deutschland
Abbildung 4.2: So entsteht der Bundeshaushalt
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Der Bund ist zum Beispiel für Außenpolitik und Staatsangehörigke...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Diese Schritte durchläuft ein Gesetz
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Die Institutionen der Europäischen Union
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Mit der Erststimme wählen die Bürger bei der Bundestagswahl eine...
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Das passiert mit einer Petition, nachdem der Petent sie beim Bun...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
216
217
218
219
221
222
223
224
225
Einleitung
Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich über jeden, der dieses Buch liest. Nicht weil ich es geschrieben habe, sondern weil ich es wirklich wichtig finde zu verstehen, wie politische Entscheidungen zustande kommen – denn erst dann kann man sie beurteilen und mitgestalten. Diese kurze Einführung gibt euch einen Überblick über Politik verstehen und mitgestalten für Dummies. Ich erkläre darin, was das Buch ausmacht, wer es lesen sollte, wie es aufgebaut ist und welche Themenschwerpunkte es enthält. Außerdem erläutere ich die Symbole, die immer wieder auftauchen, und verrate euch, was ihr beim Lesen auch weglassen könnt, wenn ihr nur die Basics wollt.
Über dieses Buch
In diesem Buch möchte ich im Wesentlichen drei Dinge tun:
Ich möchte kurz, pointiert und für jeden verständlich erklären, wie Politik in Deutschland funktioniert: wie Entscheidungen entstehen, wer sie wie beeinflusst, wie wir sicherstellen, dass niemand seine Macht missbraucht.
Ich möchte klar aufzeigen, warum es eine gute Sache ist, dass wir in einer Demokratie leben, und erläutern, warum die Demokratie es aktuell nicht leicht hat und was wir tun können, um sie zu stärken.
Ich möchte viele ganz unterschiedliche Möglichkeiten beschreiben, wie ihr politisch aktiv werden und eure Interessen vertreten könnt.
Törichte Annahmen über die Leser
Ich nehme an und hoffe, dass ihr
junge Menschen seid, die sich für das, was um sie herum passiert, interessieren.
verstehen möchtet, wie die Regeln, die für uns alle gelten, zustande kommen.
euch auf der Basis von Informationen eine eigene Meinung zu aktuellen politischen Geschehnissen bilden wollt.
vielleicht schon politisch aktiv seid oder es werden wollt und euch für verschiedene Möglichkeiten der Partizipation interessiert – spätestens nachdem ihr das Buch gelesen habt.
Konventionen in diesem Buch
Was mir noch wichtig ist: Normalerweise gendere ich, wenn ich schreibe. Da das in den Dummies-Büchern nicht üblich ist, benutze ich in diesem Buch die männliche Form – sowohl im Singular als auch im Plural –, auch wenn ich beide Geschlechter meine. Wenn ich also schreibe »der Bundeskanzler«, dann kann das selbstverständlich genauso gut eine Bundeskanzlerin sein. Und wenn ich »die Politiker« schreibe, meine ich auf jeden Fall »die Politikerinnen und Politiker«.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Die folgenden Symbole werden euch im Buch immer wieder begegnen. Dahinter verbergen sich ergänzende Informationen zu dem Thema, um das es gerade geht:
Hier beleuchte ich einen interessanten Nebenaspekt eines Themas noch mal genauer.
Hier belege ich eine Information mit einem konkreten Beispiel, damit ihr euch besser vorstellen könnt, worum es geht.
Hier greife ich häufige oder wichtige Fragen zu einem Thema auf und beantworte sie kurz.
Hier warne ich vor häufigen Missverständnissen oder übereilten Fehlschlüssen zu einem Thema.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Politik verstehen und mitgestalten für Dummies besteht aus vier Teilen zu vier verschiedenen großen Themenschwerpunkten und den Top-Ten-Listen. Die Teile sind jeweils in Kapitel und die wiederum in Abschnitte unterteilt. Am Anfang jedes Kapitels steht eine ganz kurze Einführung, damit ihr wisst, was euch erwartet. Ihr könnt jedes Kapitel für sich lesen, dafür braucht ihr kein Vorwissen aus den vorherigen Kapiteln.
Teil I: Politik und Demokratie – von Macht, Fairness und Selbstbestimmung
Im ersten Teil erfahrt ihr, was Politik eigentlich bedeutet und welche unterschiedlichen politischen Systeme es gibt. Der Schwerpunkt liegt auf der Demokratie. Ich grenze sie von anderen Herrschaftsformen ab und erkläre ihre Besonderheiten. Anschließend geht es um die Geschichte und die Inhalte des Grundgesetzes, das unser politisches System definiert. Zum Schluss werden die drei Gewalten vorgestellt, auf die die Staatsgewalt in Deutschland aufgeteilt ist: Legislative, Exekutive und Judikative.
Teil II: Kompromisse finden – wie viel Streit gut ist
Ein wichtiger Aspekt von Demokratie ist Pluralität: das Nebeneinander, der faire Wettstreit von unterschiedlichen politischen Meinungen. In diesem Teil geht es darum, was Debattenkultur bedeutet und wie das politische Meinungsspektrum von links bis rechts aussieht, welche Parteien wofür stehen und welche Institutionen neben Parteien Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Es geht darum, warum Parteien sich zu Koalitionen zusammenschließen, welche Rolle die Opposition im politischen Betrieb spielt und welche die Medien.
Teil III: Regeln, die für alle gelten – so entstehen Gesetze
In diesem Teil geht es darum, wie unsere Gesetze entstehen. Ich erkläre, was auf Bundes- und was auf Länderebene entschieden wird und was jede Kommune für sich selbst festlegen darf. Den Weg eines Gesetzes auf Bundesebene zeichne ich Schritt für Schritt nach. Und schließlich geht es um die wichtigsten internationalen Bündnisse, denen Deutschland angehört und deren Grundsätze und Vereinbarungen auch eine wichtige Rolle spielen, wenn in Deutschland Entscheidungen getroffen werden.
Teil IV: Eure Stimme zählt – wie ihr euch einbringen könnt
Der vierte Teil dreht sich um die vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich politisch einzubringen. Es geht um Wahlen, um Petitionen, um Formate, bei denen man mit Politikern direkt ins Gespräch kommen kann, und um Elemente der direkten Demokratie in Deutschland. Es geht um das Engagement innerhalb einer Partei oder in Vereinen, Verbänden und Bewegungen. Schließlich geht es um verschiedene Protestformen und die Frage, was sie bewirken können.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Im letzten Teil gibt es drei Listen, die zum Weiterdenken, zum Diskutieren und Handeln anregen sollen. Ihr findet hier: 10 dumme Sätze über Politik, 10 gute Fragen an Politiker und 10 Zukunftsideen für Politik in Deutschland.
Was ihr nicht lesen müsst
Politik verstehen und mitgestalten für Dummies ist modular aufgebaut. Das heißt, ihr müsst es nicht von vorne bis hinten am Stück durchlesen, sondern ihr könnt euch auch einzelne Kapitel herauspicken, die euch gerade besonders interessieren, und sie einzeln lesen. Innerhalb der Kapitel findet ihr die wichtigsten Informationen im Haupttext, in den Kästen findet ihr Vertiefungen zu einzelnen Aspekten des Themas, die ihr auch weglassen könnt, wenn es euch nur um die grundlegenden Fakten geht.
Wie es weitergeht
Weiter geht es direkt mit der ganz großen Frage: Was ist Politik? Kleiner Spoiler: Eigentlich ist (fast) alles Politik. Welche Fragen sich daraus ergeben und wie sich aus den Antworten unterschiedliche politische Systeme herausbilden, das folgt auf den nächsten Seiten.
Viel Spaß beim Lesen, beim Mitdenken, gerne auch beim innerlichen Widersprechen, wenn ihr etwas anders seht, und vor allem beim Entwickeln von eigenen Meinungen und Ideen!
Teil I
Politik und Demokratie – von Macht, Fairness und Selbstbestimmung
IN DIESEM TEIL …
Warum eigentlich alles Politik istWas eine Demokratie ausmachtWelche anderen Staatsformen es gibtWas im Grundgesetz steht und warum das so wichtig istDie Rolle von Bundestag und Bundesrat, Bundesregierung und Verwaltung, Gerichten und des BundespräsidentenKapitel 1
Was genau ist eigentlich Politik?
IN DIESEM KAPITEL
Verbindliche Entscheidungen für eine GemeinschaftWas politisch und was privat istVerschiedene politische SystemeDie Idee des StaatsPolitik bedeutet im Prinzip einfach, dass eine Gruppe von Menschen Entscheidungen trifft, die für eine ganze Gemeinschaft gelten. Wer zu dieser Gruppe von Entscheidern gehört, mit welchen Fragen sie sich beschäftigt und wie ihre Entscheidungen zustande kommen, das kann sich natürlich sehr stark unterscheiden.
Jede Gemeinschaft muss sich Regeln geben
Wir Menschen sind grundsätzlich soziale Wesen. Wir könnten nicht gut ganz allein als einzelne Person überleben. Deshalb tun wir uns in Gruppen zusammen, in Gemeinschaften.
Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Gemeinschaften: kleine und große, informelle und sehr formelle, solche, die durch äußere Gründe entstehen, und solche, die freiwillig gewählt werden, weil man zum Beispiel ähnliche Interessen hat.
Eine Schulklasse ist eine Gemeinschaft. Eine ganze Schule ist eine etwas größere Gemeinschaft. Es gibt Interessensgemeinschaften wie Sportgruppen und Vereine. Es gibt Gemeinschaften, die sich dadurch begründen, dass man zusammen wohnt: in einer Wohngemeinschaft, in einem Haus, in einem Stadtteil. Es gibt aber auch Gemeinschaften, die über die ganze Welt verteilt sind, zum Beispiel Religionsgemeinschaften.
Jede Gemeinschaft hat Regeln, an die die Mitglieder der Gemeinschaft sich halten sollen. Diese Regeln definieren, wie die Menschen in dieser Gemeinschaft miteinander umgehen wollen, was sie gut finden und was sie nicht möchten. Wenn jemand gegen die Regeln verstößt, hat das Konsequenzen: Er muss sich vor der Gemeinschaft rechtfertigen und wird im Zweifel bestraft.
Kleine Gemeinschaften haben oft weniger feste Regeln, weil ihre Mitglieder sich gut kennen und einander vertrauen. Außerdem können sie Konflikte besser direkt miteinander lösen. Je größer eine Gemeinschaft ist, desto mehr Regeln muss sie festlegen, weil sie nicht jeden Streitfall mit allen Mitgliedern der Gemeinschaft einzeln besprechen kann.
Im Rahmen ihrer Regeln trifft die Gemeinschaft auch Entscheidungen, die verbindlich für alle gelten: Die Schulklasse entscheidet, wo der nächste Klassenausflug hingeht. Die Hausgemeinschaft entscheidet, ob in den Garten ein Trampolin oder ein Gemüsebeet kommt. Der Sportverein entscheidet, ob es ein großes Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier gibt.
Politische Entscheidungen werden in ganz unterschiedlichen Bereichen getroffen. Deshalb spricht man von Politikfeldern. Die Entscheidungen werden nach Themenfeldern zusammengelegt, sodass diejenigen, die sie treffen, Expertise in diesem Bereich aufbauen können.
In einer Abschlussklasse gibt es oft verschiedene Arbeitsgruppen: Manche kümmern sich um die Finanzierung der Abschlussfeier, andere um die Organisation der Abschlussfahrt, wieder andere um das Entstehen einer Abschlusszeitung.
Einige Beispiele für Politikfelder auf Länderebene sind:
Bildungspolitik: Bildungspolitiker entscheiden darüber, wie Schüler lernen sollen. Sie legen unter anderem fest, welche Schulformen es gibt, wie die Lehrpläne ausgestaltet sind und wie die Abschlussprüfungen aussehen.
Familienpolitik: Familienpolitiker denken darüber nach, wie Familien vom Staat unterstützt werden können, welche Ansprüche sie zum Beispiel auf Kinderbetreuung und finanzielle Hilfen haben.
Umweltpolitik: Umweltpolitiker entscheiden unter anderem, wie Tiere geschützt werden, was der Staat gegen den Klimawandel unternimmt und an welche Regeln sich Unternehmen halten müssen, um die Umwelt zu schützen.
Außenpolitik: Außenpolitiker beschäftigen sich damit, welchen Kontakt das Land zu anderen Ländern hat, mit wem zum Beispiel welche gegenseitigen Absprachen zu Themen wie Handel oder Einreise getroffen werden.
Das Gegenteil von politisch ist privat
Private Entscheidungen gelten nicht für eine ganze Gruppe, sondern nur für den Einzelnen selbst. Ob ihr ein Müsli oder ein Brötchen frühstückt, ist eure private Entscheidung. Welche Musik ihr hört, was ihr anzieht, ob ihr in eurer Freizeit Volleyball, Geige oder Computerspiele spielt – alles private Entscheidungen, solange sie andere Menschen nicht einschränken.
Das ist übrigens ein typisches Merkmal von Diktaturen: Sie greifen massiv in die Privatsphäre der Menschen ein. Sie schreiben vor, welche Medien ihre Bürger nutzen, wie sie ihre Kinder erziehen, worüber sie reden und mit wem sie eine Beziehung haben dürfen.
Wie die Macht verteilt wird
Die spannenden Fragen sind jetzt natürlich:
Wer legt die Regeln fest? Wer trifft Entscheidungen?
Wer hat das Recht, sie durchzusetzen und im Zweifel diejenigen zu bestrafen, die sich nicht daran halten?
Wer diese Rechte hat, hat Macht. Und wer diese Macht in einer Gemeinschaft hat, das legt die jeweilige Verfassung fest, die die Gemeinschaft sich gegeben hat.
Beispiel Klassenausflug: Vielleicht bestimmt der Lehrer, wo es hingeht. Vielleicht macht er aber auch eine Umfrage unter den Schülern. Oder er überlässt die Entscheidung den gewählten Klassensprechern.
Ein politisches System ist die Summe aller staatlichen und außerstaatlichen Institutionen und Akteure, Regeln und Prozesse, die das Zusammenleben strukturieren.
Wenn wir an den Begriff politisches System denken, meinen wir damit in der Regel, wie ein Staat aufgestellt ist. Dafür gibt es erst mal zwei wichtige Aspekte:
Die
Staatsform
legt fest, wie das Staatsoberhaupt bestimmt wird.
Die
Herrschaftsform
legt fest, wer die Entscheidungsgewalt hat.
Diese beiden Staatsformen gibt es:
Monarchie
:
In den meisten Monarchien wird das Staatsoberhaupt durch seine Geburt bestimmt: Es gibt eine Königsfamilie und das älteste Kind dieser Familie wird jeweils das nächste Staatsoberhaupt. Deutlich seltener ist die Wahlmonarchie, bei der der Monarch gewählt wird.
Republik: In einer Republik entscheidet eine Gruppe von Menschen, wer das nächste Staatsoberhaupt ist.
Eine Republik ist nicht automatisch demokratisch. Das Staatsoberhaupt kann in freien Wahlen vom Volk gewählt werden, das muss aber nicht so sein. Es gibt auch Republiken, in denen eine kleine privilegierte Gruppe von Menschen bestimmt, wer an die Macht kommt.
Der zweite wichtige Punkt ist die Herrschaftsform, auch Regierungsform genannt. Grob kann man diese beiden Regierungsformen unterscheiden:
Demokratie
:
In einer Demokratie entscheidet das Volk, also die ganze Gemeinschaft.
Diktatur
:
In einer Diktatur trifft eine Person oder eine kleine Gruppe von Menschen (etwa eine Partei oder das Militär) die Entscheidungen alleine.
Abbildung 1.1 zeigt verschiedene politische Systeme auf.
Abbildung 1.1: Staats- und Herrschaftsformen
Bei all diesen Systemen gibt es eine große Bandbreite an Spielarten, wie sie kombiniert und wie sie genau ausgeformt sein können. (Mehr dazu lest ihr in Kapitel 2 »Was eine Demokratie ausmacht«.)
Die meisten Länder haben eine Verfassung, in der (unter anderem) festgehalten ist, nach welchem politischen System sie funktionieren, in welcher Staatsform sie verfasst sind. (Mehr zur deutschen Verfassung lest ihr in Kapitel 3 »Demokratie in Deutschland: Das Grundgesetz legt das Wichtigste fest«.)
In Deutschland werden Entscheidungen auf kommunaler Ebene oft anders getroffen als Entscheidungen, die für ganz Deutschland gelten. Und auch die Bundesländer haben unterschiedliche Systeme – deshalb haben sie auch eigene Verfassungen. Trotzdem ist Deutschland insgesamt eine demokratische Republik, und diese Struktur muss sich auf allen Ebenen widerspiegeln.
Warum es Staaten gibt
Ein Staat ist im Prinzip eine politische Einheit. Er bezeichnet einen Raum, in dem Menschen als Gemeinschaft unter bestimmten Regeln zusammenleben.
Ein Staat, wie wir ihn heute verstehen, hat diese drei Elemente:
Das
Staatsgebiet
beschreibt das Territorium, auf das sich der Staat erstreckt.
Das
Staatsvolk
ist die Summe der Menschen, die in dem Staat leben.
Staatsgewalt bedeutet, dass der Staat das Gewaltmonopol hat.
Was genau bedeutet es, dass der Staat das Gewaltmonopol hat? Das heißt, nur die staatlichen Institutionen dürfen Menschen zu etwas zwingen: Sie können ihnen eine bestimmte Schule zuweisen, sie können sie dazu verpflichten, Steuern zu bezahlen, sie können sie auch ins Gefängnis stecken, wenn sie gegen die Regeln verstoßen haben.
Verschiedene Staatsbegriffe
Wenn wir Staat sagen, meinen wir heute Nationalstaat. Ein Nationalstaat ist ein Staat, in dem die Nation, also die Gemeinschaft, das Volk auf dem Gebiet des Staates zusammenlebt. Diese Idee ist aber noch gar nicht so alt. Sie entwickelte sich vor etwa 200 Jahren.
Davor gab es häufig reine Territorialstaaten. Das heißt, es gab ein Staatsoberhaupt, zum Beispiel einen Fürsten, der ein bestimmtes Gebiet für sich beanspruchte und die Menschen, die darauf lebten, beherrschte. Diese Menschen bildeten aber keine ethnische Gemeinschaft. Sie gehörten oft unterschiedlichen Gruppen an, die sich nicht zusammengehörig fühlten.
Daneben gab es auch Stammesstaaten, in denen sich der Herrschaftsanspruch des Oberhauptes nicht auf ein Territorium, sondern auf eine bestimmte Personengruppe, einen Stamm zum Beispiel, richtete, unabhängig davon, wo diese Personen angesiedelt waren.
Die Gebiete der verschiedenen Staaten sind heute sehr klar abgesteckt. Man kann sie auf Landkarten genau nachvollziehen, oft sind sie auch durch sichtbare Grenzen markiert.
Warum werden manche Staaten von anderen nicht anerkannt?
Zu solchen Situationen kommt es, wenn es Gebietskonflikte gibt und zwei Staatsoberhäupter die Herrschaft über das gleiche Stück Land für sich beanspruchen. Ein Beispiel ist Taiwan: Die Insel beansprucht für sich Unabhängigkeit und nennt sich Republik China. Die große Volksrepublik China aber ist der Meinung, dass Taiwan zu ihr gehört, und erkennt die Republik China deshalb nicht an. Eine Zeitlang war die Republik China ein eigenständiges Mitglied der Vereinten Nationen, seit 1971 ist sie das nicht mehr. Inzwischen erkennen nur noch wenige andere Staaten die Republik China an. Deutschland gehört nicht dazu: Es gibt zwar wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zu Taiwan, aber keine diplomatischen.
In Deutschland gibt es die in weiten Teilen rechtsextreme Reichsbürger-Bewegung, die der Meinung ist, die Bundesrepublik Deutschland sei ein völkerrechtlich nicht legaler Staat. Sie behaupten, das Deutsche Reich aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg existiere weiter. Das ist natürlich nicht so. Die Reichsbürger haben sich eine eigene Flagge gegeben und stellen sich sogar eigene Ausweise aus. Trotzdem gilt für sie natürlich das gleiche Recht wie für alle anderen Menschen in Deutschland.
Etwas unklarer ist oft der Begriff des Volkes. Ist das Volk die Summe aller Menschen, die in einem Staat leben? Oder braucht es gewisse Gemeinsamkeiten, eine gemeinsame Sprache oder gemeinsame Werte etwa? Muss ein Mitglied der Gemeinschaft auch Staatsbürger sein? Oder zumindest eine gewisse Zeit im Land leben? Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültigen Antworten.
Unterscheiden kann man auf jeden Fall zwischen:
Staatsbürgern
:
Nur sie haben gewisse Bürgerrechte wie zum Beispiel das Wahlrecht und das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes. Sie können sich im ganzen Bundesgebiet frei bewegen und dürfen die Staatsangehörigkeit nicht entzogen bekommen.
Bewohnern, die keine Staatsbürger sind: Für sie gelten die Bürgerrechte, die das Verhältnis von Einzelperson und Staat regeln, nicht automatisch. Allgemeine Menschenrechte aber schon.
Auf Bundesebene dürfen in Deutschland nur Staatsbürger wählen. Bei anderen Wahlen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, dürfen aber teilweise auch Menschen wählen, die dauerhaft in Deutschland leben, aber keine Staatsbürgerschaft haben. Und bei den Europawahlen dürfen auch Staatsbürger anderer EU-Länder, die in Deutschland leben, wählen.
Die Existenz von Staaten schafft Ordnung. Sie macht für jeden nachvollziehbar: Aha, auf diesem Stück Land lebt eine Gruppe von Menschen, die von diesem Staatsoberhaupt vertreten wird. Es ist klar: Der Staat kümmert sich um die Angelegenheiten der Menschen, die dort leben, und er kümmert sich darum, dass er unabhängig bleibt und nicht von außen bedroht wird.
Die Utopie einer Welt ohne Grenzen
Könnte es auch eine Welt ohne Grenzen geben, eine Weltgemeinschaft, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben? Diese Wunschvorstellung (Utopie) gibt es. Die Idee dahinter ist, dass Staatsbürgerschaft ein zufälliges Privileg ist, das zu globaler Ungerechtigkeit führt. Wer in einem reichen und freien Land geboren ist, hat nur aufgrund seiner Geburt massive Vorteile gegenüber jemandem, der in einem armen und/oder autoritären Land geboren ist. Diese Ungerechtigkeit könnte man überwinden, wenn es gar keine Staaten mehr gäbe. Doch obwohl zumindest in Europa und der westlichen Welt versucht wird, Grenzen so gut wie möglich abzubauen, ist es schwer vorstellbar, dass alle Länder der Welt sich bereiterklären könnten, ihre Souveränität zugunsten einer Weltgemeinschaft aufzugeben und ihre Privilegien mit allen Menschen zu teilen.





























