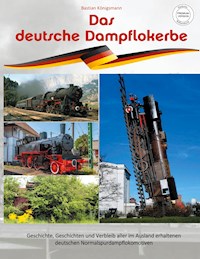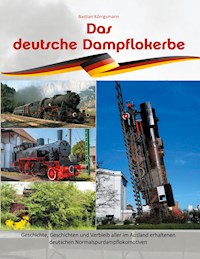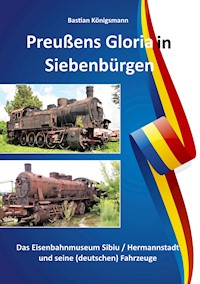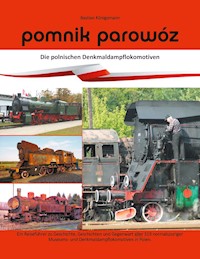
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Polen verbinden viele Eisenbahnfreunde sofort mit Wolsztyn. Plandampf pur, von den Einen geliebt, von den Anderen wegen der früheren finanziellen Unterstützung aus dem Königreich spöttisch als Spielplatz der Briten bezeichnet. Doch Polen bietet viel mehr für Eisenbahn- und Technikliebhaber. 319 Normalspurdampflokomotiven gibt es im Land zu bestaunen; viele mit preußischen oder deutschen Wurzeln. Sei es als Denkmal, als Wrack in der Hoffnung auf bessere Zeiten oder als Museumsstück in liebevoller Pflege durch die zahllosen Eisenbahnfreunde des Landes. Das ist zwar nur die Hälfte der in Deutschland erhaltenen Loks. Darunter befinden sich aber neben den Vertretern der polnischen Erfolgsbaureihen zahlreiche weltweit einzigartige Exponate aus der ersten Hälfte des 20ten Jahrhunderts. Ein enormer historischer Schatz mit hohem Besuchswert! Aber wo findet man die Lokomotiven? Wolsztyn natürlich kennen die Meisten, dass es in Chabówka und Warszawa Museen gibt hat man gehört, aber danach wird die Informationslage deutlich dünner. Bis jetzt! Dieses Buch soll Ihnen auch ohne Vorkenntnisse als Reiseführer dienen. Ihnen die Standorte der Lokomotiven zeigen, deren aktuellen Zustand dokumentieren und die Geschichte wie auch die Geschichten der Fahrzeuge erzählen. Entstanden ist dabei ganz bewusst keine eisenbahnhistorische Zusammenstellung von Tabellen und Daten, sondern eine Geschichte aus dem Einsatzalltag. 700 Fotos von gestern und heute - davon über 200 in Farbe -lassen Sie in die Welt polnisch-preußischer Eisenbahngeschichte eintauchen. Nicht alle Bilder würden Platz in einem Hochglanz-Fotoalbum finden, doch werden sie hier ganz bewusst gezeigt -weil sie ungestellt den Alltag der Dampfeisenbahn zu Zeiten eines strikten Fotografierverbotes auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zeigen. Diese einmalige Materialsammlung wurde von über 100 Menschen aus 12 Ländern beigesteuert. Erfahren Sie auch, welche Chancen seit dem Fall des Ostblocks vergeben wurden, mit welchen Schwierigkeiten der Dampfbetrieb in Wolsztyn zu kämpfen hatte und wie die polnische Staatsbahn PKP ihr geschichtliches Erbe betreut. Tauchen Sie in die Lokfriedhöfe der 1990er Jahre ein. Lernen Sie Museumsprojekte kennen, die es leider nicht geschafft haben. Aber vor allem - nehmen Sie die Inspiration aus diesem Buch mit und besuchen Sie Polens Dampflokschätze. Die Eisenbahner freuen sich auf Sie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vorwort
Liebe Leser,
Polen verbinden viele Eisenbahnfreunde sofort mit Wolsztyn – Plandampf pur, von den Einen geliebt, von den Anderen spöttisch als Spielplatz der Engländer (deren Stiftungen zumindest früher einen Teil der Kosten getragen haben) bezeichnet.
Doch Polen bietet viel mehr für Eisenbahnfreunde und Technikbegeisterte. 319 normalspurige Dampflokomotiven – viele mit preußischen und/oder deutschen Wurzeln – gibt es im Land zu bestaunen, sei es als Denkmal, als Wrack das auf bessere Zeiten hofft oder in liebevoller Pflege durch die zahllosen Eisenbahnfreunde des Landes. Das ist zwar „nur“ die Hälfte der in Deutschland vorhandenen Loks, darunter sind neben polnischen Erfolgsbaureihen aber zahlreiche weltweit einzigartige Exponate, die alleine deshalb einen enormen historischen wie auch einen hohen Besuchswert haben.
Aber wo findet man diese? Wolsztyn natürlich kennen die Meisten, dass es in Chabówka und Warszawa Museen gibt hat man gehört, aber danach wird die Informationslage deutlich dünner.
Dieses Buch ist ganz bewusst keine eisenbahnhistorische Zusammenstellung von Tabellen und Daten, sondern soll Ihnen als Reiseführer dienen, Ihnen die Standorte der Lokomotiven zeigen, deren aktuellen Zustand dokumentieren und die Geschichte sowie Geschichten der Fahrzeuge erzählen. Nicht taggenaue Daten in langen Listen, sondern den Einsatzalltag. Über 600 Fotos von gestern und heute lassen Sie in die Welt polnisch-preußischer Eisenbahngeschichte eintauchen. Sicher nicht alle Bilder würden dabei Platz in einem Hochglanz-Fotoalbum finden, doch zeige ich sie ganz bewusst trotzdem hier - weil sie ungestellt den Alltag der (Dampf-)Eisenbahn zeigen zu Zeiten eines strikten Fotografierverbotes auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs.
Ich gehe in diesem Buch recht locker mit Ortsnamen um, verwende ganz bewusst im Kontext mal polnische, mal deutsche oder gar ungarische Begriffe. Warum? Weil es die Einwohner der Orte genauso machen. Im November 1992 hat der Europarat die "European Charter for Regional or Minority Languages" erlassen, die mehrsprachige Ortsnamen - und zwar eben die freie Verwendung wie man es gerade möchte - als "einzigartigen Bestandteil des kulturellen Erbes Europas" bezeichnet. Diese Regelung hat Gesetzeskraft in Deutschland seit 1999, in Polen seit 2009. Und ist ein Sinnbild der europäischen Freundschaft.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,
Ihr Bastian Königsmann
Bastian Königsmann (*1982), gelernter Eisenbahner, machte 2003 Schlagzeilen mit der Umwandlung von Bahnhöfen in Serviceoasen. Inzwischen ist er in leitender Position in der Aus- und Weiterbildung von Bahnpersonal tätig und engagiert sich im interkulturellen Austausch mit Eisenbahnern aus Polen, Bosnien-Herzegowina und Rumänien. Nach dem Versuch seines ersten Kesselfeuers beschloss er, die Arbeit auf der Dampflok doch lieber den Profis zu überlassen. Er wohnt mit zwei bahnverrückten Kindern in Mittelfranken und fährt manchmal mit seiner eigenen Köf II auf Ausflugsfahrt. Nach seinem Erstlingswerk „Dampfloktechnik heute“ über die immer noch täglich im Einsatz befindlichen Dampflokomotiven in Bosnien-Herzegowina veröffentlichte und übersetzte er zahlreiche Museumsführer im In- und Ausland.
Inhaltsverzeichnis
Die Eisenbahn in Polen – eine kurze Geschichte
Denkmalpflege der polnischen Eisenbahn
Die großen Eisenbahnmuseen
Erhaltene Dampflokomotiven
4.1 Grundprinzip: Lokbezeichnung
4.1.4 Standortkarte
4.2 preußische Länderbahndampflokomotiven
4.2.1 preußische P6 / Baureihe 37 / PKP Oi1
4.2.2 preußische P8 / Baureihe 38 / PKP Ok1
4.2.3 preußische T9.3 / Baureihe 91.5-17 / PKP TKi3
4.2.4 preußische T4.1 / Baureihe 70.70 / PKP TKb 100
4.2.5 preußische T11 / Baureihe 74 / PKP OKi1
4.2.6 preußische T12 / Baureihe 74 / PKP OKi2
4.2.7 preußische T18 / Baureihe 78 / PKP OKo1
4.2.8 preußische S6 / Baureihe 13 / PKP Pd5
4.2.9 preußische T3 / Baureihe 89.70 / PKP TKh1
4.2.10 preußische T7 / Baureihe 98.78 / PKP TKh2
4.2.11 preußische T13 / Baureihe 92 / PKP TKp1
4.2.12 preußische T14 / Baureihe 93 / PKP TKt1
4.2.13 preußische T16.1 / Baureihe 94 / PKP TKw2
4.2.14 preußische G7.1 / Baureihe 55 / PKP Tp1
4.2.15 preußische G7.2 / Baureihe 55 / PKP Tp2
4.2.16 preußische G8 / Baureihe 55 / PKP Tp3
4.2.17 preußische G8.1 / Baureihe 55 und 56 / PKP Tp4 und Tr5
4.2.18 preußische G8.2 / Baureihe 56 / PKP Tr6
4.2.19 preußische G10 / Baureihe 57 / PKP Tw1
4.2.20 preußische G12 / Baureihe 58 / PKP Ty1
4.3 Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn
4.3.1 Baureihe 24 / PKP Oi2
4.3.2 Baureihe 64 / PKP OKl2
4.3.3 Baureihe 03 / PKP Pm2
4.3.4 Baureihe 03.10 / PKP Pm3
4.3.5 Baureihe 86 / PKP TKt3
4.3.6 Baureihe 56 / PKP Tr7
4.3.7 Baureihe 52 / PKP Ty2
4.3.8 Baureihe 42 / PKP Ty3
4.3.9 Baureihe 50 / PKP Ty5
4.4 Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten bis 1945 (Staatsbahn)
4.4.1 Ok22
4.4.2 OKl27
4.4.3 OKz32
4.4.4 Pm36
4.4.5 Os24
4.4.6 Pu29
4.4.7 Pt31
4.4.8 Ty23
4.4.9 Ty37
4.5 Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten nach 1945 (Staatsbahn)
4.5.1 Ol49
4.5.2 Pt47
4.5.3 TKt48
4.5.4 Ty42
4.5.5 Ty43
4.5.6 Ty45
4.5.7 Ty51
4.6 Werklokomotiven
4.6.1 Fablok Typ Baziel
4.6.2 Die Zuckermaschinen – TKb
4.6.3 Krupp Typ Hannibal
4.6.4 Fablok Typ Ferrum 47
4.6.5 Fablok Typ Sląsk
4.6.6 Krenau Typ Oberschlesien
4.6.7 LaMeuse Typ PH-G
4.6.8 Borsig TKp 15347
4.6.9 Kriegslok KDL 6
4.6.10 Sandbahn TKz
4.7 Dampfspeicherlokomotiven
4.8 Sonstige / die Entwicklungshelfer
4.8.1 BMAG TKb1479
4.8.2 Lettische Tk
4.8.3 Schlawer Kreisbahn TKi100
4.8.4 Hagans TKp 1149
4.8.5 O&K TKh9336
4.8.6 ELNA 4
4.8.7 Englische Liberation – Tr202
4.8.8 Amerikanische S160 - Tr201/Tr203
4.8.9 Amerikanische Truman – Ty246
4.8.10 Belgische Hilfe – Tr21
4.8.11 Österreichische 80 – Tw12
4.8.12 Österreichische 97 – TKh12
4.8.13 Österreichische 270 – Tr12
4.8.14 Österreichische 429 – Ol12
Die Wolsztyn-Experience
5.1 Die Schwierigkeiten des Dampfbetriebs – eine Chronik
verpasste Chancen
6.1. Die gescheiterten Museen
6.2 Die großen Lokfriedhöfe
6.3 zu spät – Lokomotiven, für die sich niemand interessierte
Anhang
7.1 Zukunftsaussichten
7.2 Devise Dampf
7.3 Danksagung
7.4 Literaturverzeichnis
„Der Bundespräsident hat mit großer Sympathie von Ihrem Einsatz für die Eisenbahngeschichte und Ihrem diesbezüglichen Rechercheaufwand in osteuropäischen Nachbarstaaten erfahren. […] Im Namen des Bundespräsidenten danke ich Ihnen deshalb auf diesem Weg für Ihr Engagement.“
Mitteilung des Bundespräsidialamtes vom 11. November 2019.
1. Die Eisenbahn in Polen – eine kurze Geschichte
Die Eisenbahngeschichte Polens hängt natürlich unmittelbar mit der eigentlichen Geschichte des Landes zusammen. Spricht man heute von der Bahngeschichte Polens, so gehört auch die Geschichte der Königlich Preußischen Eisenbahn ebenso hinzu wie die Geschichte des russisch kontrollierten Kongresspolens und die Geschichte der Eisenbahn in Österreich. Zur unrühmlichen, aber für die spätere Geschichte der polnischen Eisenbahn prägenden Periode des Zweiten Weltkriegs gehört auch die deutsche Geschichte.
1842 gilt als die Wiege der Eisenbahn im heutigen Polen, als die preußische private Eisenbahngesellschaft OSE (Oberschlesische Eisenbahn AG) den Zugverkehr auf der Strecke Breslau – Ohlau (heute: Wrocław - Oława) aufnahm, die in den Folgejahren bis Myslowitz (heute: Mysłowice) verlängert wurde. Als Symbol für den Start in die Neuzeit wurde für den Bau des ersten Bahnhofs Polens der bis dahin als solcher genutzte Hinrichtungsplatz in der Schweidnitzer Vorstadt von Breslau genutzt – auch, weil das offizielle Interesse am Bahnbau zu der Zeit noch sehr gering ausgeprägt und dies das einzige bezahlbare Grundstück war.
Abb. 1 u.2.: Polens erster Bahnhof in Breslau. Bereits 1855 wurde dieser verlegt und erneuert. F: BK
Wie anderswo in Europa wich die Skepsis schnell dem Fortschrittsdenken und bereits 1843 eröffneten zahlreiche weitere Bahnstrecken, angefangen von der Anbindung Berlins an das damals noch preußische Stettin bis zum ersten Teilstück der Direktverbindung Warschau – Wien, die ein Kooperationsprojekt der russischen und österreichischen Regierung war und viele Jahre durch ein deutsch-belgisches Konsortium betrieben wurde. Polen war schon immer Treffpunkt der Kulturen!
Bis zum Beginn des ersten Weltkriegs war ein Großteil Polens eisenbahntechnisch erschlossen, wenngleich auch in einem bunten Mix aus Normalspur- (1435 mm), Schmalspur- (750 mm, 785 mm, 1000 mm, 1067 mm und weitere) und sogar Breitspur(1524 mm)-Spurweiten. In den Kriegswirren wechselten Gleisnetz, Lokomotiven und Zuständigkeiten ständig – was zur Folge hatte, dass die in der „zweiten polnischen Republik“ 1918 gegründete Polnische Staatsbahn PKP (Polskie Koleje Państwowe) zunächst die dringende Aufgabe hatte, sich einen Überblick zu verschaffen und eine zumindest notdürftige Homogenisierung durchzuführen. Hierbei wurden vor allem die noch vorhandenen Breitspurstrecken (fast) vollständig auf Normalspur umgespurt. Auch die eine oder andere Schmalspurbahn erhielt Normalspurgleise und wurde so barrierefrei ans Netz angeschlossen. Wirtschaftlich bedeutende Prestigeobjekte wurden realisiert wie die Anbindung der Kohleregion Kattowitz an die Ostseehäfen. Der Fahrzeugpark war nun deutlich „deutscher“ ausgerichtet, was neben den zahlreichen nach Kriegsende zurückgebliebenen preußischen Lokomotiven vor allem an geschickter Verhandlungstaktik lag, mussten doch deutsche Lokfabriken 1921/1922 auf Basis des Versailler Vertrages Reparationslokomotiven nach Polen liefern. Um diesen Bedarf zu befriedigen entnahm man kurzerhand aus der regulären Produktion für die Reichsbahn einzelne Baulose, beispielsweise 65 preußische P8 (darunter die in diesem Buch vorgestellte Ok1-258) und eine unbekannte Anzahl G8.1 (bekannt ist nur die Gesamtzahl 459, welche aber alle auf dem Gebiet Polens stehengebliebenen auch beinhaltet).
Trotzdem reichten diese Bemühungen nicht aus. Eine erste Bestandsaufnahme zeigte 1918 über 900 Maschinen die älter als 20 Jahre waren. Zudem waren viele Kriegsschäden im gebeutelten Verkehrsnetz zu beklagen, so dass man sich nach einer notdürftigen Instandsetzung der Schadloks auf dem Markt nach Alternativen umsah. Die Industrie war in vielen Teilen europaweit zerstört oder völlig ausgelastet, jedoch arbeiteten noch im Zuge der Kriegsbemühungen amerikanische Lokfabriken auf Hochtouren. Es war also ein leichtes, in kürzester Zeit amerikanische Kriegsloks der „Pershing“-Reihe mit angepassten technischen Eigenschaften zu bekommen – bereits ab 1919 wurden stückweise die insgesamt 175 Loks über den Hafen Danzig angeliefert. Später wurden weitere 148 Loks der stärkeren Tr21 teilweise sogar schon in Polen selbst gebaut.
Stichwort selbst gebaut – auf polnischem Gebiet gab es zum damaligen Zeitpunkt nur eine einzige nennenswerte Lokomotivfabrik, die Fabrik H. Cegielski in Posen, die jedoch auch mit Kriegsschäden zu kämpfen hatte. So gründete man 1919 in Chrzanów die „Fablok“, „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce Sp. Akc.“, und begann mit dem Aufbau einer Lokomotivproduktion. Es dauerte jedoch bis 1924, bis die erste Lok die Werkhallen verließ – konstruiert von Fablok-Ingenieuren in Zusammenarbeit mit Hanomag in Hannover-Linden, die von der neuen Baureihe Ok22 auch die fünf Prototypen gebaut hatte. Die Ok22-23 und -31 werden in diesem Buch näher vorgestellt. Auch kleinere Fabriken waren mit der Fertigung von Dampflokomotiven betraut, konnten aber nie eine historisch nennenswerte Größenordnung erreichen.
Vor allem Güterzuglokomotiven waren es, die zur Befeuerung des Wirtschaftswachstums nun zur jungen Staatsbahn stießen, hatte man doch mit Ok22 und den inzwischen als Ok1 bezeichneten P8ern verstärkt durch zahlreiche Splittergattungen erst einmal ausreichend Reisezuglokomotiven.
Zwar war auch die Zwischenkriegszeit wie man sie heute bezeichnet für Polen alles Andere als konfliktfrei, doch lief der Betrieb der PKP von den politischen Entwicklungen weitestgehend ungestört. Emotionaler Höhepunkt dieser Epoche war die Weltausstellung in Paris im Jahr 1937, als die von Chrzanów gebaute „schöne Helena“ Pm36-1 für ihr elegantes Design mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde – bis heute ein stolzer Moment der polnischen Geschichte. Leider ist die Lok nicht erhalten, ihre Schwesterlok Pm36-2 wird aber in diesem Buch vorgestellt.
Am 01. September 1939 bedeutete der Ausbruch des zweiten Weltkrieges ein jähes Ende des „ruhigen Bahnverkehrs“. Im Oktober/November 1939 wurde die PKP vollständig aufgelöst und zusammen mit anderen Bahnstrecken in die „Ostbahn“ integriert. Eine Organisationseinheit der Verwaltung der besetzten Gebiete, die zum Leidwesen Berlins durchaus eine gewisse Eigenständigkeit behielt.
Was mühsam seit 1918 aufgebaut worden war lag nun zerstört da – in ihrer Not haben fliehende polnische Truppen einen beträchtlichen Teil der Bahninfrastruktur zerstört, polnische Zwangsarbeiter mussten diese mühevoll unter der Leitung von „Volksdeutschen“ – in der Praxis vor allem Österreicher – wieder aufbauen. Personenverkehr fand nur sporadisch statt, vielmehr wurden Massen an Güterzügen bewegt. Die 1941 eingerichtete Ostfront benötigte ebenso Nachschub wie das „Reich“ Kohle aus der Kattowitzer Region forderte. Kriegslokomotiven der Baureihe 52 zogen quer durchs Land, die preußischen altbekannten Maschinen kamen wieder, und manch grausiger Zug fuhr durch Polen. Besonders bemerkenswert aus bahnhistorischer Sicht ist der Einsatz vieler französischer Lokomotiven, die nach Eroberung Frankreichs in polnische Gebiete versetzt wurden. Auch die Beiden Lokfabriken wurden mitsamt ihrer Außenstellen zur Kriegsproduktion herangezogen und fertigten vor allem KDL 1 – Lokomotiven: 52er Kriegsloks.
Ab Sommer 1944 eroberten sowjetische Streitkräfte mit ihren Verbündeten Stück für Stück das Eisenbahnnetz des heutigen Polens. Mit der vollständigen Eroberung der heute polnischen Gebiete wurde im Frühjahr 1945 die PKP wieder errichtet und nahm ihren Betrieb als „Freie Eisenbahn Polens“ wieder auf, stets parallel zum unter sowjetischer Regie durchgeführten Militärbahnverkehr. Und unter widrigen Bedingungen – einerseits wurden zum Beispiel die Fabrikanlagen der nun auf polnischem Gebiet liegenden Lokomotivfabrik Schichau in Elbing fast vollständig durch sowjetische Kräfte demontiert, auch zahlreiche Gleise vor allem im Nordteil des „neuen“ Landes ließ man abtransportieren. Zum Anderen jedoch bestand die Forderung des Militärs, für den Transitverkehr Russland – DDR umfangreiche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Es dauerte über 5 Jahre, bis man die gröbsten Schäden beseitigt hatte.
Um den Zugverkehr aufrecht zu erhalten, erhielt die polnische Staatsbahn ab Juli 1946 insgesamt 575 amerikanische Lokomotiven der Baureihe S160 (in Polen Tr201 und Tr203) als Entwicklungshilfe. Bezeichnenderweise waren es also (auch) amerikanische Lokomotiven, die fortan sowjetische Truppen an die innerdeutsche Grenze brachten. Die Tr201-51 und die Tr203-296 / -451 werden in diesem Buch vorgestellt.
Der heimische Lokbau war zunächst geprägt von Weiterentwicklungen bzw. Weiterbau von vorhandenen Mustern. So erblickten die Pt47 als weiterentwickelte Pt31 sowie die Güterzugloks Ty42 (Nachbau der deutschen 52er), Ty43 (Nachbau der deutschen 42er) und Ty45 (weiterentwickelte Ty37, eine 58er Unterbauart) das Licht der Bahnwelt. Neuentwicklungen waren in den ersten 24 Monaten nach Kriegsende kaum möglich. Schuld war eine Weisung der Militäradministration, Entwicklungsarbeiten nur dort stattfinden zu lassen wo garantiert kein einziger „Volksdeutscher“ Mitarbeiter Zugriff drauf haben könnte. Ab 1950 gelang dann der „große Wurf“ als die selbstentwickelten Allroundlokomotiven TKt48 (191 Stück) und Ol49 (112 Stück) von Fablok und Cegielski aufs Gleis gestellt wurden – die Zahlen 48 und 49 stehen dabei für die Jahre, in denen die (ingenieurtechnische) Entwicklung erfolgte.
Ab 1953 begann man mit der Elektrifizierung des Netzes, wobei vor dem 2. Weltkrieg schon in Teilen Schlesiens und in Warschau elektrischer Betrieb vorhanden war. Es dauerte jedoch bis 1988, bis die Marke von 10.000 km elektrifizierter Strecke erreicht war. 1957 begann zudem die Produktion von Streckendiesellokomotiven zur Ablösung des Dampfbetriebs. Etwa 1970 war die Marke von 1.000 Dieselloks auf dem Netz gefallen, trotzdem wurde weit über die Hälfte der Traktionsleistung mit Dampflokomotiven erbracht. Beim Systemwandel zur „Dritten Republik“ 1989/1990 waren noch immer über 1.000 Dampflokomotiven buchmäßig vorhanden. Inwieweit diese betriebsfähig und im Einsatz waren, ist durchaus strittig – buchmäßig und real vorhanden stimmte bei der polnischen Staatsbahn in der Regel nie überein. Beim Vergleich von 10 halbwegs gesicherten Bahnbetriebswerksdaten waren jeweils ziemlich genau 1/3 des Einsatzbestandes auch betriebsfähig und im Einsatz, so dass man von 300 – 350 im Einsatz befindlichen Dampfloks zu der Zeit ausgehen kann. Erst 1992 war Polen offiziell mit Ausnahme von den damals noch mehreren „Museums-Bahnbetriebswerken“ dampffrei. Aber auch das ist nur eine offizielle Meinung, in der Praxis fuhren noch bis mindestens 1995 immer wieder Dampflokomotiven vor regulären Zügen. Vor allem in den Wintermonaten mussten Diesellokomotiven ohne Heizvorrichtung im planmäßigen Personenverkehr ersetzt werden.
Heute zeigt sich der Schienenverkehr in Polen weitestgehend westlichen Verhältnissen angepasst. Ähnlich wie die Deutsche Bahn AG ist die PKP privatisiert mit zahlreichen Tochtergesellschaften, es gibt Schnellfahrstrecken mit immerhin 200 km/h und modernen Schnelltriebwagen, der Regionalverkehr ist zu einem großen Teil auf moderne Triebwagen verschiedenster Bauarten umgestellt. Das Preissystem schafft es in seiner Komplexität mühelos, noch so kuriose Ideen deutscher Bahnmanager in den Schatten zu stellen.
Die PKP ist in atemberaubender Geschwindigkeit ein modernes Unternehmen geworden, ohne dabei ihre Historie zu vergessen. Auch wenn zahllose Chancen ausgelassen wurden, so hat sich trotzdem mit Unterstützung der Staatsbahn eine aktive Museumslandschaft gebildet, die in diesem Buch vorgestellt werden soll. Und auch Plandampf gibt es zumindest bei Drucklegung dieses Buches noch – die legendären, täglich eingesetzten Dampflokomotiven des BW Wolsztyn halten trotz aller Widrigkeiten die Fahne von König Dampf hoch.
Abb. 3: Allgegenwärtiger Begleiter in Polen bis 1989: Zakaz Fotografowanie. Fotografierverbot. Bahnanlagen waren in der Regel mit diesen Schildern „geschmückt“, nur eine Erlaubnis aus dem Museum Warszawa, eine ORBIS-Reisebegleitung oder genügend Kaffee & Zigaretten ermöglichten legale Fotos von Dampflokomotiven.
2. Denkmalpflege der polnischen Eisenbahn
Die Geschichte der Denkmalpflege der polnischen Eisenbahn ist auch zugleich ein Abbild der gesellschaftlichen Geschichte Polens und bedarf einer genaueren wissenschaftlichen Herangehensweise. Die ersten dokumentierten polnischen Eisenbahnfreunde kommen aus dem Jahr 1895 und waren Künstler, die zu dem Zeitpunkt schon historische Bahnanlagen und Fahrzeuge als Kunstobjekte wahrgenommen und entsprechend verarbeitet haben. Ab den 1920er Jahren gab es in Zusammenhang mit der Gründung des Eisenbahnmuseums Warschau eine kleine Abteilung zur Historienpflege, die aber vor allem auf Ressourcen einiger weniger Privatpersonen zurückgegriffen hat.
Ein Chronist der Nachkriegszeit hat sich mit der Historienpflege der polnischen Staatsbahn nach 1945 befasst und mit Augenzwinkern vermerkt, „dass es nach 1945 keinerlei Bedarf an einer musealen Arbeit der Eisenbahn gibt, da der normale Alltagsbetrieb ein großes Freilichtmuseum darstellt“. Auch darf man nicht vergessen, dass der Bahnbetrieb im Polen der Nachkriegszeit ein militärisches Geheimnis darstellte. Wer sich zu offensichtlich hierfür interessierte, machte sich schnell der Spionage verdächtig.
So dauerte es bis Mitte/Ende der 1960iger Jahre, bis erste Bemühungen stolzer polnischer Eisenbahner (der Begriff stolz spielt hier eine entscheidende Rolle) zur Erhaltung historischer Eisenbahnsubstanz für die Nachwelt eingeläutet wurden. Auch hier stellte sich zunächst die Frage, was als historisch zu gelten hat – anders als in (West-)Deutschland war die Dampflokomotive noch in einer Blütezeit, auch uralte Länderbahntechnik war im normalen Alltag an jeder Ecke zu finden. Nach ersten zaghaften Überlegungen und zunächst „Abtasten“ der politischen Möglichkeiten - im Bruderstaat DDR war mit dem Deutschen Modelleisenbahn-Verband der DDR ein politisch gewolltes und unterstütztes Beispiel vorhanden – konnten Anfang der 1970er Jahre Erfolge erzielt werden. Erste Dampflokomotiven wurden nicht nur vor dem Schneidbrenner gerettet, sondern sogar denkmalgerecht aufgearbeitet. Dabei ist es kein Zufall, dass in Polen zahlreiche preußische Länderbahnlokomotiven erhalten wurden, dem ununterbrochen auch im sozialistischen Polen positiven Verhältnis der polnischen Gesellschaft gegenüber der preußischen Vergangenheit sei Dank. Auch die damals in den letzten erfolglosen Zügen versuchte einheitliche Denkmalorientierung im Ostblock konnte daran nichts ändern. Manch ein Historiker ist sogar davon überzeugt, dass es eben die Polen waren, die die in den 1950er Jahren propagierte „Denkmaleinheit“ zur Erfolglosigkeit verdammt haben. Auffallend ist, dass in den zu der Zeit durchgeführten Restaurierungen von Fahrzeugen explizit darauf geachtet wurde, Umbauspuren aus Reichsbahnzeiten zu entfernen, polnische oder preußische Umbauten aber in der Regel erhalten blieben.
Während in Westdeutschland ein Dampflokverbot herrschte und die DDR eine intensive, aber in sich abgeschottete Denkmalpflege betrieb, erkannte man in Polen früh den touristischen und devisenbringenden Markt der Eisenbahnhistorie. Ab 1976 – also kurz vor Einstellung des Dampflokbetriebs in Westdeutschland – fingen findige Vermarkter des staatlichen polnischen Reisebüros „ORBIS“ an, ausländischen Dampflokfreunden Polenreisen mit Dampfsonderzügen zu verkaufen. Nicht ohne Risiko für alle Seiten und politisch nicht unumstritten, galt doch zur damaligen Zeit ein striktes Fotografierverbot für Eisenbahneinrichtungen dem die Zusicherung von ORBIS zur freien Fotoausbeute entgegenstand. Aus allen Teilen (West-)Europas, vor allem aber aus Großbritannien, fanden sich Eisenbahnfreunde über Jahre hinweg in Polen ein um in geführten und begleiteten Dampfsonderzügen das Land zu bereisen und nebenher einen Hauch Alltagsbetrieb mitzuerleben. Nicht ohne Probleme natürlich, zahlreiche Zwischenfälle zwischen Reisegruppen und Polizeibehörden sind ebenso dokumentiert wie kohlewerfende Lokführer und fliehende Reisende an Bahnsteigen. Zu groß muss die Angst vor Repressalien gewesen sein wenn man das ungewöhnliche Tun der ausländischen Reisenden vermeintlich unterstützt.
Die praktische Pflege der historischen Lokomotiven oblag der Staatsbahn, die hierbei auf ihre stolzen Mitarbeiter zählen konnte. Eisenbahner zu sein war in Polen stets ein gesellschaftlich hoch angesehener Beruf, dementsprechend stolz gingen die Eisenbahner zu Werke. So ist auch heute fast vergessen, dass die für Polen demokratiebringende „Solidarnosc-Bewegung“ ihren Ursprung nicht am 14. August in der Danziger Leninwerft, sondern bereits 6 Wochen zuvor im Bahnbetriebswerk Lublin hatte. Eine zentrale Rolle spielte hier die Lok Pt47-157, die in diesem Buch genauer vorgestellt wird.
Die im Zuge der Demokratisierung steigenden Freiheiten wurden zu ersten privaten Initiativen von Eisenbahnern genutzt. So entstanden noch zu Zeiten der Volksrepublik ab 1985 erste privat geführte Museumseinrichtungen zunächst unter dem Deckmantel des Modelleisenbahnhobbys. Gerade rechtzeitig konnten sich diese Vereinigungen in Stellung bringen um in den turbulenten Umschwungzeiten manch historisch wertvolles Exemplar vor dem Schneidbrenner zu retten.
In Wolsztyn erinnerten sich englische Eisenbahnfreunde an ihre Erlebnisse bei den ORBIS-Ferienreisen und unterstützen finanziell und politisch die de facto Gründung und den Betrieb des dortigen Museumsbahnbetriebswerkes. Von vielen oft belächelt als Spielplatz für englische Eisenbahnfreunde rettete man auf diesem Wege zahlreiche Kulturgüter vor der Verschrottung. Weitere Museumsbahnbetriebswerke konnten sich mangels touristischer Besucher oder mangels Interesse seitens des mittleren Managements leider nicht halten, sind aber als stationäre Museen teilweise erhalten geblieben.
Auch die Goldgräber tauchten nun auf und versuchten, möglichst viel auch bahnhistorisches Kulturgut gegen dicke Geldkoffer außer Landes zu schaffen, doch sorgte der neue Markt „DDR Eisenbahnmemoralien“ dafür, dass keine nennenswerten Exporte erfolgten und die Goldgräber weitestgehend erfolglos agierten. Mit Vor- und Nachteilen, so sank mit der politischen Einflussnahme auch die Unterstützung der Eisenbahnfreunde und manch historisch wertvolle Exponate konnten nicht vor der Verschrottung gerettet werden, war der Rohstoffertrag doch nun wichtiger geworden.
Heute präsentiert sich die polnische Eisenbahnmuseumslandschaft wieder im Aufwind. Zahlreiche Schmalspurstrecken haben den Touristenbetrieb (wieder) aufgenommen, private Initiativen kümmern sich um die mittelfristig auch betriebsfähige Aufarbeitung von Dampflokomotiven, der Bau eines nationalen Eisenbahnmuseums nimmt Formen an und in einem kooperativen (!) Kraftakt konnte der tägliche Dampflokbetrieb im Museums-Bahnbetriebswerk Wolsztyn gerettet werden.
Trotz einiger Rückschläge, die Sie im hinteren Teil des Buches finden, kann der Bestand von 319 Normalspur- und 188 Schmalspurdampflokomotiven in Polen weitgehend als gesichert gelten.
3. Die großen Eisenbahnmuseen
Polen ist reich an Eisenbahnschätzen und an ehrenamtlich engagierten Menschen, die sich in Privatinitiativen um die Erhaltung historischen Kulturgutes kümmern. Neben zahlreichen Denkmälern, kleineren Sammlungen und natürlich dem weltweit bekannten Museumsbahnbetriebswerk Wolsztyn, dem hier ein eigenes Kapitel gewidmet ist, existieren 6 große Museen für Normalspurlokomotiven sowie drei nach Spurweite ausgerichtete zentrale Schmalspurmuseen.
Abb.4: Übersichtskarte Eisenbahnmuseen
Auch die polnische Staatsbahn betreibt eine aktive Denkmalpflege, wenngleich die Meinungen zwischen den Beiden „Gruppen“ über das wie und wo durchaus auseinandergehen. Besuchen Sie die Museen und machen sich selbst ein Bild, welche Herangehensweise Ihres Erachtens nach zielführender ist!
Eisenbahnmuseum Warszawa
Adresse:
Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Öffnungszeiten:
Täglich 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Zu den ältesten Eisenbahnmuseen in Europa gehört das Warschauer Eisenbahnmuseum, wobei die Historiker streiten, welches Jahr als Gründungsjahr zu verwenden ist.
1927 beschloss das Kommunikationsministerium die Einrichtung einer Erinnerungsstätte für die „Arbeit und Erfolge der polnischen Staatsbahn nach der Unabhängigkeit“. Auf der Lemberger Technischen Messe zeigt man einige historische Exponate in einem Pavillon, ab 1928 präsentierte man diese unverändert zeitweise museal in Warschau und schickte sie gelegentlich auf Wanderschaft durch die Republik. 1931 schließlich wurde das offizielle Eisenbahnmuseum Warschau gegründet und am 13. Dezember 1931 feierlich eingeweiht. Welches Jahr man nun auch immer als Gründungsjahr ansieht, gehört diese anfangs 900 Quadratmeter große Ausstellung in der Warschauer Nowy Zjazd – Straße zu den frühesten eisenbahnhistorischen Sammlungen weltweit mit einer damals schon wertvollen großen Modellsammlung.
Den zweiten Weltkrieg überstand das Museum nicht, doch konnten viele der Exponate gerettet und abseits der öffentlichen Zugänglichkeit geschützt untergebracht werden. Zwar gab es bereits 1946 erste Bemühungen des Neuaufbaus der Museumssammlung, diese wurden aber 1957 erfolglos eingestellt. Erst 1972 wurde das Museum nach 5-jähriger Planungszeit, nun erweitert um zahlreiche Originallokomotiven, am heutigen Standort wiedereröffnet. Es ist seit 1998 unter der Verwaltung der Warschauer Stadtverwaltung.
Während im Innenbereich wieder die Modelle den Schwerpunkt bilden, sind im Außenbereich ungeschützt zahlreiche teils weltweit einzigartige Exponate der Eisenbahngeschichte hinterstellt. Zahlreiche Lokomotiven dürfen betreten werden und lassen sich hautnah erleben. Für die kommenden Jahre ist ein vollständiger Neubau des Museums geplant. Die im Rahmen eines Architektenwettbewerbes vorgelegten Pläne dürfen erwarten lassen, dass dem Eisenbahnmuseum Warschau eine glorreiche Zukunft bevorsteht.
Abb. 5/6: Blick in die Ausstellungsfläche (links) und auf die Lokschlange im Außenbereich (rechts). F: BK
Eisenbahnmuseum Chabówka
Adresse:
Skansen taboru kolejowego, 34-720 Chabówka
Öffnungszeiten:
Täglich 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
Das Museum in Chabówka mit seinen über 50 Lokomotiven und etwa ebenso vielen Wagen ist am 11.06.1993 durch engagierte Eisenbahnfreunde unter Leitung von Paweł Zaleski gegründet und im Jahr 1994 eröffnet worden, wobei bereits Mitte der 1980er Jahre die Planung begann und erste Lokomotiven vor der Verschrottung gerettet wurden.
Neben dem klassischen Museumsbetrieb mit Ausstellungen und ruhenden Objekten werden in Chabówka zahlreiche Fahrzeuge und Anlagen betriebsfähig vorgehalten und bei Sonderfahrten einem breiten Publikum präsentiert. So sind (fast) alle typischen Einrichtungen eines Bahnbetriebswerks der Dampflokzeit bis heute erhalten und im Einsatz, etwa die Wasserkräne, Rohrblasgerüste oder eine Bekohlungsanlage. Diese Anlagen und die idyllischen Gleise der Region dienen immer wieder auch als vom Museum unterstützte Filmkulisse. Insbesondere Steven Spielberg ist Stammgast in der Region Chabówka und hat hier unter Anderem Schindlers Liste gedreht – das „Szenenbild“ wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.
Das Museum selbst befindet sich im 1944 und 1947 gebauten Ringlokschuppen des Bahnbetriebswerkes. Warum zwei Baujahre? Nun, 1944 bauten die deutschen Besatzer das Bahnbetriebswerk in Rekordzeit auf um es bei ihrem Abzug einige Monate später gleich wieder zu zerstören. 1947 wurde das umgebaute Betriebswerk nach Wiederherstellung neu eröffnet.
2001 sorgte eine Insolvenz für schlaflose Nächte bei den Museumsliebhabern, nach fast 20 Monaten zähem Ringen um die Zukunft der historischen Sammlung war es die PKP Cargo SA (Güterverkehrstochter der polnischen Staatsbahn), die das Museum übernahm und so seine Zukunft sicherte. Seither sind auch zahlreiche Restaurierungsprojekte in Angriff genommen und der historische Zugbetrieb ausgebaut worden. Unter Anderem ein Hotel im Museum sorgt für zusätzliche Gäste.
Abb. 7: Lässt jedes Eisenbahnfreundeherz höher schlagen: Die „Tenderlokreihe“ in Chabówka. Foto: BK
Eisenbahnmuseum Jaworzyna Śląska
Adresse:
Ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
Öffnungszeiten:
Werktags ab 08:00 Uhr, Wochenende und Feiertage ab 10:00 Uhr
Seit 2004 gibt es das niederschlesische Eisenbahnmuseum in Jaworzyna Sląska in seiner heutigen Form, das mit tatkräftiger Unterstützung des Kulturministeriums als Stiftung geführt wird. Ursprünglich gegründet wurde es durch die polnische Staatsbahn als „Freilichtmuseum für Dampflokomotiven“, als solches war es bis 2001 in Betrieb, in den frühen 1990er Jahren sogar mit speziell organisiertem Plandampf à la Wolsztyn.
Die Zwischenzeit – immerhin 2,5 Jahre der Ungewissheit – bekam der Sammlung nicht gut. Zahlreiche Rohstoffdiebstähle sind verzeichnet, auf dem Höhepunkt des Schrottpreises kam manch eine dubiose Gestalt mit Lieferwagen und Schneidbrenner auf die Anlage gefahren und brannte sich raus, was er / sie gebrauchen konnte. Erst die Gemeinde Jaworzyna Sląska erreichte auf politischem Wege schließlich die Überführung der Sammlung in die Stiftung und die Wiedereröffnung des Museums.
Mehr als 40 Lokomotiven und über 50 Wagen finden sich heute im historischen Bahnbetriebswerk, das eine für Polen ungewöhnliche Historie als heimlichen Schwerpunkt hat: Die Zeit direkt nach dem zweiten Weltkrieg. So finden sich die als Entwicklungshilfe gelieferten amerikanischen Lokomotiven der Baureihen Tr201, Tr202 und Tr203 unter den Exponaten, zudem existiert eine in zwei Reisezugwagen untergebrachte Dauerausstellung über die Aussiedlung deutscher Bürger in der Zeit nach 1945.
Eine Dampflokomotive – die in Polen entwickelte und gebaute TKt48-18 aus dem Jahr 1951 – ist betriebsfähig und regelmäßig mit Sonderzügen im ganzen Land unterwegs. Eine auch in anderen Bahnmuseen, aber hier ganz besonders propagierte Museumsarbeit ist die Zusammenarbeit mit Schulen wie man sie in Deutschland so kaum kennt: Das Museum verfügt über eine breit aufgestellte pädagogische Abteilung, mit deren Hilfe so genannte „Museumsstunden“ altersgemäß abgehalten werden. Der Unterricht im Museum ist dabei fester Bestandteil des Schulstundenplans von der Vorschule bis hoch in die Gymnasien.
Abb. 8: Das Eisenbahnmuseum im September 2019. Foto: BK
Eisenbahnmuseum Skierniewice
Adresse:
Ul. Łowicka 1, 96-100 Skierniewice
Öffnungszeiten:
Nur bei Veranstaltungen
Der historische, bereits 1845 (!) in Teilen eröffnete Gebäudekomplex „Bahnbetriebswerk Skierniewice“ ist 1994 als europäisches Kulturgut anerkannt worden worauf die Museumsinitiatoren besonders stolz sind. In den Räumlichkeiten befindet sich eine Fahrzeugausstellung mit 24 Lokomotiven (davon 13 Dampflokomotiven), zahlreichen Wagen und einer für Europa einmaligen Spezialsammlung an Bahnkommunikationseinrichtungen. Das berühmteste Objekt des Museums ist jedoch keine Dampflokomotive, sondern der letzte weltweit erhaltene Akkutriebwagen der Bauart „Wittfeld“ aus dem Jahr 1913, der bis heute vor allem für deutsche Besucher ein Anziehungspunkt des Museums ist.
Neben der bahnhistorischen Arbeit ist das Museum Skierniewice auch stark im Veranstaltungsbereich aktiv, die Anlagen werden zum am Ende (finanziellen) Wohl der historischen Sammlung für Events verschiedenster Art genutzt.
Auch lohnt es sich, auf dem Gelände auf Spurensuche zu gehen - hatte Skierniewice doch den großen Vor- wie Nachteil, strategisch für die Frontversorgung in jedem Krieg ungemein wichtig gewesen zu sein. Im Oktober 1914 zerstörten deutsche Truppen das Betriebswerk, eilige Wiederherrichtungen waren sinnlos – im Dezember 1914 bereits waren es russische Truppen, die die Anlagen erneut zerstörten. Entmutigt flickte man nur notdürftig das Betriebswerk wieder zusammen. Leistungsfähigere Dampflokomotiven sorgten zudem dafür, dass ein Lokwechsel in Skierniewice nicht mehr zwingend erforderlich war, 1939 war der Standort nur noch eine kleine Remise mit ein paar Rangierlokomotiven. Doch der nächste Krieg ließ nicht lange auf sich warten, und abermals waren es deutsche Truppen, die die strategisch wichtige Lage der Stadt erkannten – diesmal aber nicht um den Feind aufzuhalten, sondern für eigene Zwecke. 1940/41 wurde das Bahnbetriebswerk massiv ausgebaut und war nun für die Bespannung von Nachschubzügen zur Ostfront zuständig, eine komplette Kolonne (50 Lokomotiven) tat hier zeitweise ihren Dienst. Das Kriegsende erlebten die Anlagen deutlich besser als das vorherige und der wichtige Transitverkehr DDR – UdSSR sorgte für ein weiteres Bedeutungswachstum des Standortes. Bis 1989 mit täglich verkehrenden Dampflokomotiven! In dieser Zeit begann auch das Engagement des Betreibervereins, der sich landesweit für die Erhaltung von historischen Lokomotiven einsetzte und 1992 das Angebot zur Übernahme des Bahnbetriebswerkes bekam. „Angebot“ heißt in Polen nicht unbedingt, dass die Sache mit einer Annahme erledigt ist. Und so dauerte es bis zum November 2002, bis die seit 1994 schon unter Denkmalschutz stehenden Anlagen vom Verein übernommen wurden und mit dem Aufbau des Museums begonnen werden konnte. Seither bemüht man sich um den Aufbau und führt regelmäßig Veranstaltungen durch, im Rahmen derer bereits eine Besichtigung der Anlagen möglich ist.
Abb. 9: Seit Jahren ein Problem ist der Zustand des wunderschönen Oberlichtdaches vom Lokschuppen. Nach viel Arbeits- und Geldeinsatz ist man mit der Restaurierung inzwischen weit fortgeschritten. F: BK
Eisenbahnmuseum Koscierzyna
Adresse:
ul. Tomawora 7, 83-400 Koscierzyna
Öffnungszeiten:
täglich 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Kohle ist nicht nur für die Geschichte der Dampflokomotive unerlässlicher Bestandteil, sondern auch für die Geschichte des Museumsstandortes Koscierzyna. Das alte Bahnbetriebswerk war ursprünglich nur für den regionalen Nebenbahnverkehr gebaut, doch war es die Verbindungslinie zwischen den schlesischen Minen und der Ostsee, die aus dem beschaulichen Standort einen Eisenbahnknoten machte.
Zum 01. November 1992 wurde der Regelbetrieb im Betriebswerk eingestellt und das Gelände am 12. November als offizielles Eisenbahnmuseum der polnischen Staatsbahn benannt, die Eröffnung erfolgte am 25. September 1993. Ursprünglich war man mit dem Ziel eines lebendigen Museumsbetriebswerkes mit ebenso wie Wolsztyn täglichem Dampfbetrieb angetreten, doch leider versackten die Touristenströme schnell und der Plan wurde aufgegeben. Wie schade denkt man, wenn man die beschaulichen Strecken der Gegend abfährt. Im Jahr 2009 übergab man das Museum in die Hände des Landesmuseums, das seither Betreiber ist.
Die Ausstellung präsentiert sich aus Platzgründen vor allem als Freilichtmuseum, der Lokschuppen ist nicht groß, dafür aber umso schöner. Nicht alle vor Ort befindlichen Lokomotiven lassen sich besichtigen, vor allem die zahlreichen Ty2/Ty42-Exemplare sind als eine Art Arbeitsvorrat für die Restaurierung in den Zufahrtsgleisen hinterstellt. Abseits der Dampflokomotiven ist für deutsche Besucher vor allem ein alter Berliner Vorkriegs-S-Bahn-Triebwagen interessant, den es 1951 in den Danziger Vorortverkehr verschlagen hatte.
Erwähnenswert ist ebenso die behindertengerechte Gestaltung des Areals. Insbesondere an blinde Menschen wurde gedacht, für sie gibt es allerlei pädagogisches Material wie spezielle fühlbare Modelle und diverse Erklärungsschilder in Blindenschrift.
Abb. 10: Eine Art Wahrzeichen des Museums ist der historische S-Bahn-Triebwagen aus Berlin, der lange im Vorortverkehr von Danzig fuhr. Foto: BK
Eisenbahnmuseum Pyskowice
Adresse:
ul. Piaskowa, 44-120 Pyskowice
Öffnungszeiten:
Besuch nach Voranmeldung theoretisch möglich
Sandbahn. Ein Begriff, der bei älteren Eisenbahnfreunden sofort Erinnerung an den wohl letzten großen Aufgesang schwerer Dampfgüterzüge in Europa erweckt. Einer der Beiden Betriebsmittelpunkte des legendären Sandbahnnetzes war Pyskowice, wo es einen Betriebshof von Staatsbahn und Sandbahn gab. Im Bahnbetriebswerk der Staatsbahn befindet sich heute das Museum, auch wenn der Begriff optimistisch wirkt.
Seit 1909 trafen sich in Pyskowice 3 große Sandbahnnetze – die Sandbahn der Schaffgott´schen Werke, die Sandbahn der Preußischen Hütten- und Bergwerks AG sowie die Sandbahngesellschaft der Gräfl. von Ballestremschen und Borsig´schen Steinkohlewerke. Waren anfangs riesige Borsig-Tenderlokomotiven im Einsatz (die auf Grund ihrer schieren Masse nicht in der Lage waren auf dem „normalen“ polnischen Bahnnetz zu fahren), übernahmen nach 1939 die typischen deutschen Güterzuglokomotiven der Baureihen 42, 44, 50 und 52 den Verkehr. Auch wenn schon in den 60er Jahren die Elektrifizierung dieses nun für die Republik Polen wichtigen Rohstoffreviers weitgehend abgeschlossen war, konnte auf die starken Dampflokomotiven nicht verzichtet werden. Bis 1993 waren vor allem die starken polnischen Eigenentwicklungen der Baureihe Ty51 noch Alltag vor den schweren Güterzügen.
Den Gedanken an eine museale und touristische Vermarktung verfolgte man seit 1978 – der Kindertag (ein in Polen wichtiger Feiertag) und das 35-jährige Jubiläum der Volksrepublik sollten gefeiert werden und man erinnerte sich an die im Vergleich zu den großen Maschinen zierliche Rangierlok Tp4-217, die kurzerhand betriebsfähig aufgearbeitet wurde. Immer wieder zog sie in den Folgejahren Besucherzüge mit Schülern und nicht zuletzt auch mit ausländischen Touristen durch die Anlagen – dem Auslandsreisebüro ORBIS und seinem Verhandlungsgeschick über die Lockerung des Fotografierverbotes sei Dank.
Direkt nach Ende des regulären Dampflokbetriebs engagierten sich vor allem britische Eisenbahnfreunde zusammen mit lokalen Helfern für den Erhalt der Hallen. Für ausländische Eisenbahnfreunde führte man eine Hauptuntersuchung an der Lok Ol49-12 durch, die dann nach Belgien ging. Das damit eingenommene Geld investierte man sinnvoll in den Ankauf einiger abgestellter Sandbahnloks. So präsentiert sich das Museum seit 1998 nicht nur als Eisenbahn-, sondern auch als Industriemuseum. 26 Dampflokomotiven mit größtenteils direktem Bezug zur Sandbahn befinden sich im Museum, besonders stolz ist man aber auf zwei Tender der amerikanischen Ty246, der heimlichen Lieblingslokomotive der dortigen Eisenbahner, auch wenn man leider vor Ort kein eigenes Exemplar erhalten konnte. Der Zustand fast der gesamten Sammlung ist jedoch besorgniserregend. Während vor allem Ty42-24 der Mittelpunkt des Interesses ist, stürzte unterdessen ein Teil des Lokschuppens in Pyskowice ein und noch mehr Loks müssen nun draußen stehen. Ungeschützt vor Diebstahl und Vandalismus, was im Umkehrschluss sich leider auch auf die Öffentlichkeitsarbeit auswirkt. Während man in den sozialen Medien sehr aktiv ist, wurde alleine den für die Erstellung dieses Buches beteiligten Personen trotz bestätigter Voranmeldung mehrfach der Zutritt verwehrt. Es bleibt spannend, wie die Sammlung mit diesem großen Potential sich weiter entwickelt! Die Entwicklung hängt wohl vor allem davon ab, ob Stadt, Verein und Staatsbahn einen gemeinsamen Nenner finden.
Schmalspurmuseen
Ein zweiter Band dieser Reihe beschäftigt sich mit den Schmalspurmuseen und schmalspurigen Museumsbahnen in Polen samt ihrer 187 Dampflokomotiven.
Die drei „zentralen Museen“ seien hier der Vollständigkeit halber benannt:
Museum für 600mm Spurweite in Wenecja
Adresse:
Museum, 88-410 Wenecja (Znin)
Öffnungszeiten:
Saisonabhängig
Ausstellung:
16 Dampflokomotiven, zahlreiche komplette Züge, Museumsbahn
Abb. 11: Loksammlung in Wenecja Foto: Robert Niedźwiedzki
Museum für 750mm Spurweite in Sochaczew
Adresse:Licealna 18, 96-500 SochaczewÖffnungszeiten:Di-So 09:00 Uhr – 17:00 UhrAusstellung:51 Dampflokomotiven, über 170 weitere Fahrzeuge, MuseumsbahnbetriebAbb. 12: Sochaczew – Standort eine der größten Schmalspursammlungen der Welt. Foto: Michał Klincewicz
Museum für 1000mm Spurweite in Gryfice
Adresse:
Błonie 2, 72-300 Gryfice
Öffnungszeiten:
So – Fr 08:00 Uhr – 19:00 Uhr Sa 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
Ausstellung:
14 Dampflokomotiven, 5 Triebwagen, diverse weitere Fahrzeuge. Zeitweise Museumsbahnbetrieb
Abb. 13: Die polnische Meterspursammlung befindet → sich in Gryfice. Foto: BK
4. Erhaltene Dampflokomotiven
4.1 Grundprinzip: Lokbezeichnung
Für den deutschen Eisenbahnfreund ist die Bezeichnung der polnischen Dampflokomotivbaureihen zunächst nicht ganz durchschaubar. Sie basiert jedoch von einzelnen Ausnahmen abgesehen auf einem logischen Prinzip, mit dem man sofort bei Lesen der Loknummer eine Ahnung von der Nutzung und den Abmessungen des Fahrzeugs bekommt.
4.1.1 Der erste Buchstabe
Der erste Buchstabe in der Baureihenbezeichnung gibt die Verwendungsart der Dampflokomotive an, und zwar:
Ein zweiter Großbuchstabe „K“ bezeichnet hierbei Tenderlokomotiven (von „kròtki lub kusy“), also Lokomotiven ohne einen angehängten Schlepptender, z.B. TKt48.
4.1.2 Der zweite (bzw. dritte) Buchstabe
In den polnischen Dampflokbezeichnungen stehen die kleinen Buchstaben für:
4.1.3 Die Zahl
Auch die Zahlen haben aufgeteilt in Zahlengruppen eine bestimmte Bedeutung, die sich mehr oder weniger auf die Lokomotivherkunft bzw. ihre Geschichte bezieht. Hierbei gibt es 5 Zahlengruppen, und zwar:
Die erhaltenen und in diesem Buch vorgestellten Dampflokomotiven lassen sich in 7 Gruppen einsortieren, und zwar:
Preußische Länderbahnlokomotiven: Dampfloks, die von der preußischen Staatsbahn entwickelt worden sind
Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn: Loktypen, die nach dem ersten Weltkrieg entwickelt/gebaut wurden und nach 1945 in Polen verblieben sind
Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten zwischen 1918 und 1939
Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten nach 1945
Werklokomotiven, also Dampflokomotiven, die für Industriebetriebe entwickelt wurden und meist auf Fabrikgeländen im Einsatz waren
Dampfspeicherlokomotiven, also feuerlose betriebene Lokomotiven, deren Kessel mit Dampf von außen gefüllt wird
Sonstige Lokomotiven – hier sind die amerikanischen, österreichischen usw. Lokomotiven zusammengefasst, da diese nur in geringer Stückzahl erhalten sind.
Abb. 14: Hier ein Beispiel: Die Beschriftung zeigt, dass es sich um eine Güterzuglok („T“) handelt, die keinen Schlepptender hat („K“). Die Achsfolge ist 1`D`1 („t“), sie wurde in Polen 1948 entwickelt („48“) und ist die 36te Lok der Baureihe („36“). Foto: BK
1. preußische Länderbahnlokomotiven
PKP-Nr.
Typ
KPEV-Nr.
DRB-Nr.
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Oi1-29
P6
319 Elberfeld
37 171
BMAG
3450
1905
Warszawa
Ok1-112
P8
2425 Altona
38 1698
Borsig
9076
1915
Kościerzyna
Ok1-198
P8
2465 Bromberg
38 2402
BMAG
6947
1919
Żagań
Ok1-258
P8
2624 Elberfeld
38 3272
Henschel
18376
1921
Warszawa?
Ok1-266
P8
3034 Elberfeld
38 3587
Schichau
2925
1921
Skierniewice
Ok1-322
P8
2580 Hannover
38 3192
LHW
2269
1921
Wolsztyn
Ok1-325
P8
2619 Elberfeld
38 3267
Henschel
18371
1921
Jaworzyna Śląska
Ok1-359
P8
2431 Posen
38 2155
BMAG
6388
1917
Wolsztyn
Oki1-28
T11
7560 Berlin
74 104
Borsig
5424
1904
Warszawa
Oki2-27
T12
8707 Berlin
74 1234
Borsig
9527
1916
Jaworzyna Śląska
Oko1-3
T18
8428 Essen
78 189
Vulcan
3610
1920
Warszawa
Pd5-17
S6
656 Altona
13 1247
LHW
934
1912
Skierniewice
TKb1479
1479 Berlin
Keine
BMAG
915
1877
Warszawa
TKc100-1
1462 Breslau
Keine
Henschel
3838
1893
Warszawa
TKh2-12
6162 Kattowitz
Keine
Union
537
1890
Jaworzyna Śląska
Tki3-26
T9.3
2118 Elberfeld
91 449
Hohenzollern
1593
1903
Jaworzyna Śląska
Tki3-87
T9.3
7247 Posen
91 1041
Union
1652
1908
Jarocin
Tki3-119
T9.3
7326 Posen
91 1696
Union
2049
1913
Warszawa
Tki3-120
T9.3
7336 Posen
91 1790
Union
2110
1914
Ostrów
Tki3-137
T9.3
7383 Danzig
91 719
Union
1751
1909
Skierniewice
TKp1-46
T13
7909 Bromberg
92 973
Union
2226
1915
Bydgoszcz
Tkt1-63
T14
8589 Berlin
93 108
Hohenzollern
3496
1916
Chabówka
TKw2-57
T16.1
8200 Essen
94 895
BMAG
6917
1919
Kraków
TKw2-114
T16.1
8132 Mainz
94 729
BMAG
5789
1916
Chabówka
Tp1-18
G7.1
1343 Magdeburg
55 274
LHW
260
1904
Tarnowskie Gori
Tp2-34
G7.2
4719 Cassel
55 860
Henschel
7409
1906
Jaworzyna Śląska
Tp3-36
G8
4832 Bromberg
55 2199
Hanomag
6712
1913
Skierniewice
Tp4-148
G8.1
5333 Kattowitz
55 3052
LHW
1539
1917
Czeremcha
Tp4-217
G8.1
5351 Hannover
55 4765
Borsig
10125
1918
Świeradowa-Zdroju
Tr 5-65
G8.1
5312 Stettin
55 5607
O&K
8961
1921
Wolsztyn
Tw1-90
G10
5495 Oppeln
57 1658
Borsig
10438
1919
Koscierzyna
Ty1-76
G12
5562 Elberfeld
58 1297
LHW
1866
1919
Wolsztyn
TKh 1-19
T3
Privatbahn
89 7491
O&K
1444
1905
Toruń-Kluczyki
TKh 1-20
T3
Privatbahn
89 7555
O&K
3673
1909
Sucha Beskidza
TKh 1-429
T3
1963 Breslau
keine
Hagans
430
1900
Rybnik
Tp4-259
G8.1
keine (mehr)
55 3347
LHW
2196
1921
Chabówka
Tr6-39
G8.2
keine (mehr)
56 2795
LHW
2616
1923
Warszawa
2. Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn
PKP-Nr.
Typ
DRB-Nr.
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Oi2-29
24
24 092
Schichau
3419
1940
Kościerzyna
Okl2-6
64
64 061
Union
2820
1928
Jaworzyna Śląska
Pm2-34
03
03 273
BMAG
10629
1936
Warszawa
Pm3-5
03.10
03 1015
BLW
14926
1940
Warszawa
TKt3-16
86
86 240
Schichau
3286
1935
Chabówka
Tr7-3
56 4103
O&K
13332
1941
Jaworzyna Śląska
Ty2-7
KDL 1
52 1956
Henschel
27284
1944
Lubaczów
Ty2-14
KDL 1
52 056
Henschel
26974
1942
Kartuzy
Ty2-16
KDL 1
52 005
Henschel
26844
1942
Wola-Rozwadów
Ty2-18
KDL 1
52 013
Henschel
26931
1942
Jaworzyna Śląska
Ty2-22
KDL 1
52 025
Henschel
26943
1942
Lubin
Ty2-29
KDL 1
52 053
Henschel
26971
1942
Nowy Sącz
Ty2-38
KDL 1
52 162
BMAG
12167
1942
Jaworzyna Śląska
Ty2-50
KDL 1
52 200
BMAG
12205
1943
Chabówka
Ty2-64
KDL 1
52 279
WLF
9651
1942
Dzierżoniów
Ty2-81
KDL 1
52 2112
Henschel
26868
1943
Jaworzyna Śląska
Ty2-140
KDL 1
52 461
Borsig
15558
1943
Nysa
Ty2-178
KDL 1
52 1162
DWM
576
1943
Kościerzyna
Ty2-220
KDL 1
52 1608
SACM
7875
1943
Tłuszcz
Ty2-223
KDL 1
52 2127
Henschel
26883
1943
Jaworzyna Śląska
Ty2-269
KDL 1
52 2353
Henschel
27521
1943
Łubiana
Ty2-305
KDL 1
52 2520
Henschel
27688
1943
Jaworzyna Śląska
Ty2-406
KDL 1
52 4770
MBA
13821
1943
Wolsztyn
Ty2-446
KDL 1
52 5134
OLW Krenau
1143
1943
Koscierzyna
Ty2-540
KDL 1
52 5605
Schichau
3883
1943
Legnica
Ty2-559
KDL 1
52 5657
Schichau
3935
1943
Kraków
Ty2-572
KDL 1
52 5702
Schichau
3993
1943
Warszawa
Ty2-666
KDL 1
52 6205
BMAG
12646
1943
Redecz Krukowy
Ty2-702
KDL 1
52 6340
BMAG
12793
1944
Lodz-Radogoszcz
Ty2-821
KDL 1
52 7328
WLF
16781
1943
Jaworzyna Śląska
Ty2-860
KDL 1
52 633
Schichau
4111
1944
Jabłonowo Pomorski
Ty2-911
KDL 1
52 1346
DWM
812
1944
Chabówka
Ty2-921
KDL 1
52 2301
Henschel
27469
1942
Szymbark
Ty2-927
KDL 1
52 2710
Henschel
27933
1944
Pyskowice
Ty2-930
KDL 1
52 2730
Henschel
27962
1944
Jaworzyna Śląska
Ty2-949
KDL 1
52 2794
Henschel
28358
1944
Jaworzyna Śląska
Ty2-953
KDL 1
52 2817
Henschel
28163
1944
Chabówka
Ty2-1035
KDL 1
52 3914
MBA
14168
1944
Wrocław
Ty2-1055
KDL 1
52 4995
MBA
14065
1944
Małaszewicze
Ty2-1086
KDL 1
52 5123
MBA
14327
1944
Leszno
Ty2-1098
KDL 1
52 5336
OLW Krenau
1363
1944
Koscierzyna
Ty2-1140
KDL 1
52 7508
Skoda
1606
1944
Zajaczkowo Tczewskie
Ty2-1169
KDL 1
52 7785
O&K
14369
1944
Jaworzyna Śląska
Ty2-1176
KDL 1
52 4541
DWM
857
1944
Nysa
Ty2-1184
KDL 1
52 2733
Henschel
27965
1944
Chabówka
Ty2-1226
KDL 1
52 6083
BMAG
12524
1943
Tłuszcz
Ty2-1258
KDL 1
52 2821
Henschel
28167
1944
ZNTK Oleśnica
Ty2-1279
KDL 1
52 3567
Krauss-Maffei
16704
1943
Gliwice
Ty2-1285
KDL 1
52 6058
BMAG
12498
1943
Ełk
Ty2-1292
KDL 1
52 1334
DWM
794
1944
Pyskowice
Ty2-1298
KDL 1
52 3286
Jung
11297
1944
Wolsztyn
Ty2-1301
KDL 1
52 7349
WLF
16802
1943
Koscierzyna
Ty2-1312
KDL 1
52 2482
Henschel
27650
1943
Pyskowice
Ty2-1387
KDL 1
52 2277
Henschel
27445
1943
Chojnice
Ty2-1401
KDL 1
52 1481
Esslingen
4705
1943
Kościerzyna
Ty2-1407
KDL 1
Ohne
ZNTK Poznań
Ohne
1964
Skierniewice
Ty2-2118
KDL 1
52 2118
Henschel
26874
1943
Kędzierzyn
Ty2-3458
KDL 1
52 3458
Krauss-Maffei
16584
1943
Pyskowice
Ty2-5680
KDL 1
52 5680
Schichau
3957
1943
Zabrze
Ty2- T€
KDL 1
52 7175
WLF
16628
1943
Koscierzyna
Ty3-2
KDL 3
42 1427
Schichau
4448
1944
Leszno
Ty5-10
50
50 451
Schichau
3413
1940
Wolsztyn
Ty5-16
50
50 1029
BMAG
11518
1940
Jaworzyna Śląska
3. Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten bis 1939 (Staatsbahn)
PKP-Nr.
Typ
DRB-Nr.
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Ok22-23
Ok22
38 4530
Chrzanów
339
1929
Jaworzyna Śląska
Ok22-31
Ok22
38 4536
Chrzanów
356
1929
Wolsztyn
OKl27-10
OKl27
75 1225
Cegielski
172
1930
Skierniewice
OKl27-26
OKl27
75 1253
Cegielski
223
1931
Warszawa
OKl27-27
OKl27
75 1254
Cegielski
230
1931
Gdynia-Grabowek
OKl27-41
OKl27
75 1278
Cegielski
270
1932
Chabówka
OKz32-2
OKz32
95 303
Cegielski
306
1934
Chabówka
Os24-7
Os24
33 215
Chrzanów
147
1927
Warszawa
Pm36-2
Pm36
18 602
Chrzanów
663
1937
Wolsztyn
Pt31-49
Pt31
19 149
Chrzanów
715
1938
Jaworzyna Śląska
Pt31-64
Pt31
19 164
Chrzanów
721
1938
Chabówka
Pu29-3
Pu29
12 201
Cegielski
200
1931
Warszawa
Ty23-104
Ty23
58 2563
Cegielski
139
1929
Chabówka
Ty23-145
Ty23
58 2729
Warszawska
355
1933
Jaworzyna Śląska
Ty23-273
Ty23
58 2505
Warszawska
130
1928
Skierniewice
Ty37-17
Ty37
58 2909
Cegielski
347
1939
Chabówka
4. Polnische Eigenentwicklungen und Nachbauten nach 1945 (Staatsbahn)
PKP-Nr.
Typ
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Ol49-1
Ol49
Chrzanów
2603
1951
Jarocin
Ol49-3
Ol49
Chrzanów
2605
1951
Torun
Ol49-4
Ol49
Chrzanów
2606
1951
Skierniewice
Ol49-7
Ol49
Chrzanów
2609
1951
Leszno
Ol49-8
Ol49
Chrzanów
2610
1951
Przeworsk
Ol49-9
Ol49
Chrzanów
2611
1951
Dzierżoniów
Ol49-11
Ol49
Chrzanów
2613
1952
Ełk
Ol49-12
Ol49
Chrzanów
2614
1952
Lisi Ogon
Ol49-15
Ol49
Chrzanów
2617
1952
Pyskowice
Ol49-20
Ol49
Chrzanów
2622
1952
Częstochowa
Ol49-21
Ol49
Chrzanów
2623
1952
Warszawa
Ol49-23
Ol49
Chrzanów
2625
1952
Leszno
Ol49-29
Ol49
Chrzanów
2631
1952
Stare Juchy
Ol49-34
Ol49
Chrzanów
2979
1952
Chełm
Ol49-38
Ol49
Chrzanów
2983
1952
Korsze
Ol49-44
Ol49
Chrzanów
2989
1952
Chabówka
Ol49-50
Ol49
Chrzanów
2998
1953
Torun
Ol49-59
Ol49
Chrzanów
3170
1953
Wolsztyn
Ol49-60
Ol49
Chrzanów
3171
1953
Leszno
Ol49-61
Ol49
Chrzanów
3172
1953
Dzierżoniów
Ol49-64
Ol49
Chrzanów
3175
1953
Jaworzyna Śląska
Ol49-69 (I)
Ol49
Chrzanów
3180
1953
Leszno
Ol49-71
Ol49
Chrzanów
3182
1953
Koscierzyna
Ol49-72
Ol49
Chrzanów
3186
1953
Tarnów
Ol49-79
Ol49
Chrzanów
3190
1953
Zduńska Wola
Ol49-80
Ol49
Chrzanów
3193
1953
Ełk
Ol49-81
Ol49
Chrzanów
3192
1953
Leszno
Ol49-82
Ol49
Chrzanów
3196
1953
Krzyż Wielkopolski
Ol49-85
Ol49
Chrzanów
3183
1954
Wolsztyn
Ol49-90
Ol49
Chrzanów
3202
1954
Pyskowice
Ol49-93
Ol49
Chrzanów
3205
1954
Jaworzyna Śląska
Ol49-99
Ol49
Chrzanów
3211
1954
Wolsztyn
Ol49-100
Ol49
Chrzanów
3214
1954
Chabówka
Ol49-102
Ol49
Chrzanów
3212
1954
Dzierżoniów
Ol49-111
Ol49
Chrzanów
4073
1954
Leszno "Puzzle"
Pt47-1
Pt47
Chrzanów
1851
1948
Lodz
Pt47-13
Pt47
Chrzanów
1863
1948
Skarżysko-Kamienna
Pt47-14
Pt47
Chrzanów
1864
1948
Stargard
Pt47-20
Pt47
Chrzanów
1870
1948
Wroclaw
Pt47-28
Pt47
Chrzanów
1878
1949
Jaworzyna Śląska
Pt47-50
Pt47
Chrzanów
1900
1949
Pyskowice
Pt47-65
Pt47
Chrzanów
2065
1949
Wolsztyn
Pt47-78
Pt47
Chrzanów
2078
1949
Jaworzyna Śląska
Pt47-93
Pt47
Chrzanów
2093
1950
Zduńska Wola
Pt47-101
Pt47
Cegielski
1282
1948
Jarocin
Pt47-104
Pt47
Cegielski
1302
1949
Warszawa
Pt47-106
Pt47
Cegielski
1304
1949
Wolsztyn
Pt47-112
Pt47
Cegielski
1310
1949
Wolsztyn
Pt47-121
Pt47
Cegielski
1322
1949
Kostrzyn nad Odra
Pt47-152
Pt47
Cegielski
1402
1949
Chabówka
Pt47-157
Pt47
Cegielski
1415
1950
Lublin
Pt47-171
Pt47
Chrzanów
2111
1950
Kościerzyna (als Pt47-100)
TKt48-6
TKt48
Cegielski
1532
1950
Czerwiensk
TKt48-18
TKt48
Cegielski
1544
1951
Jaworzyna Śląska
TKt48-23
TKt48
Cegielski
1549
1951
Pyskowice
TKt48-27
TKt48
Cegielski
1553
1951
Rzeszów
TKt48-29
TKt48
Cegielski
1555
1951
Stettin
TKt48-36
TKt48
Cegielski
1562
1951
Warszawa
TKt48-39
TKt48
Cegielski
1565
1951
Zduńska Wola
TKt48-53
TKt48
Chrzanów
2927
1951
Iława
TKt48-58
TKt48
Cegielski
1575
1951
Jelenia Gora
TKt48-67
TKt48
Chrzanów
2926
1951
Jaworzyna Śląska
TKt48-72
TKt48
Cegielski
1663
1951
Dzierżoniów
TKt48-77
TKt48
Cegielski
1670
1952
Jarocin
TKt48-99
TKt48
Chrzanów
4462
1955
Koscierzyna
TKt48-100
TKt48
Chrzanów
4463
1955
Jaworzyna Śląska
TKt48-102
TKt48
Chrzanów
4465
1955
Jaslo
TKt48-116
TKt48
Chrzanów
4479
1955
Łazieniec
TKt48-119
TKt48
Chrzanów
4482
1955
Wałbrzych
TKt48-124
TKt48
Chrzanów
4487
1955
Zagórz
TKt48-127
TKt48
Chrzanów
4490
1956
Opole
TKt48-130
TKt48
Chrzanów
4493
1956
Poznań
TKt48-138
TKt48
Chrzanów
4728
1956
Białowieża
TKt48-143
TKt48
Chrzanów
4733
1956
Wolsztyn
TKt48-146
TKt48
Chrzanów
4736
1956
Wroclaw
TKt48-147
TKt48
Chrzanów
4737
1956
Stefanowo
TKt48-151
TKt48
Chrzanów
4741
1956
Częstochowa
TKt48-163
TKt48
Chrzanów
4753
1956
Osielsko
TKt48-167
TKt48
Chrzanów
4757
1956
Kraków
TKt48-170
TKt48
Chrzanów
4760
1956
Tczew
TKt48-173
TKt48
Chrzanów
4763
1956
Jaworzyna Śląska
TKt48-177
TKt48
Chrzanów
4767
1956
Nowy Sacz
TKt48-179
TKt48
Chrzanów
4769
1956
Kościerzyna
TKt48-185
TKt48
Chrzanów
4775
1957
Jarocin
TKt48-186
TKt48
Chrzanów
4776
1957
Jaworzyna Śląska
TKt48-191
TKt48
Chrzanów
4781
1957
Chabówka
Ty42-1
KDL 1
Chrzanów
1506
1945
Jaworzyna Śląska
Ty42-9
KDL 1
Chrzanów
1514
1945
Zduńska Wola
Ty42-19
KDL 1
Chrzanów
1524
1945
Chabówka
Ty42-24
KDL 1
Chrzanów
1529
1945
Pyskowice
Ty42-39
KDL 1
Cegielski
881
1945
Kościerzyna
Ty42-44
KDL 1
Cegielski
895
1945
Pyskowice
Ty42-85
KDL 1
Chrzanów
1562
1945
Pyskowice
Ty42-105
KDL 1
Cegielski
936
1946
Kościerzyna
Ty42-107
KDL 1
Cegielski
938
1946
Chabówka
Ty42-118
KDL 1
Chrzanów
1602
1946
Chrzanów
Ty42-120
KDL 1
Chrzanów
1604
1946
Warszawa
Ty42-126
KDL 1
Chrzanów
1610
1946
Kościerzyna
Ty42-148
KDL 1
Chrzanów
1647
1649
Wolsztyn
Ty42-149
KDL 1
Chrzanów
1644
1946
Jarocin
Ty43-1
Ty43
Cegielski
963
1946
Pyskowice
Ty43-9
Ty43
Cegielski
994
1946
Chabówka
Ty43-17
Ty43
Cegielski
1045
1947
Warszawa
Ty43-23
Ty43
Cegielski
1110
1947
Jaworzyna Śląska
Ty43-74
Ty43
Cegielski
1253
1948
Zduńska Wola
Ty43-92
Ty43
Cegielski
1273
1948
Wolsztyn
Ty43-123
Ty43
Cegielski
1354
1949
Wolsztyn
Ty45-6
Ty45
Chrzanów
1584
1946
Dzierżoniów
Ty45-20
Ty45
Chrzanów
1598
1946
Jaworzyna Śląska
Ty45-39
Ty45
Cegielski
988
1946
Zduńska Wola
Ty45-94
Ty45
Chrzanów
1638
1947
Ostrów
Ty45-125
Ty45
Chrzanów
2592
1951
Pyskowice
Ty45-139
Ty45
Cegielski
1047
1947
Koscierzyna
Ty45-149
Ty45
Cegielski
1058
1947
Kluczbork
Ty45-158
Ty45
Cegielski
1068
1947
Pyskowice
Ty45-205
Ty45
Cegielski
1126
1947
Iłowo
Ty45-217
Ty45
Chrzanów
1752
1947
Tarnowskie Gori
Ty45-379
Ty45
Cegielski
1388
1949
Wolsztyn
Ty45-386
Ty45
Chrzanów
2546
1950
Chabówka
Ty45-421
Ty45
Chrzanów
2584
1950
Łazy
Ty45-2560
Ty45
Chrzanów
2560
1950
Grodzisk Mazowiecki
Ty51-1
Ty51
Cegielski
1980
1953
Skierniewice
Ty51-9
Ty51
Cegielski
1988
1954
Kraków
Ty51-15
Ty51
Cegielski
1994
1954
Sędziszów
Ty51-17
Ty51
Cegielski
1996
1954
Pyskowice
Ty51-37
Ty51
Cegielski
2131
1955
Rzepin
Ty51-133
Ty51
Cegielski
2425
1956
Sosnowiec
Ty51-137
Ty51
Cegielski
2429
1956
Chabówka
Ty51-138
Ty51
Cegielski
2430
1956
Kotlarnia
Ty51-140
Ty51
Cegielski
2432
1956
Jaworzyna Śląska
Ty51-182
Ty51
Cegielski
2474
1956
Chabówka
Ty51-183
Ty51
Cegielski
2475
1956
Poznań
Ty51-223
Ty51
Cegielski
2532
1957
Wolsztyn
Ty51-228
Ty51
Cegielski
2627
1958
Warszawa
5. Werklokomotiven
Lok-Nr.
Achsen
Bauart
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
TKb 10
B
Baziel
Chrzanów
1725
1948
Zduńska Wola
Tkb3-129
B
Victor
Hohenzollern
129
1880
Warszawa
TKb-2845
B
-
LHB
2845
1924
Kościerzyna
TKb 10672
B
-
O&K
10672
1925
Skierniewice
TKh 100-5
C
T3
Henschel
1949
1885
Chabówka
TKh 100-45
C
Hannibal
Krupp
1770
1938
Koscierzyna
Tkh 100-51
C
ELNA 4
O&K
11688
1928
Łazy
TKh 9336
C
-
O&K
9336
1920
Warszawa
TKh 49-1
C
Ferrum 47
Chrzanów
5695
1961
Chabówka
TKh 0175
C
Ferrum 47
Chrzanów
4938
1957
Chabówka
TKh 643
C
Ferrum 47
Chrzanów
2181
1949
Piła
TKh 2191
C
Ferrum 47
Chrzanów
2191
1950
Białowieża
TKh 2873
C
Ferrum 47
Chrzanów
2873
1951
Pyskowice
TKh 2942
C
Ferrum 47
Chrzanów
2942
1951
Węgliniec
TKh 2949
C
Ferrum 47
Chrzanów
2949
1952
Skierniewice
TKh 3140
C
Ferrum 47
Chrzanów
3140
1954
Koscierzyna
TKh 3145
C
Ferrum 47
Chrzanów
3145
1954
Sosnowiec
TKh 4027
C
Ferrum 47
Chrzanów
4027
1955
Zduńska Wola
TKh 05353
C
Ferrum 47
Chrzanów
3121
1953
Wroclaw
TKh 5376
C
Ferrum 47
Chrzanów
5376
1956
Jarocin
TKh 5380
C
Ferrum 47
Chrzanów
5380
1956
Pyskowice
TKh 5564
C
Ferrum 47
Chrzanów
5564
1959
Torun
TKh 5697
C
Ferrum 47
Chrzanów
5697
1961
Pyskowice
TKh 5699
C
Ferrum 47
Chrzanów
5699
1961
Tczew
Huta Szczecin 6
C
Ferrum 47
Chrzanów
3877
1958
Stettin
HL 16
D
Śląsk
Chrzanów
2239
1950
Kraków
TKp 5
D
Śląsk
Chrzanów
6041
1962
Jaworzyna Śląska
TKp 20
D
Śląsk
Chrzanów
6289
1963
Zduńska Wola
TKp 101
D
Śląsk
Chrzanów
2013
1950
Przezchlebie
TKp 2011
D
Śląsk
Chrzanów
2011
1950
Chabówka
TKp 2241
D
Śląsk
Chrzanów
2241
1950
Bydgoszcz
TKp 2261
D
Śląsk
Chrzanów
2261
1951
Pyskowice
TKp 2816
D
Śląsk
Chrzanów
2816
1952
Wieliczka
TKp 3409
D
Śląsk
Chrzanów
3409
1957
Gliwice
TKp 4409
D
Śląsk
Chrzanów
4409
1955
Pyskowice
TKp 4422
D
Śląsk
Chrzanów
4422
1955
Pyskowice
TKp 5161
D
Śląsk
Chrzanów
5161
1957
Pyskowice
TKp 6042
D
Śląsk
Chrzanów
6042
1962
Skierniewice
TKp 6046
D
Śląsk
Chrzanów
6046
1961
Pyskowice
TKp 12800
D
Śląsk
Chrzanów
2263
1951
Gliwice
TKp 15132
D
Śląsk
Chrzanów
3399
1957
Pyskowice
TKp 102
D
Oberschlesien
Krenau
982
1942
Skierniewice
TKp 4147
D
-
La Meuse
4147
1942
Warszawa
TKp 15347
D
-
Borsig
15347
1943
Warszawa
TKp 26188
D
Essen
Henschel
26188
1944
Białowieża
6. Dampfspeicherlokomotiven
Loknr.
Typ
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Huta Szczecin 4
???
Borsig
8464
1912
Wolsztyn
TKbb 2747
???
O&K
2747
1908
Żyrardów
TKbb 9690
???
Borsig
9690
1917
Tarnowskie Gori
TKbb 10282
FL
Hanomag
10282
1934
Warszawa
TKbb Nr1
1U
Chrzanów
4701
1956
Nieznane
TKbb 4695
1U
Chrzanów
4695
1956
Czachówek
TKbb 4719
1U
Chrzanów
4719
1957
Gliwice
TKbb 14813
1U
Chrzanów
4696
1956
Jaworzyna Śląska
7. Sonstige
PKP-Nr.
ex-Nr.
ex-Bahn
Hersteller
Fabr.-Nr.
Baujahr
Standort
Ol12-7
35 817
kkStB
StEG
3849
1912
Chabówka
OKa1-1
Tk 235
LVD (Lettland)
Krupp
1197
1931
Warszawa
TKh 12-6322
97 254
kkStB
Krauss
6322
1910
Tarnowskie Gori
TKi 100-16
PLB
Borsig
14528
1934
Warszawa
TKp 100-4
PLB
Wolf
1149
1924
Koscierzyna
Tkz 211
Sandbahn
Borsig
14714
1938
Warszawa
Tr12-25
56 3522
kkStB
WLF
2696
1921
Chabówka
Tr201-51
Direktlieferung
Lima, Ohio
8823
1945
Jaworzyna Śląska
Tr202-19
Direktlieferung
Vulcan
5405
1946
Chabówka
Tr202-28
Direktlieferung
Vulcan
5448
1946
Jaworzyna Śląska
Tr203-296
Direktlieferung
Alco
70787
1943
Jaworzyna Śląska
Tr203-451
Direktlieferung
Lima, Ohio
8739
1945
Warszawa
Tr21-53
Direktlieferung
Haine-Saint-Pierre
1394
1924
Karsznice
Tw12-12
57 344
kkStB
StEG
4423
1920
Chabówka
Ty246-22
Direktlieferung
Alco
75506
1947
Karsznice
Anmerkung:
Da einige Lokhersteller ihre Namen öfters änderten wurde hier zur besseren Übersicht eine einheitliche Benennung gewählt, ausgenommen Zeiten der Fremdherrschaft. Besondere Beachtung gilt dabei zwei polnischen Fabriken – zur besseren Lesbarkeit hier nur die Kurzformen:
Cegielski
, gegründet 1846, ab 1880 H. Cegielski, Posen (ab 1889 AG), 1939 – 1945 Teil der „DWM – Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken“, 1945 – 1953 HCM Cegielski, 1953 - 1956 ZISPO („Metallwerke Josef Stalin Poznań“), nach 1956 „H. Cegielski“
Im Buch durchgehend als „Cegielski“ bezeichnet.
Fablok
Chrzanów
, 1919 – 1939 „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w. Polsce, Chrzanów“, 1939 – 1941 „Erste Lokomotivfabrik in Polen AG, Chrzanów (beide abgekürzt mit „Chrzanów“), 1941 – 1946 Oberschlesische Lokomotivwerke Krenau, 1947 – 1976 „Fablok Chrzanów“, 1977 – 2009 „BUMAR-FABLOK“
Im Buch durchgehend als „Chrzanów“ bezeichnet.
Abb. 15: Landkarte Polen mit Standort und Anzahl der erhaltenen Dampflokomotiven (Normalspur)
4.2. preußische Länderbahnlokomotiven
Das Vorhandensein preußischer Dampflokomotiven bei der polnischen Staatsbahn hat natürlich historisch bedingte Gründe. Aus Großteilen der alten preußischen Provinzen Westpreußen und Posen entstand die „Zweite Polnische Republik“ in sich regelmäßig auf Grund kriegerischer Auseinandersetzungen ändernden Grenzen. Mit Gründung der PKP – der polnischen Staatsbahn – im Jahr 1920 fanden sich daher vor allem preußische Lokomotiven in dem jungen Land wieder, die mitsamt der Gebiete Eigentum des Staates wurden. In der chaotischen Nachkriegszeit des ersten Weltkrieges war es schon für Politiker kaum möglich, einen wirklichen Überblick über das Land zu bekommen, für die Eisenbahn war es nicht leichter.
Vorsichtige Quellenschätzungen sprechen von 3.074 preußischen Dampflokomotiven, die sich bei Gründung der PKP auf polnischem Gebiet befanden incl. einiger in der freien Hansestadt Danzig vorhandener Loks. Die Zahl wird nicht genau stimmen, gibt aber einen ungefähren Blick auf die Größenordnung.
Es kamen Neubauprojekte der polnischen Staatsbahn, es kamen Nachbauten preußischer Lokomotiven in nun polnischen Fabriken, und es kam 1939 und das erneute Verschwinden Polens von der Landkarte. 6 Jahre schrecklicher Krieg und am Ende ein völlig durcheinander gewürfeltes Land mit einem wenngleich auch kleinen Vorteil: Die Siegermächte, Befreier oder wie sie gerade je nach Landesteil genannt wurden haben eine sehr genaue Aufzeichnung über die vorhandenen Lokomotiven gemacht.
Mit Ende des zweiten Weltkrieges waren es exakt 2.439 Lokomotiven preußischer Bauart, die sich auf polnischem Gebiet wiederfanden. Stimmt diese Zahl? Nein, denn sie war höher – die sowjetischen Streitkräfte verfügten über weitere preußische Lokomotiven für ihre Militärzüge die zwar in Polen fuhren, aber nicht oder erst nach vielen Jahren in den polnischen Lokbestand übernommen wurden. Auch war es durchaus üblich, Loktausche zu machen: Schlechte Militärloks gegen gute Staatsbahnloks, so waren die Jahre 1945/46/47 geprägt vom ständigen Wechsel des tatsächlichen Lokbestandes. Da das nicht unbedingt immer von oben abgesegnet war, hat man schlichtweg die Loknummern geändert – also als Beispiel die eigene schlechte 91 111 gegen die in gutem Zustand befindliche 91 444 getauscht, an die man dann aber 91 111 wieder ran schrieb.