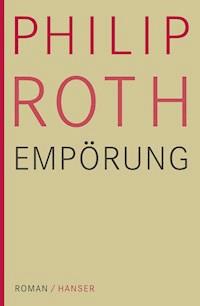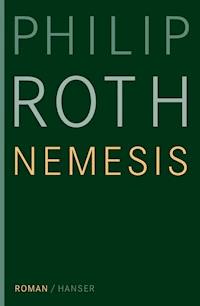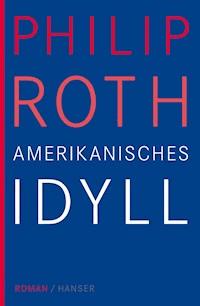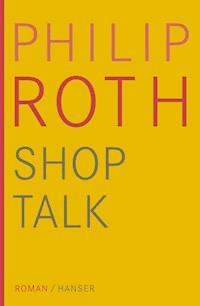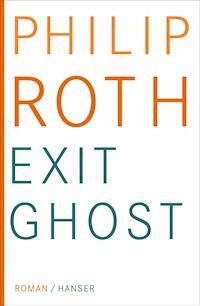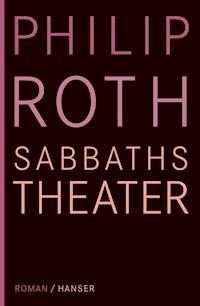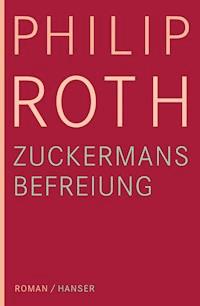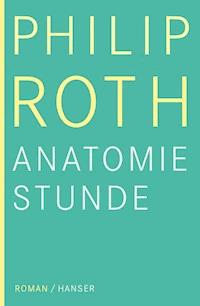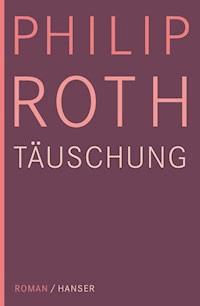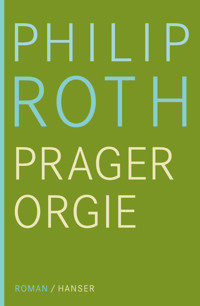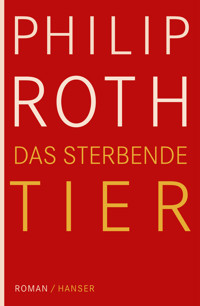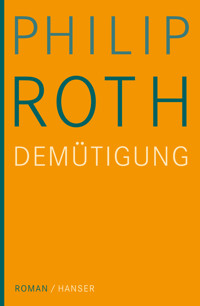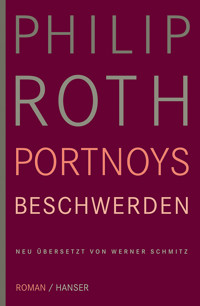
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist Anwalt, 33 und hat nur eines im Kopf: Sex. Ob Alexander Portnoy in der Öffentlichkeit onaniert, es mit einem Stück Leber treibt oder seine Freundin zu einem Dreier nötigt - stets ist er hin- und hergerissen zwischen Begierden, die mit seinem Gewissen unvereinbar sind, und einem Gewissen, das mit seinen Begierden unvereinbar ist. Beim Psychiater lässt er sein verwirrtes Leben Revue passieren. Mit "Portnoys Beschwerden" hat Philip Roth eine brillante Satire geschrieben und zugleich den Prototyp des Sexualneurotikers erfunden. Vierzig Jahre nach der Erstveröffentlichung hat der Weltbestseller in einer Neuübersetzung nichts von seiner überschäumenden Komik eingebüßt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Philip Roth
Portnoys Beschwerden
Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1969 unter dem Titel
Portnoy’s Complaint bei Random House in New York.
Der Titel erschien erstmals 1970 bei Rowohlt auf Deutsch.
Die vorliegende Übersetzung wurde vom
Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
»Leda und der Schwan« von W.B. Yeats auf S. 202 wird zitiert
in der Übersetzung von Peter Gan
ISBN 978-3-446-25124-3
© 1967, 1968, 1969, 1994 by Philip Roth
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2009/2015
Umschlag: © Peter-Andreas Hassiepen
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Portnoys Beschwerden
Portnoys Beschwerden (|portnois be|∫we:rdən) f. [nach Alexander Portnoy (1933– )] eine durch den anhaltenden Konflikt zwischen stark empfundenen moralischen und altruistischen Regungen mit übermäßigem sexuellen Verlangen oftmals perversen Charakters gekennzeichnete Persönlichkeitsstörung. Spielvogel: »Typisch ist das vermehrte Auftreten von Exhibitionismus, Voyeurismus, Fetischismus, Autoerotik und Oralverkehr; aufgrund der ›Moralität‹ des Patienten kommt es jedoch weder durch phantasierte noch durch tatsächlich vollzogene Akte zu echter sexueller Befriedigung, sondern vielmehr zu alles andere überlagernden Schamgefühlen und Angst vor Bestrafung, insbesondere in Form von Kastration« (Spielvogel, O.: »Der verwirrte Penis«, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, Vol. XXIV, S. 909). Spielvogel nimmt an, dass viele dieser Symptome sich auf die in der Mutter-Kind-Beziehung obwaltenden Bindungen zurückführen lassen.
Der unvergesslichste Mensch, den ich kenne
Sie war so tief in mein Bewusstsein eingebettet, dass ich während meines ganzen ersten Schuljahres geglaubt zu haben scheine, alle meine Lehrerinnen seien meine Mutter in Verkleidung. Tag für Tag, wenn die Glocke den Unterrichtsschluss verkündete, lief ich nach Hause und fragte mich dabei, ob ich es wohl einmal schaffen würde, in unserer Wohnung anzukommen, bevor sie mit ihrer Rückverwandlung fertig wäre. Und jedes Mal war sie, wenn ich ankam, bereits in der Küche und stellte mir meine Milch und Kekse hin. Ein Kunststück, dass mich jedoch nicht dazu bewegte, meinen Irrglauben aufzugeben, sondern meinen Respekt vor ihren Fähigkeiten nur noch vergrößerte. Andererseits war ich jedes Mal erleichtert, sie nicht in irgendeinem Zwischenstadium ihrer Inkarnationen erwischt zu haben – versuchte es aber immer wieder; ich wusste, mein Vater und meine Schwester ahnten nichts vom wahren Wesen meiner Mutter, und die Last des Verrats, die mir, so bildete ich mir ein, aufgebürdet würde, sollte ich sie jemals unversehens ertappen, war mehr, als ich mit meinen fünf Jahren auf mich zu nehmen bereit war. Vielleicht fürchtete ich sogar, man könnte mich ins Jenseits befördern, sollte ich mit eigenen Augen sehen, wie sie aus der Schule durchs Schlafzimmerfenster geflogen kam oder aus ihrem unsichtbaren Zustand Stück für Stück in ihre Schürze schlüpfte.
Natürlich erzählte ich ihr gewissenhaft alles von meinem Tag im Kindergarten, wenn sie mich darum bat. Ich tat nicht so, als verstünde ich die ganze Tragweite ihrer Allgegenwart, aber dass sie damit herausfinden wollte, was für ein kleiner Junge ich war, wenn ich sie nicht in meiner Nähe wähnte – davon war ich überzeugt. Diese Phantasievorstellung, die sich (in dieser speziellen Form) bis ins erste Schuljahr hielt, hatte zur Folge, dass ich glaubte, mir bleibe nichts anderes übrig, als ehrlich zu werden.
Ach, und geistreich. Von meiner blassen, übergewichtigen älteren Schwester pflegte meine Mutter zu sagen (in Hannahs Gegenwart natürlich: auch sie hatte es mit Ehrlichkeit): »Das Kind ist kein Genie, aber wir verlangen ja auch nicht das Unmögliche. Gott segne sie, sie ist fleißig, sie kennt ihre Grenzen, und daher bin ich mit allem zufrieden, was sie nach Hause bringt.« Von mir, dem Erben ihrer langen ägyptischen Nase und ihres klug schwatzenden Mundes, von mir pflegte meine Mutter mit charakteristischer Zurückhaltung zu sagen: »Dieser bandit? Der braucht nicht mal ein Buch aufzuschlagen – in allen Fächern eine Eins. Albert Einstein der Zweite!«
Und wie nahm mein Vater das alles auf? Er trank – natürlich nicht Whiskey wie ein Goj, sondern Petroleum und Magnesiamilch; und kaute Exlax-Tabletten; und aß morgens und abends Allbran-Flocken; und verputzte gemischtes Dörrobst pfundweise. Er litt – und wie er litt! – an Verstopfung. Ihre Allgegenwart und seine Verstopfung, meine Mutter, die durchs Schlafzimmerfenster hereingeflogen kam, mein Vater, der mit einem Zäpfchen im Hintern die Abendzeitung las … das, Doktor, sind die frühesten Eindrücke, die ich von meinen Eltern empfangen habe, von ihren Eigenarten und Geheimnissen. Er ließ getrocknete Sennesblätter in einem Kochtopf ziehen, und das, zusammen mit dem unsichtbar in seinem Rektum schmelzenden Zäpfchen, machte seine Zauberkraft aus: wie er diese geäderten grünen Blätter einkochte, die übelriechende Flüssigkeit mit einem Löffel umrührte, behutsam in ein Glas abseihte und von dort, durch seine erschöpfte Leidensmiene hindurch, in seinen obstipierten Leib beförderte. Und dann schweigend über dem leeren Glas kauerte, als lauschte er fernem Donner, und auf das Wunder wartete … Als kleiner Junge saß ich manchmal in der Küche und wartete mit ihm. Aber das Wunder geschah nie, jedenfalls nicht so, wie wir es uns vorstellten und erhofften, als ein Aufheben der Strafe, als vollständige Erlösung von der Plage. Ich erinnere mich, wie er, als man im Radio von der Explosion der ersten Atombombe berichtete, die Worte sprach: »Vielleicht würde das mir helfen.« Aber kein Abführmittel war diesem Mann gewachsen: Zorn und Enttäuschung hielten seine kischkes eisern umklammert. Und dann auch noch dies Ungemach: Ich war der Liebling seiner Frau.
Erschwerend kam hinzu, dass auch er mich liebte. Auch er sah in mir die Gelegenheit für die Familie, »so gut wie alle anderen« zu sein, unsere Chance, Ehre und Respekt einzuheimsen – auch wenn er, als ich klein war, seine Ziele in Bezug auf meine Person hauptsächlich vom finanziellen Standpunkt aus formulierte. »Sei nicht dumm wie dein Vater«, scherzte er mit dem kleinen Jungen auf seinem Schoß, »heirate keine Schöne, heirate keine aus Liebe – heirate eine Reiche.« Nein, nein, er mochte es ganz und gar nicht, dass man auf ihn herabsah. Er schuftete wie ein Tier – allein für eine Zukunft, die ihm nicht beschieden war. Niemand konnte ihn je zufriedenstellen, ihm seinen Einsatz entgelten – meine Mutter nicht, ich nicht, nicht einmal meine liebevolle Schwester, deren Mann er noch immer für einen Kommunisten hält (obwohl er heute Teilhaber eines profitablen Limonadeherstellers ist und ein Haus in West Orange besitzt). Und schon gar nicht jener milliardenschwere protestantische Laden beziehungsweise das »Institut«, wie die sich gern selbst bezeichnen), von dem er bis zum Letzten ausgebeutet wurde. »DAS WOHLTÄTIGSTE GELDINSTITUT AMERIKAS«, hatte mein Vater verkündet, als er mich zum ersten Mal mitnahm, um mir den kleinen Raum mit seinem Schreibtisch und Stuhl in dem riesigen Bürogebäude von Boston & North-eastern Life vorzuführen. Ja, mit Stolz sprach er vor seinem Sohn von der »Firma«; sinnlos, sich zu erniedrigen, indem er öffentlich über sie herzog – schließlich hatten sie ihm während der Wirtschaftskrise einen Lohn gezahlt; sie versahen ihn mit Briefpapier, auf das unter eine Abbildung der Mayflower, ihr Markenzeichen (und damit letztlich auch seins, haha), sein Name gedruckt war; und aus der Fülle ihrer Wohltätigkeit heraus spendierten sie ihm und meiner Mutter jedes Frühjahr ein schickes Wochenende in Atlantic City, in einem vornehmen gojischen Hotel, man stelle sich vor, wo sie sich (zusammen mit allen anderen Versicherungsvertretern in den mittelatlantischen Bundesstaaten, die ihre jährlichen Verkaufsprognosen übertroffen hatten) vom Portier, vom Kellner, vom Pagen und erst recht von den verwunderten zahlenden Gästen einschüchtern lassen mussten.
Zudem glaubte er leidenschaftlich an das, was er verkaufte, und auch das bereitete ihm Qualen und zehrte an seinen Kräften. Er rettete nicht nur seine eigene Seele, wenn er sich nach dem Abendessen in Hut und Mantel warf und noch einmal aufbrach, um seine Arbeit fortzusetzen – nein, das tat er auch, um irgendeinen armen Schlucker zu retten, der drauf und dran war, seine Versicherungspolice verfallen zu lassen und damit, sollte er »in den Regen geraten«, die Sicherheit seiner Familie zu gefährden. »Alex«, pflegte er mir zu erklären, »ein Mann muss einen Schirm haben, für den Fall, dass es einmal regnet. Man lässt Frau und Kind nicht ohne Schirm im Regen stehen!« Ich mit meinen fünf oder sechs Jahren fand dieses Argument vollkommen vernünftig und geradezu anrührend, ganz anders jedoch reagierten auf seine Regenrede die unerfahrenen Polen, die ungehobelten Iren und die ungebildeten Neger in den verarmten Bezirken, die ihm vom WOHLTÄTIGSTEN GELDINSTITUT AMERIKAS zur Kundenakquise zugewiesen worden waren.
Sie lachten ihn aus, die Leute in den Slums. Sie hörten ihm nicht zu. Wenn er bei ihnen anklopfte, schmissen sie ihre leeren Flaschen an die Tür und riefen: »Hau ab, keiner da.« Sie hetzten ihre Hunde auf ihn, auf dass sie ihre Zähne in seinen aufdringlichen Judenhintern senkten. Und doch gelang es ihm im Lauf der Jahre, für seine Verdienste um die Firma so viele Plaketten und Urkunden und Medaillen anzusammeln, dass er damit eine ganze Wand des langen fensterlosen Flurs schmücken konnte, wo die Kartons mit unserem Pessach-Geschirr standen und unsere »orientalischen« Läufer mumiengleich in dicke Teerpappe gewickelt über den Sommer eingelagert waren. Wenn er das Unmögliche möglich machte, würde die Firma ihn dann nicht ihrerseits mit einem Wunder belohnen? Könnte »Der Direktor« oben in der »Zentrale« nicht Wind von seiner Leistung bekommen und ihn über Nacht von einem Vertreter mit fünftausend im Jahr zu einem Bezirksleiter mit fünfzehntausend machen? Aber sie ließen ihn, wo sie ihn hatten. Wer sonst würde so unfruchtbare Äcker mit so unglaublichen Resultaten bearbeiten? Im Übrigen hatte es in der gesamten Geschichte von Boston & Northeastern noch niemals einen jüdischen Bezirksleiter gegeben (Nicht Ganz Unsere Klasse, Meine Liebe, wie man auf der Mayflower zu sagen pflegte), und mit seiner achtjährigen Schulausbildung eignete sich mein Vater auch nicht gerade für die Rolle eines Jackie Robinson der Versicherungsbranche.
Ein Bildnis von N. Everett Lindabury, dem Direktor von Boston & Northeastern, hing bei uns im Flur. Die gerahmte Fotografie war meinem Vater verliehen worden, nachdem er seine erste Million in Form von Versicherungen verkauft hatte, oder vielleicht auch erst, als er die Zehn-Millionen-Grenze überschritten hatte. »Mr. Lindabury«, »Die Zentrale« … aus dem Munde meines Vaters klang das für mich wie Roosevelt und das Weiße Haus in Washington … und dazu seine ständigen Tiraden, wie sehr er diese Leute allesamt verabscheute, insbesondere Lindabury mit seinen Fusselhaaren und seinem forschen New-England-Akzent, die Söhne auf dem Harvard College und die Töchter auf dem Mädchenpensionat, oh, dieses ganze Pack da oben in Massachusetts, diese schkozim mit ihren Fuchsjagden und Polopartien! (so hörte ich ihn eines Abends hinter seiner Schlafzimmertür brüllen) – die ihn, verstehen Sie, mit diesem Getue daran hinderten, in den Augen seiner Frau und seiner Kinder ein Held zu sein. Welch ein Zorn! Was für eine Wut! Und niemand da, an dem er das auslassen konnte – außer an sich selbst. »Warum kann ich keinen Stuhlgang haben –- ich bin doch mit Dörrpflaumen vollgestopft! Warum muss ich diese Kopfschmerzen haben! Wo ist meine Brille! Wer hat meinen Hut genommen!«
So grimmig und selbstzerstörerisch, wie so viele jüdische Männer seiner Generation ihren Familien dienten, diente mein Vater meiner Mutter, meiner Schwester Hannah, vor allem aber mir. Wo er eingekerkert war, sollte ich fliegen: Das war sein Traum. Entsprechend träumte ich davon, dass in meiner Befreiung die seine läge – aus Unwissenheit, Ausbeutung und Anonymität. Bis zum heutigen Tag bleiben unsere Schicksale in meiner Vorstellung miteinander verknüpft, und immer noch kommt es allzu häufig vor, dass ich, wenn ich in einem Buch eine Passage lese, die mich mit ihrer Logik oder ihrer Klugheit beeindruckt, sogleich und unwillkürlich denken muss: »Wenn er das nur lesen könnte. Ja! Lesen – und verstehen!« Immer noch Hoffnung, sehen Sie, immer noch dieses Wenn-doch-nur, und das mit dreiunddreißig Jahren … In meinem ersten Jahr am College, als ich gar noch mehr der Sohn war, der sich abmühte, den Vater dazu zu bringen, zu verstehen – damals, als es schien, es gelte entweder sein Verstehen oder sein Leben – ich erinnere mich, dass ich das Bestellformular aus einer dieser Intellektuellenzeitschriften riss, die ich selbst gerade erst in der Collegebibliothek zu entdecken begann, seinen Namen und unsere Anschrift dort eintrug und ein anonymes Geschenk-abonnement bestellte. Doch als ich mürrisch und streitsüchtig über Weihnachten nach Hause kam, war die Partisan Review nirgends zu sehen. Collier’s Hygeia, Look, aber wo war seine Partisan Review? Ungeöffnet fortgeworfen – dachte ich in meiner Arroganz und Schwermut –, ungelesen in den Müll gewandert, für Werbepost gehalten von diesem schmuck, diesem Schwachkopf, diesem Philister von Vater!
Ich erinnere mich – um in der Geschichte meiner Entzauberung noch weiter zurückzugehen –, ich erinnere mich an einen Sonntagvormittag: Ich werfe meinem Vater einen Baseball zu und warte dann vergeblich, ihn hoch über meinen Kopf davonfliegen zu sehen. Ich bin acht, und zum Geburtstag habe ich meinen ersten Fanghandschuh, einen Ball und einen richtigen Schläger geschenkt bekommen, der noch viel zu schwer für meine kindlichen Kräfte ist. Mein Vater war seit dem frühen Morgen in Hut, Mantel, Fliege und schwarzen Schuhen mit seinem dicken Inkassobuch unterwegs gewesen, in das er einträgt, wer Mr. Lindabury wie viel schuldig ist. Er begibt sich an jedem einzelnen Sonntagmorgen ins Viertel der Schwarzen, weil das, erklärt er mir, die beste Zeit ist, diejenigen zu erwischen, die sich davor drücken wollen, die lumpigen zehn oder fünfzehn Cent zu zahlen, die zur Begleichung ihrer wöchentlichen Prämienzahlungen erforderlich sind. Er schleicht dort herum, wo die Männer in der Sonne sitzen, und versucht ihnen ein paar Münzen zu entlocken, bevor sie sich mit ihrem »Morgan Davis«-Wein bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben; er springt wie der Blitz aus engen Gassen hervor, um die frommen Putzfrauen, die an Wochentagen in anderer Leute Häusern arbeiten und sich am Abend vor ihm verstecken, beim Kirchgang abzufangen. »Oh-oh!«, ruft eine, »der Versicherungsmann ist da!«, und selbst die Kinder rennen in Deckung – die Kinder, sagt er angewidert, und dann erklär mir mal, was haben diese Nigger noch für Hoffnung, ihr Los jemals zu verbessern? Wie sollen sie jemals emporkommen, wenn sie nicht einmal fähig sind, die Bedeutung einer Lebensversicherung zu erfassen? Sind ihnen die Angehörigen, die sie hinterlassen, vollkommen schnurzegal? Denn auch sie werden alle einmal sterben – »oh«, sagt er wütend, »und ob sie alle sterben werden!« Bitte, was ist das für ein Mann, der seine Kinder im Regen stehenlässt – ohne einen anständigen Schirm!
Wir sind auf dem großen Aschenplatz hinter meiner Schule. Er legt sein Inkassobuch auf die Erde und tritt in Mantel und braunem Filzhut auf das Schlagmal. Er trägt eine eckige Stahlbrille, und sein Haar (das jetzt ich trage) ist ein wildes Büschel von der Farbe und Beschaffenheit von Stahlwolle; und diese Zähne, die über Nacht in einem Glas im Bad liegen und die Toilettenschüssel angrinsen, grinsen jetzt mich an, seinen geliebten Sohn, sein Fleisch und sein Blut, den kleinen Jungen, auf dessen Haupt kein Regen jemals fallen soll. »Okay, großer Baseballstar«, sagt er und packt meinen neuen Schläger irgendwo in der Mitte – und zu meiner Verblüffung mit der linken Hand dort, wo eigentlich die rechte hingehört. Plötzlich überkommt mich unendliche Trauer. Ich möchte zu ihm sagen: Hey, du hältst die Hände falsch, bringe es aber nicht fertig, aus Angst, ich könnte in Tränen ausbrechen – oder womöglich er selbst! »Na los, Großer, wirf den Ball«, ruft er, und das tue ich dann auch – und muss natürlich erfahren, dass er zusätzlich zu allem anderen, was ich gerade von meinem Vater zu denken beginne, auch nicht »King Kong« Charlie Keller ist.
Toller Schirm.
Wenn jemandem alles gelang, dann war es meine Mutter, die selbst zugeben musste, es könnte sogar sein, dass sie im Grunde zu gut war. Und war es einem kleinen Kind mit meiner Intelligenz und meiner Beobachtungsgabe möglich, daran zu zweifeln? Sie konnte zum Beispiel Götterspeise machen, mit Pfirsichscheiben, die darin hingen, die dem Gesetz der Schwerkraft zum Trotz darin schwebten. Sie konnte Kuchen backen, der wie Banane schmeckte. Weinend, leidend raspelte sie ihren Meerrettich selbst, statt die pischachs zu kaufen, die im Delicatessen flaschenweise zu haben waren. Sie sah dem Metzger, wie sie es ausdrückte, »mit Adleraugen« auf die Finger, um sicherzugehen, dass er nicht vergaß, ihr Fleisch durch den koscheren Wolf zu drehen. Sie rief alle anderen Frauen im Gebäude an, die ihre Wäsche zum Trocknen hinterm Haus auf die Leine gehängt hatten – eines großmütigen Tages sogar die geschiedene Goje in der obersten Etage –, und sagte ihnen, schnell, holt die Sachen rein, ein Regentropfen ist auf unsere Fensterscheibe gefallen. Was für einen Radar diese Frau hatte! Und damals gab es noch keinen Radar! Was für eine Energie! Was für eine Gründlichkeit! Sie suchte meine Rechenaufgaben nach Fehlern ab; meine Socken nach Löchern; meine Fingernägel, meinen Hals nach Dreck, sämtliche Falten und Furchen meines Körpers. Sie reinigt die tiefsten Winkel meiner Ohren, indem sie mir kaltes Wasserstoffsuperoxid in den Schädel gießt. Das kitzelt und zischt wie Gingerale in den Gehörgängen und fördert in Krümeln und Bröckchen die verborgenen Ablagerungen von gelbem Schmalz zutage, die offenbar das Hörvermögen eines Menschen gefährden können. Ein solches medizinisches Verfahren ist (so hirnrissig es auch sein mag) natürlich zeitraubend; und anstrengend ohnehin – aber wenn es um Gesundheit und Reinlichkeit, Bazillen und Körperabsonderungen geht, schont sie weder sich noch andere. Sie zündet Kerzen für die Toten an – was andere jedes Mal vergessen, beachtet sie peinlich genau und ohne dass sie im Kalender nachsehen muss. Hingabe liegt ihr einfach im Blut. Sie scheint die Einzige zu sein, sagt sie, die beim Gang auf den Friedhof den »gesunden Menschenverstand« besitzt, das »ganz gewöhnliche Anstandsgefühl«, das Unkraut von den Gräbern unserer Verwandten zu entfernen. Der erste schöne Tag im Frühling, und sie hat alle Wollsachen im Haus eingemottet, die Läufer aufgerollt und zusammengebunden und in den Trophäenraum meines Vaters geschleppt. Sie braucht sich ihres Hauses nie zu schämen: Ein Fremder könnte hereinkommen und alle Schränke, alle Schubladen öffnen und nichts entdecken, dessen sie sich schämen müsste. Man könnte vom Fußboden ihres Badezimmers essen, falls das jemals nötig sein sollte. Wenn sie beim Mahjongg verliert, nimmt sie das sportlich, nicht-wie-die-anderen-deren-Namen-sie-nennen-könnte-es-aber-nicht-tut-nicht-mal-Tilly-Hochman-über-solche-Belanglosigkeiten-redet-man-nicht-vergessen-wir-einfach-dass-sie-überhaupt-davon-angefangen-hat. Sie näht, sie strickt, sie stopft – sie bügelt sogar besser als die schwarze, diese grinsende kindische schwarze alte Dame, zu der sie als Einzige von allen ihren Freundinnen, die ihr Fell untereinander aufgeteilt haben, freundlich ist. »Ich bin die Einzige, die gut zu ihr ist. Ich bin die Einzige, die ihr eine ganze Dose Thunfisch zum Mittagessen gibt, und ich rede hier nicht von dreck. Ich rede von Chicken of the Sea, Alex. Tut mir leid, ich kann nicht knausrig sein. Entschuldige, aber so kann ich nicht leben, auch wenn zwei neunundvierzig kosten. Esther Wasserberg legt fünfundzwanzig Cent in kleinen Münzen im Haus aus, wenn Dorothy zu ihr kommt, und zählt dann hinterher nach, ob noch alles da ist. Vielleicht bin ich zu gut«, flüstert sie mir zu, während sie kochend heißes Wasser über das Geschirr laufen lässt, von dem die Putzfrau gerade, allein wie eine Aussätzige, ihr Mittagessen gegessen hat, »aber das würde ich nicht fertig bringen.« Einmal kam Dorothy zufällig in die Küche zurück, als meine Mutter noch über dem Heißwasserhahn stand und reißende Ströme über das Besteck laufen ließ, das eben noch zwischen den dicken rosa Lippen der schwarzen gesteckt hatte. »Oh, Sie wissen ja, wie schwierig es heutzutage ist, Mayonnaise vom Besteck zu entfernen, Dorothy«, sagt meine flinkzüngige Mutter – womit es ihr, wie sie mir später erzählt, dank ihrer Geistesgegenwart gelungen ist, die Gefühle der Farbigen nicht zu verletzen.
Wenn ich schlecht bin, werde ich aus der Wohnung ausgeschlossen. Ich stehe vor der Tür und hämmere so lange darauf ein, bis ich schwöre, dass ich ein neues Leben beginnen werde. Aber was habe ich eigentlich getan? Ich putze jeden Abend meine Schuhe auf einem Bogen der Abendzeitung vom Vortag, den ich sorgfältig auf dem Linoleum ausgebreitet habe; hinterher versäume ich nie, den Deckel der Schuhcremedose fest zuzuschrauben und alle Gerätschaften wieder an ihren Platz zu räumen. Ich rolle die Zahnpastatube von unten auf, ich putze mir die Zähne mit kreisenden Bewegungen, niemals auf und ab, ich sage »Danke«, ich sage »Gern geschehen«, ich sage »Ich bitte um Verzeihung« und »Darf ich?«. Wenn Hannah krank oder vor dem Abendessen noch nicht mit ihrer blauen Sammelbüchse für den Jewish National Fond zurückgekommen ist, decke ich freiwillig und außer der Reihe den Tisch, denke dabei stets daran, Messer und Löffel rechts und die Gabel links und die Serviette zu einem Dreieck gefaltet links von der Gabel hinzulegen. Niemals würde ich Milchiges von Geschirr für Fleischiges essen, niemals, niemals, niemals. Dennoch gibt es in meinem Leben ein Jahr oder etwas mehr, wo nicht ein Monat vergeht, in dem ich nicht etwas so Unentschuldbares tue, dass man mir sagt, ich soll meine Sachen packen und verschwinden. Aber was mag das nur sein? Mutter, ich bin’s, der kleine Junge, der vor Beginn des Schuljahres ganze Abende lang aufbleibt und in altenglischer Schönschrift die Namen seiner Fächer in seinen bunten Stundenplan einträgt, der geduldig einen Halbjahresvorrat dreifach gelochter, sowohl liniierter als auch unliniierter Ringbucheinlagen mit Verstärkungsringen beklebt. Ich trage stets einen Kamm und ein sauberes Taschentuch bei mir; nie hängen mir die Kniestrümpfe über die Schuhe, darauf achte ich; meine Hausaufgaben sind Wochen vor dem Abgabetermin fertig – sehen wir den Tatsachen ins Auge, Ma, ich bin der klügste und ordentlichste kleine Junge in der Geschichte meiner Schule! Die Lehrerinnen (du weißt es, sie haben es dir gesagt) gehen, weil sie mich unterrichten durften, glücklich heim zu ihren Männern. Also, was habe ich getan? Wer die Antwort auf diese Frage hat, möge bitte aufstehen! Ich bin so schrecklich, dass sie mich nicht eine Minute länger im Haus haben will. Als ich meine Schwester einmal eine doofe Kacka genannt hatte, wurde mir unmittelbar darauf der Mund mit einem Stück brauner Kernseife ausgewaschen; das verstehe ich. Aber Verbannung? Was kann ich denn nur getan haben?
Weil sie gut ist, macht sie mir ein Pausenbrot für die Schule, dann aber ziehe ich los, in Mantel und Galoschen, und was jetzt geschieht, geht sie nichts an.
Okay, sage ich, wenn dir danach ist! (Denn auch ich ha--be den Sinn für Melodramatisches – ich bin nicht umsonst in dieser Familie.) Ich brauche kein Pausenbrot! Ich brauche gar nichts!
Einen kleinen Jungen, der sich benimmt wie du, den habe ich nicht mehr lieb. Ich werde hier allein mit Daddy und Hannah wohnen, sagt meine Mutter (wahrlich eine Meisterin darin, Dinge mit vernichtender Präzision zu formulieren). Hannah kann am Dienstagabend die Mahjongg-Steine für die Damen aufstellen. Wir brauchen dich nicht mehr.
Wennschon! Und ich schreite aus der Tür in den langen dunklen Korridor. Wennschon! Barfuß werde ich auf der Straße Zeitungen verkaufen. Mit Güterzügen hinfahren, wohin ich will, auf freiem Feld schlafen, denke ich – und dann brauche ich nur die leeren Milchflaschen neben unserer Fußmatte zu sehen, und schon bricht die Größe meines Verlusts mit voller Wucht über mich herein. »Ich hasse dich!«, schreie ich und trete mit einer Galosche an die Tür; »du widerst mich an!« Solchen Unflat, solch ketzerisches Gebrüll auf den Fluren des Wohnhauses, in dem sie mit zwanzig anderen jüdischen Frauen um den Titel der Schutzheiligen der Selbstaufopferung wetteifert, kann meine Mutter nur beantworten, indem sie von innen die Tür verriegelt. Und jetzt hämmere ich dagegen, um eingelassen zu werden. Ich sinke auf die Fußmatte, flehe um Vergebung für meine Sünde (die noch mal worin besteht?) und gelobe ihr nichts als Vollkommenheit für den Rest unseres Lebens, das, wie ich zu dieser Zeit noch glaube, niemals ein Ende haben wird.
Dann gibt es die Abende, an denen ich nicht essen will. Meine Schwester, die vier Jahre älter ist als ich, versichert mir, dass ich mich richtig erinnere: Ich weigerte mich zu essen, und meine Mutter sah sich nicht in der Lage, mir solchen Eigensinn – und solche Dummheit – durchgehen zu lassen. Zu meinem Besten nicht in der Lage. Sie bittet mich, etwas zu tun, das nur zu meinem Besten ist – und ich sage immer noch nein? Würde sie mir das Essen nicht aus ihrem eigenen Munde geben, ob ich das inzwischen nicht kapiert habe?
Aber ich will nicht das Essen aus ihrem Mund. Ich will nicht mal das Essen von meinem Teller – das ist es doch gerade.
Bitte! ein Kind mit meinem Potential! meinen Fähigkeiten! meiner Zukunft! – all den Gaben, mit denen Gott mich überhäuft hat, Schönheit, Verstand: da soll ich mir einbilden dürfen, ich könne mich einfach so, ohne jeden Grund zu Tode hungern?
Sollen die Leute mein Leben lang auf einen schmächtigen kleinen Jungen herabsehen, oder zu einem Mann aufblicken?
Will ich herumgestoßen und belächelt werden, nur Haut und Knochen sein, einer, den die Leute mit einem Niesen zu Boden schleudern können, oder will ich Respekt gebieten?
Was will ich sein, wenn ich erwachsen bin, schwach oder stark, Erfolg haben oder ein Versager sein, ein Mann oder eine Maus?
Ich will einfach nicht essen, antworte ich.
Also setzt meine Mutter sich mit einem langen Brotmesser in der Hand neben mich. Das Messer ist aus rostfreiem Stahl und hat kleine Sägezähne. Was will ich sein, schwach oder stark, ein Mann oder eine Maus?
Doktor, warum, ach, warum warum warum muss eine Mutter ihrem Sohn mit dem Messer drohen? Ich bin sechs, sieben Jahre alt, wie soll ich wissen, dass sie es nicht wirklich gebrauchen wird? Was soll ich tun, etwa versuchen, mich rauszureden, mit sieben? Ich besitze keinerlei strategisches Gespür, Herrgott – wahrscheinlich bringe ich noch nicht mal sechzig Pfund auf die Waage! Wenn jemand mit einem Messer in meine Richtung fuchtelt, nehme ich an, da steckt die Absicht dahinter, mein Blut zu vergießen! Aber warum nur? Was mag in ihrem Kopf vorgehen? Wie verrückt kann sie denn sein? Angenommen, sie lässt mich gewinnen – was wäre dann verloren? Warum ein Messer, warum die Drohung mit Mord, warum braucht sie einen so vollständigen und vernichtenden Sieg – wo sie erst am Tag zuvor ihr Bügeleisen auf dem Bügelbrett abgestellt und mir Beifall geklatscht hatte, als ich, in der Küche umherstürmend, meine Rolle als Christoph Kolumbus in der Drittklässler-Aufführung von Land Ho probte! Ich bin der Schauspielstar meiner Klasse, ohne mich können sie kein einziges Stück aufführen. Oh, einmal haben sie es versucht, als ich meine Bronchitis hatte, doch später hat die Lehrerin meiner Mutter anvertraut, die Aufführung sei ausgesprochen zweitklassig gewesen. Ach, wie, wie kann sie nur solche herrlichen Nachmittage in der Küche verbringen, Silberzeug polieren, Leber hacken, ein neues Gummiband in den Bund meiner kleinen Unterhosen ziehen – und mir dabei die ganze Zeit meine Stichworte aus dem vervielfältigten Manuskript angeben, die Worte der Königin Isabella an meinen Kolumbus, der Betsy Ross an meinen Washington, der Mrs. Pasteur an meinen Louis – wie kann sie sich in diesen schönen Dämmerstunden nach der Schule zusammen mit mir auf die Höhe meines Genies erheben und dann am Abend, weil ich mich weigere, ein paar grüne Bohnen und eine Ofenkartoffel zu essen, mit einem Messer auf mein Herz zielen?
Und warum hält mein Vater sie nicht auf?
Wichsen
Dann kam die Pubertät – die Hälfte meiner wachen Stunden hinter der verschlossenen Badezimmertür damit zugebracht, mein Sperma in die Kloschüssel oder in die schmutzigen Sachen im Wäschekorb zu schleudern oder platsch an den Medizinschrankspiegel, vor dem ich mit hinabgelassener Unterhose stand, um zu sehen, wie es aussah, wenn es herauskam. Oder ich stand über meine fliegende Faust gebeugt, die Augen zugepresst, den Mund aber weit offen, um die klebrige Sauce aus Buttermilch und Clorox auf Zunge und Zähnen zu spüren – auch wenn das Zeug in meiner Blindheit und Ekstase nicht selten wie ein Spritzer Wildroot Cream Oil in meiner Schmalzlocke landete. Ich bewegte meinen wunden und geschwollenen Penis durch eine Welt aus verfilzten Taschentüchern und zerknüllten Kleenex und fleckigen Pyjamas, ständig in Angst, dass jemand sich anschleichen und mein abscheuliches Treiben beobachten könnte, während ich gerade in der Raserei der Entladung war. Trotzdem war ich absolut unfähig, meine Pfoten von meinem Ding zu lassen, sobald es an meinem Bauch emporzuklettern begann. Mitten im Unterricht hob ich die Hand, um austreten zu dürfen, rannte durch den Flur zu den Waschräumen und holte mir über dem Pissoir mit zehn oder fünfzehn heftigen Streichen einen runter. Beim Samstagnachmittagsfilm ließ ich meine Freunde sitzen, um zum Süßigkeitenautomaten zu gehen – und schon war ich oben in einer abgelegenen Sitzreihe und spritzte meinen Samen in das leere Einwickelpapier eines Mounds-Riegels. Bei einem Familienausflug entkernte ich einmal einen Apfel, bemerkte zu meiner Verblüffung (und mit Nachhilfe meiner Manie), wie das aussah, und stürmte in den Wald, um mich der Öffnung dieser Frucht zu bemächtigen, wobei ich mir vorstellte, das kühle mehlige Loch befinde sich tatsächlich zwischen den Beinen jenes myth-ischen Wesens, das mich immer Großer nannte, wenn es etwas erflehte, das noch kein Mädchen in der Geschichte der Menschheit jemals erfleht hatte. »Ah, schieb ihn mir rein, Großer«, schrie der entkernte Apfel, den ich bei diesem Picknick in den siebten Himmel vögelte. »Großer, Großer, gib mir alles, was du hast«, bettelte die leere Milchflasche, die ich in unserem Vorratsregal im Keller versteckt hatte, um sie nach der Schule mit meinem in Vaseline getauchten Ständer zu beglücken. »Komm, Großer, komm«, kreischte das verzückte Stück Leber, dass ich in meinem Wahnsinn eines Nachmittags beim Metzger erstanden hatte und, glauben Sie’s oder nicht, auf dem Weg zum Bar-Mizwe-Unterricht hinter einer Reklametafel vergewaltigte.
Gegen Ende meines ersten Jahrs an der Highschool – und meines ersten Jahrs als Masturbator – entdeckte ich an der Unterseite meines Penis, genau am Treffpunkt von Schaft und Eichel, ein kleines verfärbtes Fleckchen, das später als Sommersprosse diagnostiziert wurde. Krebs. Ich hatte mir Krebs zugezogen. Das ewige Zupfen und Zerren an meinem Fleisch, die ständige Reibung hatte mir eine unheilbare Krankheit eingebracht. Und ich war nicht mal vierzehn! Nachts im Bett strömten mir die Tränen aus den Augen. »Nein!«, schluchzte ich. »Ich will nicht sterben! Bitte – nein!« Dann aber, da ich ja sowieso bald eine Leiche wäre, ging ich zur Tagesordnung über und wichste in eine Socke. Ich hatte mir angewöhnt, abends schmutzige Socken mit ins Bett zu nehmen, eine als Auffangbehältnis vor dem Einschlafen, die andere nach dem Aufwachen.
Könnte ich mich doch auf einmal am Tag beschränken, oder wenigstens nach dem zweiten oder dritten Mal aufhören! Aber mit der Aussicht auf mein baldiges Ableben stellte ich nur immer neue Rekorde auf. Vor den Mahlzeiten. Nach den Mahlzeiten. Während der Mahlzeiten. Ich springe vom Esstisch auf, halte mir dramatisch den Bauch – Durchfall!, rufe ich, ich habe Durchfall –, und kaum habe ich die Badezimmertür hinter mir abgeschlossen, ziehe ich mir eine Unterhose, die ich aus dem Schrank meiner Schwester entwendet habe und in ein Taschentuch gewickelt in der Hosentasche trage, über den Kopf. So elektrisierend ist die Wirkung von Baumwollhöschen an meinem Mund – so elektrisierend ist schon das Wort Höschen –, dass die Flugbahn meines Ejakulats erstaunliche, nie zuvor erzielte Höhen erreicht: Einer Rakete gleich schießt es in Richtung der Glühbirne über mir, trifft sie und bleibt, o Schreck und Wunder, daran hängen. In Panik reiße ich die Hände über den Kopf, erwarte die Explosion, Glassplitter, die Stichflamme – ich rechne, sehen Sie, unentwegt mit Unheil. Dann klettere ich so leise ich kann auf die Heizung und entferne den zischenden Schleim mit einem Knäuel Klopapier. Anschließend suche ich gewissenhaft den Duschvorhang, die Wanne, den Kachelboden, die vier Zahnbürsten – Gott behüte! – nach Spuren ab, und gerade als ich denke, ich habe nichts zurückgelassen, und die Tür aufschließen will, macht mein Herz einen Satz beim Anblick dessen, was wie ein Rotzklumpen an meiner Schuhspitze hängt. Ich bin der Raskolnikow des Wichsens – die klebrigen Beweise sind überall! Auch an den Hosenaufschlägen? in meinen Haaren? an meinem Ohr? Das alles frage ich mich, während ich finster und verdrossen an den Küchentisch zurückkomme, um selbstgerecht meinen Vater anzuraunzen, als er, den Mund voll mit roter Götterspeise, die Bemerkung macht: »Ich begreife nicht, warum du die Tür abschließen musst. Das geht über meinen Verstand. Wo sind wir denn hier? Zu Hause oder im Hauptbahnhof?« »… Privatsphäre … auch nur ein Mensch … aber hier niemals«, antworte ich, schiebe meinen Nachtisch beiseite und schreie: »Mir geht es nicht gut – könnt ihr mich nicht alle mal in Ruhe lassen?«
Nach dem Nachtisch – den ich aufesse, weil ich Götterspeise mag, auch wenn ich sie hasse –, nach dem Nachtisch verschwinde ich gleich wieder im Bad. Ich wühle in der Schmutzwäsche, bis ich einen Büstenhalter meiner Schwester finde. Ich hänge einen Träger um den Griff der Badezimmertür, den anderen um den Griff des Wäscheschranks: eine Vogelscheuche, die noch mehr Träume bringen soll. »Ja, mach’s mir, Großer, mach’s mir, bis ich platze –«, so bedrängen mich die kleinen Körbchen von Hannahs Büstenhalter, als eine zusammengerollte Zeitung an die Tür geschlagen wird. Und mich und meine Handvoll ein wenig von der Kloschüssel zurückzucken lässt. »– Mach schon, andere müssen auch mal da rein!«, sagt mein Vater. »Ich habe seit einer Woche keinen Stuhlgang.«
Mit einem Ausbruch verletzter Gefühle finde ich, darin bin hoch begabt, mein Gleichgewicht wieder. »Ich habe ganz schrecklichen Durchfall! Kann denn keiner in diesem Haus darauf Rücksicht nehmen?« – und setze die unterbrochene Tätigkeit fort, jetzt sogar mit beschleunigtem Tempo, da mein krebsbefallenes Organ auf wundersame Weise abermals von innen nach außen zu beben beginnt.
Plötzlich bewegt sich Hannahs Büstenhalter. Schwingt hin und her! Ich verhülle meine Augen, und wen erblicke ich? – Lenore Lapidus! Sie hat die größten in meiner Klasse, und jetzt sehe ich sie nach der Schule zum Bus rennen, ihre schweren, unberührbaren Dinger schwingen mächtig in ihrer Bluse, oh, ich zwänge sie aus ihren Körbchen, dass sie herausfallen, LENORE LAPIDUS’ ECHTE TITTEN, und erkenne im selben Bruchteil dieser Sekunde, dass meine Mutter heftig an der Klinke rüttelt. An der Klinke der Tür, die ich nun doch einmal abzuschließen vergessen habe! Ich wusste, eines Tages würde es passieren! Erwischt! So gut wie tot!
»Mach auf, Alex. Ich möchte, dass du auf der Stelle aufmachst.«
Doch abgeschlossen, ich werde nicht erwischt! Und sehe an dem Lebendigen in meiner Hand, dass ich auch noch nicht ganz tot bin. Also weiter! weiter! »Lutsch mich, Großer, lutsch mich aus! Ich bin Lenore Lapidus’ dicker großer scharfer Büstenhalter!«
»Alex, ich will eine Antwort von dir. Hast du nach der Schule Pommes frites gegessen? Ist dir deswegen so schlecht?«
»Naaah-nein.«
»Alex, hast du Schmerzen? Soll ich den Arzt holen? Hast du Schmerzen oder nicht? Ich will genau wissen, wo es weh tut. Antworte mir.«
»Uuhh, oohhh –«
»Alex, du darfst auf keinen Fall die Toilette spülen«, sagt meine Mutter streng. »Ich will sehen, was du dadrin gemacht hast. Was ich da höre, gefällt mir ganz und gar nicht.«
»Und ich«, sagt mein Vater, wie immer beeindruckt von meinen Leistungen – wobei sich Neid und Respekt die Waage hielten –, »ich habe seit einer Woche keinen Stuhlgang«, während ich gerade von der Kloschüssel aufspringe und mit dem Winseln eines gepeitschten Tiers drei kaum noch als zähflüssig zu bezeichnende Tropfen in das winzige Stück Stoff ergieße, an dem die Brustwarzen meiner flachbrüstigen achtzehnjährigen Schwester gelegen haben. Mein vierter Orgasmus an diesem Tag. Wann werde ich anfangen, Blut abzusondern?
»Du, komm mal her, bitte«, sagt meine Mutter. »Warum hast du die Toilette gespült, obwohl ich dir gesagt habe, du sollst es nicht tun?«
»Hab ich vergessen.«
»Was war dadrin, dass du es so schnell wegspülen musstest?«
»Durchfall.«
»Mehr flüssig oder mehr wie Aa?«
»Ich seh da nicht hin! Ich hab nicht hingesehen! Und sag nicht Aa zu mir – ich gehe auf die Highschool!«
»Oh, schrei mich nicht an, Alex. Von mir hast du den Durchfall nicht, das kann ich dir versichern. Wenn du nur essen würdest, was es bei uns zu Hause gibt, müsstest du nicht fünfmal am Tag aufs Klo rennen. Hannah sagt mir, was du machst, also bilde dir nicht ein, ich wüsste nicht Bescheid.«
Sie hat die Unterhosen vermisst! Man hat mich erwischt! Oh, lass mich sterben! Bitte, bitte!
»Ja, was mache ich denn …?«
»Du gehst nach der Schule zu Harold’s Hot Dog & Chazerai Palace und isst Pommes frites mit Melvin Weiner. Hab ich recht? Lüg mich nicht an. Gehst du nach der Schule in die Hawthorne Avenue und stopfst dich mit Pommes frites und Ketchup voll? Ja oder nein! Jack, komm mal her, ich möchte, dass du das hörst«, ruft sie meinen Vater, der jetzt das Bad besetzt.
»Hör mal, ich versuche, meinen Darm zu entleeren«, antwortet er. »Habe ich nicht auch so schon genug Schwierigkeiten, ohne dass Leute mich anschreien müssen, wenn ich versuche, meinen Darm zu entleeren?«
»Weißt du, was dein Sohn nach der Schule macht, der große Meisterschüler, zu dem seine Mutter nicht mehr Aa sagen darf, weil er so erwachsen ist? Was glaubst du, was dein erwachsener Sohn macht, wenn niemand ihn sieht?«
»Kann ich bitte in Ruhe gelassen werden?«, ruft mein Vater. »Kann ich bitte ein wenig Frieden haben, damit ich hier drin endlich mal zu Potte komme?«
»Warte nur, bis dein Vater erfährt, was du jeder gesunden Lebensweise zum Hohn im Schilde führst. Alex, beantworte mir eine Frage. Du bist ja so klug, du weißt auf alles eine Antwort, also antworte: Was meinst du, woher Melvin Weiner seinen Dickdarmkatarrh hat? Warum hat dieses Kind die Hälfte seines Lebens in Krankenhäusern verbracht?«
»Weil er chazerai isst.«
»Wag es nicht, dich über mich lustig zu machen!«
»Na schön«, schreie ich, »woher hat er seinen Dickdarmkatarrh?«
»Weil er chazerai isst! Aber das ist nicht witzig! Eine Mahlzeit – das ist für ihn ein O-Henry-Riegel und eine Flasche Pepsi. Und sein Frühstück – weißt du, was er zum Frühstück isst? Die wichtigste Mahlzeit des Tages – und das sagt nicht deine Mutter, Alex, das sagen die bedeutendsten Ernährungswissenschaftler –, und weißt du, was dieses Kind zum Frühstück isst?«
»Einen Doughnut.«
»Richtig, einen Doughnut, Herr Naseweis, Herr Schlauber-ger. Und Kaffee. Kaffee und einen Doughnut, und damit soll ein dreizehnjähriger pischer, dessen Magen noch gar nicht voll entwickelt ist, den Tag anfangen. Aber du bist Gott sei Dank anders aufgewachsen. Du hast keine Mutter, die sich in der ganzen Stadt herumtreibt wie so manche, deren Namen ich nennen könnte, die sich den ganzen Tag bei Bam’s und Hahne’s und Kresge’s amüsiert. Alex, erklär es mir, damit es mir kein Rätsel bleibt, oder vielleicht bin ich ja auch zu dumm – erklär mir einfach, was du damit erreichen willst, was du damit beweisen willst, dass du solchen Plunder in dich reinstopfst, wenn du zu Hause ein Stück Mohnkuchen und ein schönes Glas Milch haben könntest? Ich will die Wahrheit von dir hören. Ich er-zähl’s auch nicht deinem Vater weiter«, sagt sie und senkt bedeutsam die Stimme, »aber ich muss die Wahrheit von dir hören.« Pause. Ebenfalls bedeutsam. »Sind es nur Pommes frites, Junge, oder ist es noch mehr? … Sag es mir, bitte, was nimmst du sonst noch für Müll in den Mund, damit wir endlich diesem Durchfall auf den Grund kommen! Ich möchte eine ehrliche Antwort von dir, Alex. Isst du Hamburger? Antworte mir, bitte, hast du des-wegen die Toilette gespült – weil da Hamburger drin waren?«
»Ich sage doch – ich sehe nicht in die Schüssel, wenn ich abspüle! Ich interessiere mich nicht wie du für das Aa anderer Leute!«
»Oh, oh, oh – dreizehn Jahre alt, und so ein loses Mundwerk! Und das nur, weil jemand sich nach seiner Gesundheit erkundigt, nach seinem Wohlergehen!« Die völlige Unbegreiflichkeit der Situation treibt ihr dicke Tränen in die Augen. »Alex, warum wirst du so, erklär es mir doch! Sag mir bitte, was haben wir dir unser Leben lang so Schreckliches angetan, dass das jetzt unser Lohn sein soll?« Ich nehme an, sie hält das für eine originelle Frage. Ich nehme an, sie hält das für eine Frage, die man nicht beantworten kann. Und das Schlimmste dabei ist, mir geht es genauso. Was haben sie ihr Leben lang für mich anderes getan, als sich aufzuopfern? Aber das gerade dies das Schreckliche ist, geht über meinen Verstand – bis heute, Doktor! Bis heute!
Jetzt mache ich mich auf das Flüstern gefasst. Ich spüre das Flüstern kommen, auch wenn es noch meilenweit entfernt ist. Jetzt geht es um die Kopfschmerzen meines Vaters.
»Alex, hatte er denn heute keine solchen Kopfschmerzen, dass er kaum geradeaus sehen konnte?« Sie sieht nach, ob er außer Hörweite ist. Gott behüte, dass er mitbekommt, wie kritisch sein Zustand ist – dann behauptet er, das sei alles übertrieben. »Er muss nächste Woche nicht zur Untersuchung, ob er einen Tumor hat?«
»Muss er das?«
»›Bringen Sie ihn vorbei‹, hat der Arzt gesagt, ›ich will feststellen, ob er einen Tumor hat.‹«
Sie hat es geschafft. Ich weine. Ich habe keinen Grund zu weinen, aber in diesem Haushalt versucht jeder mindestens einmal am Tag ordentlich Tränen zu vergießen. Mein Vater, müssen Sie wissen – und natürlich wissen Sie das: Erpresser sind ein wesentlicher Teil der menschlichen Gemeinschaft und, nehme ich an, auch Ihrer Klientel –, mein Vater »geht« zu dieser Tumoruntersuchung fast so lange, wie ich mich erinnern kann. Dass er ewig Kopfschmerzen hat, kommt natürlich von seiner ewigen Verstopfung – und seine Verstopfung kommt daher, dass sein Verdauungsapparat sich in den Händen der Firma Unruhe, Furcht & Enttäuschung befindet. Es stimmt, einmal hat ein Arzt meiner Mutter gesagt, er wolle ihren Mann einer Tumoruntersuchung unterziehen – wenn sie das glücklich macht, wird er sich wohl dabei gedacht haben; er hat jedoch angedeutet, billiger und wahrscheinlich effektiver dürfte es sein, wenn der Mann in ein Klistier investieren würde. Aber dass mir das alles bewusst ist, macht es kein bisschen weniger herzzerreißend für mich, wenn ich mir vorstelle, wie ein bösartiger Tumor den Schädel meines Vaters platzen lässt.
Ja, sie hat mich da, wo sie mich haben will, und sie weiß es. Sogleich ist mein eigener Krebs vergessen, denn Trauer überkommt mich – überkommt mich noch heute wie damals – bei dem Gedanken, wie viel vom Leben (wie er selbst es sehr zutreffend formuliert) über seinen Verstand geht. Und sein Verständnis. Kein Geld, keine Schulausbildung, keine Sprache, kein Wissen, Neugier ohne Kultur, Elan ohne Gelegenheit, Erfahrung ohne Weisheit … Wie leicht seine Unzulänglichkeiten mich zum Weinen bringen können. So leicht, wie sie mich in Wut bringen!
Ein Mensch, den mein Vater mir oft als jemanden hinstellte, dem man im Leben nacheifern sollte, war der Theaterregisseur Billy Rose. Walter Winchell hat einmal gesagt, Billy Rose habe es seinen stenographischen Kenntnissen zu verdanken, dass Bernard Baruch ihn als Sekretär verpflichtet habe – folglich setzte mein Vater mir während der ganzen Highschoolzeit zu, ich solle einen Stenographiekurs belegen. »Alex, wo wäre Billy Rose heute ohne seine Kurzschrift? Nirgendwo! Warum also widersetzt du dich mir?« Früher war das Klavier unser Streitthema. Für einen Mann, in dessen Haus es weder ein Grammophon noch eine Schallplatte gab, entwickelte er, wenn es um das Erlernen eines Musikinstruments ging, eine be-achtliche Leidenschaft. »Ich verstehe nicht, warum du kein Instrument spielen lernen willst, das geht über meinen Verstand. Deine kleine Cousine Toby kann sich ans Klavier setzen und jedes Lied spielen, das du ihr nennst. Die braucht nur am Klavier zu sitzen und ›Tea for Two‹ zu spielen, und alle im Zimmer sind ihre Freunde. Ihr wird es niemals an Gesellschaft fehlen, Alex, ihr wird es niemals an Beliebtheit fehlen. Du brauchst mir nur zu sagen, dass du Klavier spielen lernen willst, und bis morgen früh habe ich dir eins besorgt. Alex, hörst du mir zu? Ich mache dir ein Angebot, das dein ganzes Leben verändern könnte!«
Aber was er mir anzubieten hatte, wollte ich nicht – und was ich wollte, hatte er mir nicht anzubieten. Aber ist das denn so ungewöhnlich? Warum muss mir das immer noch solchen Schmerz bereiten? In meinem Alter! Doktor, wovon soll ich mich befreien, sagen Sie es mir: von meinem Hass … oder von meiner Liebe? Denn noch habe ich ja nichts von all dem erzählt, woran ich mich mit Vergnügen erinnere – soll heißen, mit einem unbändigen, nagenden Verlustgefühl! All diese Erinnerungen, die irgendwie mit dem Wetter und der Tageszeit zusammenzuhängen scheinen und die mit so schmerzlicher Deutlichkeit aufblitzen, dass ich, wenn sie kommen, nicht mehr in der Subway, im Büro oder beim Essen mit einem hübschen Mädchen bin, sondern zurück in meiner Kindheit, bei ihnen. Erinnerungen an schiere Nichtigkeiten – und doch kommen sie mir wie historische Augenblicke vor, die für mein Dasein nicht weniger Bedeutung haben als der Augenblick meiner Empfängnis; ich könnte mich daran erinnern, wie sein Spermium sich in ihr Ovum geschlängelt hat, so durchdringend ist meine Dankbarkeit – ja, meine Dankbarkeit! –, so umfassend und bedingungslos ist meine Liebe. Ja, ich, umfassend und bedingungslos in meiner Liebe! Ich stehe in der Küche (stehe vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben), meine Mutter zeigt, »Schau mal nach draußen, Kleiner«, und ich schaue; sie sagt: »Siehst du? Wie dunkelblau? Ein richtiger Herbsthimmel.« Die erste Gedichtzeile, die ich in meinem Leben höre! Und ich erinnere mich daran! Ein richtiger Herbsthimmel … Es ist ein grimmig kalter Tag im Januar, Abenddämmerung – oh, die Erinnerungen an diese Abende werden mich noch einmal umbringen, Erinnerungen an Hühnerfett auf Roggenbrot, um mir über die Zeit bis zum Abendessen hinwegzuhelfen, an den Mond, der schon durchs Küchenfenster zu sehen ist – ich bin gerade mit glühend heißen Wangen und einem Dollar, den ich mit Schneeschaufeln verdient habe, von draußen hereingekommen: »Weißt du, was es zum Abendessen gibt«, gurrt meine Mutter so voller Liebe, »weil du so ein fleißiger Junge bist? Dein Lieblingswinteressen. Eintopf mit Lamm.« Es ist Abend: Nach einem Sonntag in New York, in Radio City und Chinatown, fahren wir über die George Washington Bridge nach Hause – der Holland Tunnel ist die direkte Verbindung zwischen Pell Street und Jersey City, aber ich bettele um die Brücke, und da meine Mutter sagt, das sei »pädagogisch wertvoll«, fährt mein Vater einen Umweg von zehn Meilen zu uns nach Hause. Meine Schwester vorne zählt laut die Stützträger, auf denen die fabelhaften, pädagogisch wertvollen Trossen ruhen, während ich hinten mein Gesicht in den schwarzen Seehundmantel meiner Mutter wühle und einschlafe. In Lakewood, wohin wir über ein Winterwochenende mit dem Sonntagabend-Rommé-Club meiner Eltern fahren, schlafe ich in einem der zwei Betten bei meinem Vater, während meine Mutter und Hannah sich in dem anderen zusammenrollen. Mein Vater weckt mich im Morgengrauen, und wie zwei Sträflinge auf der Flucht ziehen wir uns geräuschlos an und schleichen aus dem Zimmer. »Komm«, flüstert er und bedeutet mir, Ohrenschützer und Mantel anzuziehen, »ich möchte dir etwas zeigen. Hast du gewusst, dass ich, als ich sechzehn war, in Lakewood als Kellner gearbeitet habe?« Vor dem Hotel zeigt er über die schönen stillen Wälder hin. »Wie findest du das?«, sagt er. Wir gehen – »in flottem Tempo« – um einen silbern schimmernden See herum. »Atme tief durch. Nimm die Kiefernluft tief in dich auf. Das ist die beste Luft der Welt, gute Winterkiefernluft.« Gute Winterkiefernluft – auch mein Vater ein Dichter! Ich könnte nicht begeisterter sein, wäre ich Wordsworths Sohn! … Im Sommer bleibt er in der Stadt, während wir drei für einen Monat ein möbliertes Zimmer an der Küste beziehen. Die letzten zwei Wochen wird er mit uns verbringen, dann hat er Urlaub … Es gibt jedoch Zeiten, da ist die Luft in Jersey City so mit Feuchtigkeit gesättigt, da wimmelt es dermaßen von Moskitos, die wie Bombengeschwader im Sturzflug aus den Sümpfen kommen, dass er nach vollbrachtem Tagewerk die fünfundsechzig Meilen den alten Cheesequake Highway hinunterfährt – der Cheesequake! Mein Gott! was Sie hier zutage fördern! –, fünfundsechzig Meilen weit fährt, um die Nacht bei uns in unserem luftigen Zimmer in Bradley Beach zu verbringen.