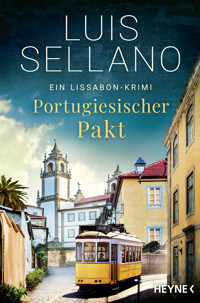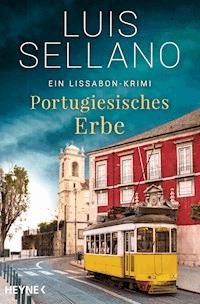
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lissabon-Krimis
- Sprache: Deutsch
Sonne, Mord und Portugal
Henrik Falkner weiß kaum, wie ihm geschieht, als er die malerischen Altstadtgassen von Lissabon betritt. Der ehemalige Polizist soll ein geheimnisvolles Erbe antreten: Sein Onkel hat ihm ein Haus samt Antiquitätengeschäft vermacht. Während Henrik mehr und mehr in den Bann der pulsierenden Stadt am Tejo gerät, entdeckt er, dass sein Onkel offenbar über Jahre hinweg Gegenstände gesammelt hat, die mit ungelösten Verbrechen in Verbindung stehen. Und kaum hat Henrik seine ersten Pastéis de Nata genossen, versucht man, ihn umzubringen. Henrik stürzt sich in einen Fall, der sein Leben verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Henrik Falkner weiß kaum, wie ihm geschieht, als er die malerischen Altstadtgassen von Lissabon betritt. Der ehemalige Polizist soll ein geheimnisvolles Erbe antreten: Sein Onkel hat ihm ein Haus samt Antiquitätengeschäft vermacht. Während Henrik mehr und mehr in den Bann der pulsierenden Stadt am Tejo gerät, entdeckt er, dass sein Onkel offenbar über Jahre hinweg Gegenstände gesammelt hat, die mit ungelösten Verbrechen in Verbindung stehen. Und kaum hat Henrik seine ersten Pastéis de Nata genossen, versucht man, ihn umzubringen. Henrik stürzt sich in einen Fall, der sein Leben verändern wird.
Der Autor
Luis Sellano ist das Pseudonym eines deutschen Autors. Auch wenn Stockfisch bislang nicht als seine Leibspeise gilt, liebt Luis Sellano Pastéis de Nata und den Vinho Verde umso mehr. Schon sein erster Besuch in Lissabon entfachte seine große Liebe für die Stadt am Tejo. Luis Sellano lebt mit seiner Familie in Süddeutschland. Regelmäßig zieht es ihn auf die geliebte Iberische Halbinsel, um Land und Leute zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.
LUIS SELLANO
Portugiesisches
Erbe
EIN LISSABON KRIMI
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Chris
1
Wenn der erste Eindruck einer Stadt ein Geruch ist, sollte es nicht unbedingt der von Stockfisch sein.
Henrik fühlte sich für eine Sekunde geneigt, die Tür des Taxis wieder zu schließen. Allerdings war die aufdringliche Schweißfahne des Taxifahrers keine echte Alternative zu dem luftgetrockneten Bacalhau, der hier zu Dutzenden von der Decke des Fischgeschäfts hing.
Mit angehaltenem Atem stieg Henrik aus dem Taxi, schulterte seine kompakte Reisetasche und schlug die Tür hinter sich zu. Die Gasse verlief parallel zum Fluss und war damit vollkommen windgeschützt. Keine Chance auf die Brise, die vom Atlantik her durch die Häuserzeilen wehte und die Temperatur angenehmer, die Luft erträglicher machte. Es war heiß. Zu heiß für jemanden, der dieses Klima nicht gewohnt war. Etwas anderes hatte er im August allerdings auch nicht erwartet. Die Sonne stand hoch und warf keine Schatten. Er hätte eine Sonnenbrille einstecken sollen, doch als er heute früh aus dem Haus gegangen war, war es noch dunkel gewesen.
Was hatte er sonst alles vergessen?
Kopfschüttelnd prüfte er die Adresse. Er war schon richtig. Jedenfalls geografisch betrachtet.
Der Taxifahrer gab Gas, lenkte sein Gefährt haarscharf an den parkenden Autos vorbei und entschwand um die nächste Ecke. Zu spät, um einfach wieder einzusteigen und sich zurück zum Flughafen fahren zu lassen. Henrik blickte die Straße hoch, in die sich außer ihm niemand verirrt hatte. Die Fassaden der Häuser hatten nichts Einladendes. Der fortschreitende Verfall hatte nicht einmal mehr altes Flair übrig gelassen. Soweit er sich an den Stadtplan entsinnen konnte, den er gestern Abend noch auf dem Rechner studiert hatte, waren es nur ein paar Schritte zum berühmten Baixa-Viertel, in dem die Touristen auf den breiten Einkaufsstraßen flanierten und die unzähligen Straßencafés und Restaurants bevölkerten. Die Rua Nova do Carvalho bekam nichts von diesem Rummel ab, da sie nicht den geringsten Anreiz für Urlauber bot. Lediglich zwei Häuser weiter entdeckte er ein winziges Café; es bestand aus einem Tresen mit einer Durchreiche zur Straße, auf der zwei billige Plastiktische standen, die gerade so auf das schmale Trottoir passten. Daneben wies eine grüne, schon arg mitgenommene Markise über einem Schaufenster auf einen Obst- und Gemüseladen hin.
Das Büro befand sich oberhalb des Fischgeschäfts, hatte aber irritierenderweise keinen separaten Eingang. Ein einfaches, an den Türrahmen geschraubtes, handtellergroßes Blechschild, von dem der einst weiße Lack abblätterte, bestätigte dies. Notariado Artur Pinho war darauf zu lesen.
Artur Pinho hatte ihn vor drei Tagen angerufen. Zeitgleich war ein Brief eingetroffen. Per Einschreiben, um die Seriosität zu unterstreichen.
Drei Tage!
Ein Anruf, der ihn letztlich in die unansehnliche Rua Nova do Carvalho geführt hatte, in der sich die Sommerhitze staute. Skeptisch betrachtete er die schäbige Fassade, die bis hoch zum ersten Stock mit blau-weiß gemusterten Kacheln gefliest war. Ein Drittel davon war bereits der Schwerkraft zum Opfer gefallen oder mutwillig abgeschlagen worden. Ein Anblick, der seine geringe Erwartung noch weiter schrumpfen ließ. Vielleicht auch, weil diese Hauswand den Zustand seines Lebens widerspiegelte; eine Fassade mit vielen Löchern. Er schloss die Augen und rezitierte in Gedanken den ersten Vers von Max’ und Moritz’ fünftem Streich.
Wer in Dorfe oder Stadt / einen Onkel wohnen hat …
Hätte das Wissen darüber, dass Artur Pinho mit seinem Notariat in einem abgewirtschafteten Gebäude residierte, etwas an seinem Entschluss geändert? Wäre er dann nicht hergekommen? Mit dieser unbeantworteten Frage im Kopf betrat er den Laden. Weit und breit war niemand zu sehen, auch nicht hinter der Verkaufstheke. Von dort zweigte rechts eine Tür ab, die in ein Treppenhaus führte. Henriks Ausbildung gebot es eigentlich, dass er sich zu erkennen gab. Dass es falsch war, einfach mir nichts, dir nichts durch dieses Geschäft zu spazieren, ohne seine Anwesenheit kundzutun. Doch er schwieg, bog einfach ab und betrat das Treppenhaus. Ein schmales Fenster warf ein grelles Rechteck auf die stumpfen Steinplatten. Millionen Staubteilchen tanzten im Sonnenlicht. Die Treppe am Ende des Flurs war mit einem Teppich überzogen, der einmal rot gewesen war. Trotz oder gerade wegen des an manchen Stellen kurz vor der Auflösung stehenden Bezugs knarrte jede Stufe unter seinem Gewicht. Seit er den Dienst quittiert hatte und nicht mehr regelmäßig trainierte, hatte er zugenommen. Womit er aktuell geschätzt bei rund neunzig Kilo lag. Was sich bei seiner Größe von eins fünfundachtzig durchaus noch kaschieren ließ. Doch er machte sich nichts vor. Er fühlte sich außer Form, und das lag nicht allein an den vorherrschenden fünfunddreißig Grad. Oder der Tatsache, dass er vor der Abreise schlecht geschlafen hatte. Sehr schlecht sogar.
Im ersten Stock erwarteten ihn zwei Türen, von der die erste das gleiche Schild wie unten aufwies. Er rückte den Riemen seiner Reisetasche zurecht, klopfte und fragte sich gleichzeitig, wie man auf Portugiesisch zum Eintreten aufforderte. Er kam zu dem Schluss, dass er in vielerlei Hinsicht unvorbereitet war.
Eine ältere Dame öffnete ihm die Tür und zerstreute damit seine Bedenken. Auf ihre Nasenflügel drückte eine Lesebrille. Ihr Haar war tiefschwarz, mit einem Stich Aubergine. Zu künstlich, als dass die Farbe, gemessen am Alter der Frau, hätte echt sein können. Auf ihren Lippen glänzte ein hellroter Lippenstift in demselben Ton, den sie auch auf die Wangen aufgetragen hatte.
»Senhor Falkner?«, fragte sie.
Er setzte ein Lächeln auf und nickte.
Ohne dass dies ihre neutrale Miene veränderte und ohne sich ihrerseits vorzustellen, machte sie Platz und bat ihn mit einer Geste einzutreten. Der Raum war abgedunkelt und kühl. Über dem Fenster gab eine antiquierte Klimaanlage ein bedenklich metallisches Scharren von sich.
»Just a second!«, verlangte die Frau, die ihm lediglich bis zur Brust reichte und ihre vollschlanke Figur in ein dunkelblaues Kostüm gezwängt hatte. Der Blazer, der von zwei goldfarbenen Knöpfen zusammengehalten wurde, spannte besorgniserregend über ihren Brüsten.
Mit eleganter Geste schlug sie ihren Fingerknöchel zweimal gegen eine Verbindungstür, die linker Hand aus dem Vorzimmer führte. Die Reaktion auf ihr Klopfen war eine unverständliche Erwiderung, die kaum vernehmlich durch das verblichene Holz drang. Sie nickte Henrik auffordernd zu, und er schlüpfte an ihr vorbei in das Büro von Artur Pinho, das nur unwesentlich mehr Platz bot als das der Vorzimmerdame. Es musste an den Dimensionen des massiven schwarzen Ledersessels liegen, dass ihm Pinho wie ein Zwerg vorkam. Ein grauhaariger Zwerg in einem braunen Cordanzug, mit einem dichten Schnauzer unter seiner knubbeligen Nase, auf der wiederum eine viel zu große Brille saß. Der Zwerg sah offenbar keinen Anlass, sich zu erheben. Er lächelte Henrik aus einem wettergegerbten, runzligen Gesicht herausfordernd entgegen. Der Mann konnte sechzig, aber auch achtzig sein.
Schließlich winkte er ihm, näher zu treten, und deutete auf den Stuhl vor seinem unaufgeräumten Schreibtisch, der rechts wie links von ihn überragenden Aktenstapeln flankiert wurde. Zigarrenrauch hing in der Luft, vermischt mit etwas, das Henrik an Mottenkugeln erinnerte. Wo waren die Düfte des portugiesischen Sommers? Landestypische Blumen, Kräuter, Lavendel. Eigentlich hatte er keine Ahnung, wie Portugal riechen sollte, doch seine Wunschvorstellungen entsprachen bislang in keiner Weise der Wirklichkeit, so viel war klar.
»Senhor Falkner, kommen Sie, kommen Sie!«
Pinhos Deutsch war passabel, was Henrik schon bei ihrem Telefonat festgestellt hatte. Er setzte sich dem Notar gegenüber, der trotz der geänderten Perspektive in seinem Sessel zu versinken drohte. Verglichen mit draußen, war es hier unangenehm kalt. Henrik hatte den Eindruck, dass der Schweißfilm auf seiner Haut zu Eis kristallisierte. Im Rücken des Notars vibrierte ein Klimagerät, welches das halbe Fenster verdeckte. Die durch den klobigen Kasten verminderte Aussicht war zu verschmerzen. Der triste Innenhof bot ohnehin keinen Anreiz hinauszublicken. Die restlichen Wände wurden ähnlich wie die im Vorzimmer von Regalen mit Aktenordnern eingenommen, die nur die Tür aussparten, durch die er eingetreten war.
»Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Danke«, erwiderte Henrik, der keine Lust verspürte, die umständliche Flugroute über Amsterdam und den zweistündigen Zwischenstopp am Flughafen Schiphol zu erläutern. Leider war es unmöglich gewesen, so kurzfristig einen Direktflug ab Stuttgart zu bekommen, was hauptsächlich den Sommerferien in Süddeutschland geschuldet war. Wenigstens war das Flugticket so um einiges günstiger gewesen.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee? Wasser?«
Er wollte die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen und lehnte dankend ab.
Pinho ließ sich davon nicht beirren und hielt an seinem Lächeln fest. Er ruckelte samt Stuhl etwas nach vorne und stützte seine Ellbogen auf die Schreibtischplatte.
»Gut, ich brauche noch Ihren Personalausweis, dann können wir anfangen!«
Henrik holte den Ausweis aus seinem Portemonnaie und reichte ihn dem Notar, der nur einen flüchtigen Blick darauf warf und ihn sogleich zurückgab. Nun zog Pinho eine in Schweinsleder gebundene Mappe vom rechten Aktenstapel und legte sie sorgsam vor sich ab.
»Ich habe Ihnen ja bereits am Telefon angedeutet, was Sie erwartet.«
»Kannten Sie ihn näher?«, fragte Henrik dazwischen. »Oder ist er mit dieser … ähm, Angelegenheit zu Ihnen gekommen, weil Sie Deutsch sprechen?«
Pinho wiegte seinen Zwergenschädel hin und her. »Er hat bloß zweimal vor mir auf diesem Stuhl gesessen, so wie Sie jetzt. Sein erster Besuch diente dazu, die Formalitäten durchzusprechen. Die Woche darauf kam er, um die Dokumente zu unterschreiben.«
»Damit haben Sie ihn zweimal öfter getroffen als ich«, murmelte Henrik. »Sie verstehen also, wieso ich eine gewisse Zurückhaltung an den Tag lege, was diese Sache angeht.«
Der Notar nickte. »Kein Grund, beunruhigt zu sein! Es kommt ab und an vor, dass sich Erbe und Vererber nicht persönlich kennen, ein unbestreitbares Familienband jedoch dazu verpflichtet.«
Ein Familienband? Etwas Derartiges existierte zwischen seiner Familie und Martin Falkner praktisch nicht. Dass seine Mutter einen Bruder hatte – gehabt hatte –, war ihm zwar bekannt, doch es war nicht geduldet, über Onkel Martin zu sprechen. Folglich war er zu keiner Familienfeier eingeladen worden, nicht einmal zu Beerdigungen, zu denen die Verwandtschaft üblicherweise in besonders großer Schar gepilgert kam. Die Falkners haben Geld, vielleicht gibt es was zu holen?
Martins Dasein wurde schlichtweg ignoriert, weshalb Henrik auch nie in die Verlegenheit gekommen war, diesen nebulösen Verwandten jemals zu hinterfragen.
Und nun das.
»Es ist nicht Teil meiner Aufgabe, die Hintergründe zu erörtern«, unterbrach ihn Pinho in seinen Gedanken. »Ich kümmere mich lediglich um die Formalitäten.« Der Notar musterte ihn für ein paar Sekunden, bevor er fortfuhr. »Sie waren noch ein Kleinkind, als Martin Falkner in Lissabon seine zweite Heimat fand. Was sich zwischenzeitlich ereignet hat, entzieht sich meiner Erkenntnis. Fest steht letztlich, er hat sich an Sie erinnert. Alleine das zählt.«
Ja, aber warum ausgerechnet an mich?, lag ihm auf der Zunge, doch er behielt die Frage für sich. In den grauen, von buschigen Brauen beschatteten Augen des Notars lag keine Antwort. Das Summen der Klimaanlage war für einige Momente das einzige Geräusch innerhalb der vier Wände des Notariats.
»Wann hat er das Testament verfasst?«
»Ihr Onkel war Ende Mai bei mir, die Unterzeichnung erfolgte Anfang Juni. Ich hatte natürlich nicht erwartet, dass es danach so schnell geht. Er sah sehr vital aus. Vielleicht eine Vorahnung?«, sinnierte Pinho.
Henrik ließ sich das durch den Kopf gehen. Wusste Martin, dass er nicht mehr lange zu leben hatte? Der Notar hatte am Telefon von einem Herzinfarkt gesprochen, aber keine näheren Angaben dazu machen können. Würde er in der Stadt jemanden finden, der ihm mehr dazu sagen konnte? Wie auch immer es dazu gekommen war, die Testamentshinterlegung vor einem Vierteljahr deutete darauf hin, dass Martin im besten Alter von zweiundsechzig Jahren über den Tod nachgedacht hatte. Und sich dabei eines Neffen erinnerte, den er nie zu Gesicht bekommen hatte. Es lag nicht nur an der gekühlten Luft, die der leise quietschende Ventilator unermüdlich in das Büro des Notars blies, dass Henrik ein Schauder über den Rücken lief. Diese Erbschaftsangelegenheit zog einen Schweif von Fragen hinter sich her, der mit jeder Stunde länger wurde.
»Sind Sie bereit?«, wollte Pinho wissen, und Henrik hätte am liebsten den Kopf geschüttelt. Doch er blieb regungslos auf dem mit Leder gepolsterten Stuhl sitzen. Pinho nickte und klappte die Mappe auf. Es war kein feierlicher Moment. Die Situation fühlte sich eher unwirklich an. Obenauf lag ein Umschlag, den ihm der Notar sogleich entgegenstreckte.
»Ein persönlicher Brief. Wenn Sie ihn zuerst studieren wollen, lasse ich Sie damit kurz allein. Ansonsten würde ich nun den Letzten Willen des Verstorbenen verlesen.«
Das Kuvert war perlmuttfarben. In Tinte und mit geschwungener Handschrift stand Für Henrik darauf. Er nahm den Brief entgegen. Seine Finger zitterten. Pinho hatte bei ihrem Telefonat verlauten lassen, dass niemand außer ihm zu der Testamentsverlesung geladen war. Unbeantwortet war die Frage geblieben, was es zu erben gab. Damit hatte der Notar hinter dem Berg gehalten, als ginge es um eine Geburtstagsüberraschung, die er nicht verderben wollte. Auf Henriks Bemerkung hin, dass er an die Reisekosten denken müsse, hatte Pinho lediglich erwidert, dass es da gar nichts zu überlegen gäbe. Lissabon sei jederzeit eine Reise wert.
Für Henrik.
Nun war er hier. Hatte den Skeptiker in sich in die Schranken gewiesen, was sich für eine geraume Zeit sogar gut angefühlt hatte. Zumindest bis zu dem Moment, als er heute in aller Herrgottsfrühe zum Flughafen aufgebrochen war. Ab da musste er sich zwingen. Zum Check-in. Zum Einsteigen in das Flugzeug. Wie oft war er während seiner zwei Stunden in Amsterdam kurz davor gewesen, den nächstbesten Flug zurück nach Stuttgart zu buchen. Selbst noch nach der Landung hier, nachdem er hinaus aus dem Terminal an den Taxistand getreten war und auf den nächsten freien Wagen gewartet hatte. Selbst da wäre er lieber noch umgekehrt. Weil ihm alles wie eine komplett idiotische Idee vorkam. Eine Schnapsidee, so verrückt, dass er niemandem davon erzählt hatte. Keinem Freund. Nicht seiner Schwester und auch nicht seiner Mutter. Erst recht nicht seiner Mutter. Ihm reichte schon die Vorstellung, ihr zu beichten, dass Martin ihn in seinem Testament berücksichtigt hatte. Sie würde … ja, was? Ausrasten? Ihm ihrerseits mit Enterbung drohen? Er hatte keine Ahnung, was seine Mutter dazu sagen mochte, nur würde es sich gewiss nicht um Glückwünsche handeln. Lag darin vielleicht die Erklärung, warum er hierhergekommen war? Weil seine Familie all die Jahre so ein Geheimnis um seinen Onkel gemacht hatte?
Nein, die Ablehnung seiner Mutter gegenüber Martin vorzuschieben war zu einfach. Der wahre Grund für seinen überstürzten Aufbruch nach Lissabon war weitaus komplizierter. Unnötig, sich da was vorzumachen. Weder Skepsis noch Rationalität noch irgendetwas anderes, das gegen eine Lissabonreise gesprochen hätte, war stark genug, um ihn von der Reise abzuhalten. Er wollte der Dunkelheit Einhalt gebieten. Es war ein irrationaler Weg, aber irgendwie auch der einzige, der ihm blieb. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und auf diesem Weg bestand immerhin die winzige Chance, dass er ihn zurück ins Licht führte.
Sein Mund war trocken. Er hätte vorhin das Wasser nicht ablehnen sollen. Seine Stimme war nur ein leises Knistern, als er den Notar aufforderte: »Fangen Sie an!«
2
Die Luft in der Gasse war noch stickiger geworden. Oder es fühlte sich nur so an, weil er überhastet aus dem klimatisierten Büro geflüchtet war. Die Hitze hüllte ihn ein, aber das spielte keine Rolle mehr. Die Verwirrung in seinem Kopf reduzierte seine Umgebung zu einem vagen Bild, das ihm nichts anhaben konnte. Wusste er nun mehr als vor seinem Besuch bei Pinho?
Ins Licht?
Sein Puls schlug heftig. Wie nach einem seiner Waldläufe. Nach der großen Runde mit den zwei Anstiegen und den dreißig Liegestützen zum Abschluss. Dabei hatte er nur dagesessen, gelauscht und zwischendurch genickt, um dem Notar zu vermitteln, dass er noch anwesend war. Körperlich zumindest.
Er brauchte etwas zu trinken. Sofort, bevor er umkippte. An einem der Tische des kleinen Straßenausschanks saß nun ein Mann. Ein Glatzkopf, der seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille verbarg und den unteren Teil seines Gesichts hinter einem wuchernden Vollbart versteckte. Eine Mode, die man immer öfter sah. Das Haupthaar, das oben auf dem Kopf keinen Halt mehr fand, war runter ans Kinn gerutscht. Der Mann bemerkte, dass Henrik ihn musterte, und schob die Zeitung höher. Die Schlagzeile auf dem Titel war so fett gedruckt, dass er sie sogar auf die Entfernung lesen konnte.
BANCARROTA – VIEIRA DESISTIR?
Plötzlich verspürte er den Wunsch, unbemerkt zu bleiben. Es mochte an seinem Job liegen, der ihn gelehrt hatte, eine Situation sensibler zu erfassen oder auf andere Art zu interpretieren, als gewöhnliche Leute es taten. Sein Instinkt drängte ihm den Verdacht auf, dass der Mann nur vorgab, die Zeitung zu lesen. Eine Vermutung, die allerdings keinen Sinn machte. Niemand außer Pinho und dessen Sekretärin wussten, dass er in Lissabon war. Und schon gar nicht, weshalb. Aber der Polizist in ihm ließ sich nicht von seiner Wahrnehmung abbringen. Er fühlte sich durch den Bärtigen beobachtet.
Durst hin oder her, er entschied, vor bis ins Baixa-Viertel zu gehen, um dort in der anonymen Menschenmasse unterzutauchen. So schnell es die Hitze erlaubte, marschierte er die Rua Nova do Carvalho entlang, bis andere Gedanken das Gefühl der unerklärbaren Anspannung ablösten. Ja, es gab weiß Gott wichtigere Dinge, mit denen er sich beschäftigen sollte!
Er besaß nun ein Haus, mitten in Lissabon.
Nein, korrigierte er sich. Er konnte ein Haus in Besitz nehmen. Noch hatte er nichts unterzeichnet. Vor allem wegen der Klausel. Dieser eigenwilligen Auflage, auf die sein Onkel so großen Wert legte. Gewissermaßen aus dem Jenseits heraus diktierte Martin seine Bedingungen, die der Notar bei der Verlesung des Testaments mehrfach wiederholt hatte. Henrik wusste nicht, was er davon halten sollte. Er kam sich hilflos vor.
Von Pinhos Monolog waren ihm nur ein paar Brocken im Gedächtnis geblieben. Unter anderem den steuerlichen Kram betreffend. Begrifflichkeiten, die für gedankliche Wirren gesorgt hatten, ohne dass er sich an Details erinnerte. Dazu hatte ihm die Konzentration gefehlt. Einziges Fazit: Er fühlte sich mit allem überfordert und brauchte Zeit zum Nachdenken. So hatte er es dem Notar gesagt. Drei Worte. Ich muss nachdenken!
Mehr war nach der Testamentsverlesung nicht über seine trockenen Lippen gekommen. Artur Pinho hatte verständnisvoll gelächelt und ihm eine Zigarre angeboten, die er kopfschüttelnd ablehnte.
»Melden Sie sich, wenn Sie so weit sind, aber zögern Sie nicht zu lange!«, hatte Pinho ihm mit auf den Weg gegeben.
Zögern Sie nicht zu lange.
Nach fünf Minuten Fußmarsch erreichte Henrik die Praça do Comércio, den prächtigen Exerzierplatz, direkt am Fluss gelegen, von wo man durch den Arco da Rua Augusta, den pompösen Triumphbogen, in das weltberühmte Einkaufsviertel gelangte. In der Mitte des sonnenüberfluteten Karrees ragte die Reiterstatue Josés I. in den wolkenlosen Himmel. Dahinter brandete der Tejo gegen die Kaimauer, der an dieser Stelle bereits zu einem breiten Delta angewachsen war und sich mit dem Salzwasser des Atlantiks mischte.
Henrik kaufte eine Flasche Mineralwasser an einer der Buden, wo Trauben von Touristen auf die historischen Straßenbahnen der Linie 28 oder einen der Doppelstockbusse für ihre Stadtrundfahrt warteten. Der Trubel ließ ihn unberührt, hatte sogar etwas Beruhigendes an sich. Gierig leerte er die Hälfte der Flasche noch an der Bude. Dann wandte er sich in Richtung Fluss, überquerte den trotz mangelndem Schatten belebten Platz und setzte sich auf eine der Steinstufen, die direkt hinein ins braune Wasser führten. Die Entfernung zum Südufer schätzte er auf mehrere Kilometer. Drüben säumten Industrieanlagen den Tejo. Rechts von ihm, gut drei Kilometer flussabwärts, wurde das mächtige Gewässer von der Brücke des 25. April überspannt, die in Form und Farbe an die Golden Gate Bridge in San Francisco erinnerte. Unweit von dort, wo sie wieder auf Land traf, ragte auf einer Anhöhe Cristo Rei in den Himmel. Die knapp dreißig Meter hohe Jesusstatue, die wiederum mit weit ausgebreiteten Armen auf einem fünfundsiebzig Meter hohen Sockel steht, ähnelte der in Rio de Janeiro.
Henrik trank den Rest des Wassers, während seine Augen die Umgebung studierten. Er war nicht unvoreingenommen hierhergekommen, dennoch gefiel ihm, was er sah. Er fühlte Erleichterung, auch wenn er sich das nicht zu erklären vermochte. Genau so wenig wusste er, ob er sich in seinem psychischen Zustand überhaupt darauf einlassen konnte. Wie gerne hätte er diesen Augenblick, diese Aussicht auf die Stadt, die Gerüche und Geräusche, die Wärme und die Leichtigkeit dieses südländischen Sommers mit Nina geteilt. Wie befreiend wäre es gewesen, wenn sie hier auf dieser grob gehauenen Steinstufe neben ihm gesessen hätte und er den Arm um ihre Schulter hätte legen können. Wie beruhigend für ihn, hätte er sie jetzt und hier nur an sich ziehen und den Duft ihres Haares atmen können, so wie er es in vertrauten Momenten immer getan hatte.
Nina …
Er betrachtete seinen Ehering, den die Sonne Portugals zum Funkeln brachte. Selbst nach zwei Jahren überrannte ihn die Trauer noch immer ungebremst. Hinterrücks und mit Gewalt. Eine Flutwelle, die aus dem Mittelpunkt seiner Seele quoll und sich seiner bemächtigte, ihn mitriss in die ewige Schwärze der Verzweiflung. Seine Hand zerdrückte die leere Plastikflasche, ohne dass er es bewusst wahrnahm. Und die Trauer hatte grundsätzlich den Hass im Gepäck. Viel heftiger als kurz nach ihrem Tod. Da war es die Ohnmacht über den Verlust gewesen, die den Hass überdeckte. Doch mit dem Verstreichen der Zeit kamen immer mehr Kontrast und Schärfe hinzu, und aus Verbitterung wurden Zorn und Feindseligkeit.
Jemand berührte ihn an der Schulter.
Er zuckte zusammen.
Aus einem runden Gesicht blickten ihm zwei große, tiefbraune Augen neugierig entgegen. Schnell zwang er sich zu einem Lächeln, obwohl er ahnte, dass es nur zu einer gezwungenen Grimasse reichte. Der Junge, der nicht älter als vier Jahre sein konnte und dessen kleine Hand immer noch auf seiner Schulter lag, machte es ihm nach und lachte seinerseits. Verglichen mit dem seinen war es ein Lachen direkt aus dem Herzen, ehrlich und offen, wie nur Kinder es zustande brachten.
Der Junge hatte sich unbedarft an Henrik festgehalten, um die für seine kurzen Beine zu hohen Treppenstufen zu meistern, und nicht damit gerechnet, einen Mann zu erschrecken, der in einen inneren Abgrund starrte.
Henrik griff nach der Hand des Jungen und verlieh ihm die nötige Balance, damit der Kleine unbeschadet die verbliebenen drei Stufen bis hinunter zur Wasserkante bewältigen konnte.
»Rodrigo!«, hörte er eine Frauenstimme in seinem Rücken. Er wandte sich um, ohne das Kind loszulassen, und blinzelte zur Kaimauer hinauf. Die Frau, ohne Zweifel die Mutter, stöckelte bereits die Treppe hinunter, während eine Flut von Worten aus ihrem Mund strömte. Henrik konnte nicht unterscheiden, ob sie ihm oder dem Jungen galten. Er versuchte es erneut mit einem Lächeln. Erst als die Frau mit ihm auf gleicher Höhe war, erfasste sie die Situation. Der fremde Mann hielt ihr Kind davon ab, ins Wasser zu fallen. Mit einem knappen Nicken in seine Richtung nahm sie den Kleinen hoch und drückte ihn fest an sich. Eine Reaktion, die dem Jungen nicht gefiel, doch der Beschützerinstinkt der Mutter duldete keinen Widerspruch.
»Obrigada!«, sagte die Frau, nachdem sie ihn noch einmal durchdringend gemustert hatte, und mühte sich dann zusammen mit ihrem zappelnden Sprössling die Treppe hoch. Rodrigos Protest erstarb schnell. Der Junge warf Henrik über die Schulter der Mutter hinweg einen enttäuschten Blick zu. Der Kleine hatte nicht geschafft, seine Finger in das kühle Wasser zu tauchen, aber Henrik konnte in den dunklen Kulleraugen schon jetzt die feste Absicht erkennen, einen erneuten Versuch zu starten, sobald er sich von der Mutter unbeobachtet wusste.
Auch er hätte ein Kind in diesem Alter haben können, schoss es ihm durch den Kopf, und dieser Gedanke war eine weitere mannshohe Welle, die Trümmer von Trauer mit sich spülte.
Für unbestimmte Zeit saß er auf der Treppe und starrte ins Wasser. Die Geräusche der Stadt, die tausend Stimmen um ihn herum, verschmolzen mit dem Plätschern der Wellen. Unter dem Brennen der Sonne in seinem Nacken holte ihn die Müdigkeit ein. In Erwartung eines motivierenden Schubs schlug er sich mit den flachen Händen kräftig auf die Oberschenkel. Der Stimulationseffekt war mäßig, reichte aber, um nach dem Brief zu tasten, den er in die Reisetasche gesteckt hatte. Mit zitternden Fingern riss er den Umschlag auf, fischte das einzelne Blatt heraus und faltete es auseinander. Die gleiche saubere Handschrift wie auf dem Kuvert, leicht nach rechts fallende Buchstaben, eng gesetzt, ohne dass das Schriftbild gedrängt wirkte. Die Wörter waren tief ins Papier gedrückt, und den Schwüngen fehlte die Unbeschwertheit, die er von jemandem erwartete, der sich für ein Leben in dieser Stadt entschieden hatte. Er war kein Grafologe, wagte aber die Prognose, dass dies nicht die Handschrift eines entspannten Menschen war. Das Datum lag rund acht Wochen zurück. Sein Schatten fiel auf das Papier, auf dem trotz der leichten Struktur die Tinte nicht verlaufen war.
Lieber Henrik!
Sehr zu meinem Bedauern haben wir uns nie persönlich kennengelernt. Deine Tante Brigitte war allerdings so freundlich, mir gelegentlich von Dir zu berichten, und wenn sie mir zu Weihnachten schrieb, legte sie gerne Fotos dazu. Zumindest die ersten Jahre noch. Wie auch immer, sie war über die Jahrzehnte meine einzig verbliebene Verbindung zu Deiner Familie, die früher auch die meine gewesen ist. Ich weiß, dass sie Euch gegenüber verschwiegen hat, mit mir in Kontakt zu stehen. Um des lieben Friedens willen war das sicher auch besser so. Ich will mich in diesem Brief nicht darüber auslassen, wie und warum es überhaupt dazu gekommen ist. Deswegen wurde in der Vergangenheit genug Porzellan zerschlagen, ohne dass die Scherben jemals aufgefegt worden wären.
Jetzt und heute geht es darum, nach vorne zu schauen. Auch für Dich, denn ich weiß, Du hattest eine schwere Zeit und hast sie wahrscheinlich immer noch. Einen geliebten Menschen zu verlieren verändert alles, und die Welt wird nie wieder, wie sie war. Gegen diesen schlimmsten aller Schmerzen gibt es kein Mittel, das brauche ich Dir nicht zu erklären. Aber es wird leichter, das Leben zu ertragen, wenn man Veränderung sucht. Ich eröffne Dir hierzu einen Weg, lieber Henrik, und ich wünsche mir sehnlichst, dass Du diesen Weg ins Licht beschreitest. Auch mir zuliebe und nicht ganz ohne Hintergedanken, wie ich gestehen muss. Ich bitte Dich einfach darum, Augen und Geist zu öffnen, alles andere wird sich fügen, wenn Du der aufrechte Mensch bist, für den ich Dich halte.
Dein Martin
Einen Weg zurück ins Licht. Augen und Geist öffnen. Konnte Martin Gedanken lesen? Henrik drehte das Blatt, doch die Rückseite war leer. Er las die Zeilen erneut, ohne weitere Erkenntnisse zu erlangen. Selbst im Kuvert sah er nochmals nach, obwohl es nur dieses eine Blatt enthalten hatte. Vielleicht sollte er einfach mit Brigitte sprechen. Zwar hatte er seine Tante seit Ninas Beerdigung nicht mehr getroffen, aber wie es schien, war sie über sein Leben gut informiert. Sicher durch seine Mutter, die es zweifelsfrei nicht gutheißen würde, dass die Schwester ihr Vertrauen missbraucht und Informationen an ihren verstoßenen Bruder weitergetragen hatte.
Henrik steckte den Brief zurück in den Umschlag und starrte auf den Fluss hinaus. Martin bot ihm Veränderung. Wollte er das überhaupt? Den Schmerz überwinden und neu beginnen? Das Leben wieder erträglich machen? Nichts davon konnte er beantworten. Zumindest jetzt im Moment nicht. Er hatte sich gut eingerichtet, mit seiner Trauer, dem Hass und dem Selbstmitleid. Konnte er die Kraft finden, diese eigenwillige Wohngemeinschaft zu verlassen?
Es fiel ihm schwer, sich zu erheben. Mit zu Schlitzen verengten Augen wandte er sich der Stadt zu. Die prächtigen Gebäude, die den Platz auf drei Seiten umgaben, strahlten im grellen Licht des Nachmittags. Der Weg bis hinüber zum Triumphbogen erschien ihm unglaublich weit. Nach dem, was der Notar ihm offenbart hatte, hätte er aufgeregt sein müssen. Von Neugier beflügelt. Stattdessen lagerte Blei in seinen Beinen. Seine Reisetasche wog tonnenschwer. Selbst die Sonne versagte bei ihrer Aufgabe, in seinem Körper die Endorphinproduktion anzukurbeln. Keine Ausschüttung von Glückshormonen, nur Schlappheit und Schweiß.
Die Depression war ihm lange Monate nach Ninas Tod eine stete Begleiterin gewesen. Er benötigte ein gutes Jahr, um zu lernen, wie er damit umgehen konnte, ohne in der Verzweiflung zu ertrinken. Einen erträglichen Weg zu finden, sich jedes Mal aufs Neue dagegenzustemmen, bis die Dünung abflachte. Bis er wieder Luft bekam und an ein Weiterleben glauben konnte. Danach kam sie seltener. Doch wenn sie aufblühte, dann tat sie es hinterrücks, ohne Vorwarnung und mit einer Heftigkeit, die ihn oft völlig erstarren ließ. Wie er es in all der Zeit geschafft hatte, seinen Job zu machen, war ihm selbst ein Rätsel. Wie er die Leute in seinem Umfeld hatte täuschen können. Seine Kollegen und alle, die ihm nahestanden. Einschließlich seiner selbst. Oder war es genau umgekehrt? Hatten die anderen einfach mitgespielt, weil sie wussten, in welcher Verfassung er sich befand?
Henrik schüttelte den Kopf und zwang sich zu einem ersten Schritt. Dann zum nächsten, bis er in einen Rhythmus verfiel, der ihn zügig über den quadratischen Platz trug, von der Hoffnung getrieben, dass die aufkeimende Depression ihm nicht folgte.
Er besaß eine vage Ahnung davon, wohin er musste. Trotzdem steuerte er in der breiten Einkaufsstraße hinter dem Arco da Rua Augusta den erstbesten Touristenladen an, um einen Stadtplan zu kaufen. Der Wind blies stark. Die zum Fluss hin ausgerichteten Straßen des Baixa kanalisierten die frische Brise, die keck an allem zupfte, was sie erwischte. Sie machte weder vor den Tischdecken der Straßenrestauration noch vor den luftigen Sommerkleidern der Frauen halt. Und erst recht nicht vor Faltplänen. Umständlich kämpfte er mit der Karte, bis er nachgab und um die nächste Ecke bog. Im Windschatten der von Ost nach West verlaufenden Gasse fand er den kürzesten Weg. Er musste den Hügel zu seiner Linken besteigen. Kurz liebäugelte er damit, den Elevador de Santa Justa zu nehmen, einen unter Denkmalschutz stehenden Aufzug hinauf zur Igreja do Carmo, der Kirche ohne Dach, die dem schweren Erdbeben von 1755 zum Opfer gefallen war und deren gotische Bögen seither wie die Rippen eines Walskeletts in den Himmel ragen. Doch die Schlange vor dem historischen Aufzug – zweifellos eine der touristischen Attraktionen Lissabons – war so lang, dass er den steilen Anstieg zu Fuß in Angriff nahm. Die Rua Garrett, die ihn hoch zum Chiado brachte, war schnell gefunden. Er brauchte nur den Urlaubern hinterherzulaufen, die der Empfehlung der Reiseführer folgten. Eine äußerst belebte Ecke, hatte Artur Pinho ihn vorgewarnt. Oder nein, vielmehr beglückwünscht hatte er ihn dazu. Damit befände er sich nicht nur mitten in der Stadt, sondern vor allem mitten im Leben.
Mitten im Licht.
Henrik passte sich der Geschwindigkeit des dahinschlendernden Touristentrosses an, der sich trotz der Hitze unermüdlich, mit Einkaufstüten oder Rucksäcken bepackt, durch die Innenstadt schob. Wobei die Hälfte dieser Menschen die klassizistische Architektur mit den prachtvollen Fassaden nur über die Displays ihrer Digitalkameras und Smartphones betrachteten und dabei gerne auf Passanten aufliefen, die ihrerseits stehen geblieben waren, um zu fotografieren oder die Auslagen in den Schaufenstern zu betrachten. Was dazu führte, dass Henrik immer wieder zum Ausweichen gezwungen wurde und mehrmals die Straßenseite wechselte. Lästig, aber im Prinzip egal, da auch der fortgeschrittene Nachmittag nicht einmal so viel Schatten für ihn übrig hatte, um der Sonne wenigstens etappenweise zu entkommen. Der Anstieg brachte ihn erst recht ins Schwitzen. Dazu die vielen Leute um ihn herum. Die zahllosen Stimmen, die in allen Sprachen dieser Welt zu plappern schienen. Er war froh, nach knapp zehn Minuten linker Hand die Basílica dos Mártires zu entdecken, die ihm der Notar als Orientierungshilfe beschrieben hatte. Drei bettelnde Frauen hockten in demütiger Haltung auf den Steinstufen des Portals, reckten den klerikal Interessierten Pappbecher entgegen und machten es den Leuten damit unmöglich, ungehindert das Gotteshaus zu betreten, was eine weitere Menschentraube zur Folge hatte. Henrik drängte daran vorbei. Direkt voraus konnte er den Largo do Chiado erspähen. Daran schloss sich der Largo de Camões an. Der Platz verdankte seinen Namen Portugals bedeutendstem Dichter Luís Vaz de Camões, dessen Statue zentral auf einer achteckigen Säule thronte. Der Ort war ein Tummelplatz für alle, die sich orientieren wollten. Von dort aus war man mit wenigen Schritten im berühmten Bairro-Alto-Viertel. Oder über steile Gassen abwärts in ein paar Minuten bei der Markthalle und dem Bahnhof, von dem aus die Züge entlang der Küste bis Cascais fuhren. Viele bestiegen hier auch die alte Straßenbahn, um die Stadt auf diese besondere Weise zu erkunden. Nichts davon zog Henrik in Erwägung. Im Gegenteil. Er suchte sein Heil vielmehr in der Flucht vor dem Trubel dieses belebten Platzes und folgte stur nach Beschreibung weitere hundert Meter der Rua do Loreto Richtung Westen.
Mit jedem Schritt näher an seinem Ziel, steigerten sich nun Neugier und Nervosität. Gefühle, die er bereits im Notariat erwartet und womöglich auch gespürt hatte, ohne sie wirklich zuzulassen. Plötzlich überkamen sie ihn mit Macht, als würde ihm jetzt erst bewusst werden, wohin er unterwegs war. Begleitet von dem trunkenen Eindruck, durch die Unwirklichkeit eines Traums zu taumeln.
Er kam zu der Ecke mit dem Laden für Damenunterwäsche und erinnerte sich an das eindeutige Grinsen des Notars, als der ihm diesen Orientierungspunkt genannt hatte. Gleich dahinter zweigte die Gasse ab, die er suchte. Am Eckhaus war, wie in der Stadt üblich, eine steinerne Tafel angebracht, die verkündete, dass er in der Rua do Almada angelangt war.
Nach knapp fünfzig Metern schob sich ein schmales Gebäude in die zum Fluss hin verlaufende Straße und teilte das Kopfsteinpflaster wie der Bug eines Schiffs den Ozean. Die linke Seite fiel steil ab, während rechter Hand das Niveau bestehen blieb. Hielt man sich rechts, gelangte man zum Miradouro de Santa Catarina, von wo aus man laut Artur Pinho herrlich weit über den Fluss schauen konnte. Von dem Punkt aus, an dem er stand, sah er in der Entfernung jedoch nur einen schmalen Spalt Himmel und den Teil eines Baumes, der offensichtlich den Aussichtspunkt beschattete. Milchiger Dunst hing zwischen den bis zu vierstöckigen Gebäuden und tauchte die jeweiligen Enden der geteilten Straße in diffuses Licht.
Henrik benötigte zehn Schritte in die Rua do Almada hinein, bis ihm auffiel, dass er völlig alleine war. Die vielen Leute, die ihn noch vor wenigen Sekunden umgeben hatten, waren auf den geschäftigen Einkaufsstraßen zurückgeblieben und mit ihnen das Gedränge, der Lärm der tausend Stimmen, ja selbst die Hitze. Eine Erkenntnis, die ihn innehalten ließ. Es gab in dieser Gasse offensichtlich keine verlockenden Geschäfte oder andere Sehenswürdigkeiten. Wer diesen Weg benutzte, wollte allenfalls zum Aussichtspunkt der heiligen Catarina oder zum Museu da Farmácia, worauf je eine Hinweistafel am Eingang der Straße verwies. Kein Durchgangsverkehr. Trotzdem parkten Autos Stoßstange an Stoßstange, wie in allen anderen Straßen, die er auf seinem Weg hier hoch genommen oder passiert hatte. Der gepflasterte Gehweg auf der linken Seite maß kaum einen Meter und war von hüfthohen Pfosten gesäumt, die verhindern sollten, dass noch mehr Autos abgestellt wurden. Dennoch mussten die Besitzer breiter Wagen befürchten, mit dem Außenspiegel an der Wand entlang zu schrammen, wollten sie die Gasse unter den gegebenen Voraussetzungen befahren. Henrik dachte für einen schwachen Moment an die Möglichkeit, mit einem Möbelwagen hier einzubiegen, verscheuchte den Gedanken aber sofort. Er zog sich das T-Shirt vom schweißnassen Rücken und wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Die geraden Hausnummern befanden sich zu seiner Linken. Langsam ging er weiter und las leise murmelnd die Zahlen an den Häusern ab, an denen er vorüberschritt. Das keilförmige Gebäude, auf das er zusteuerte und das so markant die Straße teilte, beherbergte eine Bar. Esquina war in grünen Lettern auf die weiße Markise gedruckt. Davor standen drei Tische unter ebenso vielen zugeklappten Sonnenschirmen. Zu gerne hätte er sich dort hingesetzt und etwas zu trinken bestellt. Einen Espresso, in dem er lange die Crema verrühren konnte, nur um der Neugier und Nervosität zum Trotz den Moment der Wahrheit noch eine Weile hinauszuzögern. Leider war das Etablissement geschlossen.
Unfreiwillig beschleunigte das Gefälle seine Schritte. Es waren gar nicht viele, bis er das Schild entdeckte, das über den Gehsteig ragte. Ein kaum nennenswerter Blickfang, den man von der belebten Einkaufsstraße aus nicht sehen konnte und der allenfalls denen ins Auge stach, die sich zufällig in diese Ecke verirrten.
Antiquário e Antiguidade entzifferte er auf dem runden Blechschild.
Er hielt sich ganz rechts, um das vierstöckige Haus in vollem Umfang mustern zu können.
Das war es also.
Sein Erbe.
Nummer 38 war ohne Zweifel das heruntergekommenste Gebäude in der Straße, die in ihrer Gesamtheit ohnehin nur mäßig mit Pracht glänzte. Der Ruß, die Abgase und der Taubenkot von Jahrzehnten hatten sich in den bereits erodierten und von Rissen durchzogenen Sandstein gefressen, der die Fassade einst geschmückt hatte. Wenn er den Kopf weit in den Nacken legte, konnte er Grasbüschel, ja halbe Sträucher auf dem Dach und den oberen Simsen sprießen sehen. Die Fenster schienen immerhin ganz zu sein. Bedenklicher wirkte da schon der Zustand der Haustür, die von einem maroden Türstock an Ort und Stelle gehalten wurde und deren unteres Segment mit einem schlichten Sperrholzbrett ausgebessert worden war. Es gab keine Türschilder oder Klingeln. Neben dem Eingang schloss direkt die Ladentür des Antiquariats an. Sie war bepflastert mit mehreren Schichten von Plakaten und Aufklebern, sodass er unmöglich sagen konnte, aus welchem Material sie gemacht war. Es gab keinen Hinweis auf einen Inhaber oder auf Öffnungszeiten. Das Schaufenster daneben, das dringend einer Reinigung bedurfte, war mit ehemals dunkelblauem Brokat ausgekleidet, über den sich eine graue Staubschicht gelegt hatte, die auch die ausgestellten Exponate nicht verschonte. Eine Handvoll sehr alt aussehender Bücher, zwei Radierungen in wurmstichigen Rahmen aus dunklem Holz, dazwischen mehrere Kerzenhalter und Becher aus Messing, lieblos drapiert auf einem Büßerschemel. Das zumindest glaubte er vor sich zu haben – eine wuchtige, aus Holz gezimmerte Bank, auf der in vergangenen Epochen demütig kniend Zwiegespräche mit dem Herrgott geführt worden waren.
Henrik schluckte trocken. Das Ganze war unheimlich. Gleichwohl besaß es den ungeahnten Reiz, den Kuriositäten auf ihn ausstrahlten. Vorsichtig, als wäre der Bereich um den Eingang vermint, trat er heran und legte seine Hand auf den abgewetzten Griff der Ladentür. So verharrte er für einen weiteren Atemzug, wie auf eine Eingebung wartend. Da diese ausblieb, schob er die Tür nach innen. Eine Glocke bimmelte über seinem Kopf. Sein Geruchssinn wurde mit olfaktorischer Wucht überflutet. Es roch, wie er es in einem Antiquariat erwartet hätte und doch um ein Vielfaches intensiver. Henrik empfing die konservierte Luft der Jahrhunderte, die nicht immer die beste gewesen war. Ihm war, als würde er seinen Körper in ein zähes Gelee aus vergangenen Epochen hineindrücken. Hinzu mischte sich die rauchige Exotik fremder Welten, was es schlichtweg unmöglich machte, einzelne Düfte herauszufiltern. Eine sinnverwirrende Synfonie von Aromen, die ihm einen leichten Schwindel verursachte, weshalb er es nicht wagte, die Hand von der Klinke zu nehmen.
Er blinzelte. Da er vom grellen Sonnenlicht in gefühlte Dunkelheit getreten war, reagierten die Sehnerven träge. Dann kamen erste Bilder verzögert im Gehirn an. Nach und nach schälten sich Konturen aus der düsteren Umgebung. Eine enge Flucht in die Finsternis, zu beiden Seiten flankiert von bis zur Decke reichenden Regalen, deren Bretter sich unter der Last der unzähligen Bücher besorgniserregend durchbogen. Selbst auf dem Boden stapelten sich Büchertürme, die ihm zum Teil bis zur Hüfte reichten und nur einen sehr schmalen Gang frei ließen, der in den hinteren Teil des Ladens führte. Neben dem Schaufenster, das weitgehend blind war, gab es orientalisch aussehende Deckenleuchten. Deren orangefarbenes Licht war so schwach, dass es von den Staubteilchen verschluckt wurde, die alles in einen Nebel tauchten. Unmöglich für Kunden, bei dieser Beleuchtung auch nur eine Zeile in einem der Bücher zu lesen, die zu Tausenden den Laden füllten.
Darauf bedacht, keinen der Bücherstapel umzustoßen, arbeitete sich Henrik vorwärts, bis sich in dem Regal zu seiner Linken ein Durchlass öffnete, der ihn zu einem Tresen leitete, vermutlich der Standort der Kasse. Die Wände dahinter waren mit Gemälden, Landkarten und Plakaten verhängt. Selbst von der Decke baumelten überall Gegenstände. Verbeulte Kupfertöpfe und -kannen, asiatisch anmutende Lampions in allen Farben, Sonnenschirme aus Zeiten, in denen Frauen noch Reifröcke trugen. Vieles von dem vorsintflutlichen Kram hing zu tief, um sich bei Henriks Größe aufrecht bewegen zu können. Er drängte an einer Ecke mit Devotionalien und Esoterikramsch vorbei, in der unter anderem Räucherstäbchenhalter, feiste Buddhafigürchen und angelaufene Klangschalen drapiert waren. Dazu allerlei Zeug, das Henrik auf den ersten Blick nicht einordnen konnte. Überfordert von den abstrusen Eindrücken, drehte er sich Hilfe suchend um seine Achse, ohne jemanden zu entdecken. Das Antiquariat war so verwaist wie der Stockfischladen, über dem Pinho sein Notariat betrieb. Erst als er bis an den Tresen herangetreten war, entdeckte er eine weiterführende Tür, die zur Hälfte von einem Vorhang verdeckt wurde. Auch sie war mit Plakaten beklebt. Da das Glockengebimmel über dem Eingang kein Gehör gefunden hatte, räusperte er sich laut und lauschte auf eine Reaktion.
»Olá!«, versuchte er sein Glück nach weiteren fünf Sekunden.
»Bom dia!«
Henrik fuhr herum. Vor ihm stand eine Frau, deren wirre Locken von einem bunten Tuch gebändigt wurden. Das Alter hatte bereits einige graue Strähnen in das schwarze Haar der Frau gewoben, die ihren schlanken Körper in ein farbenprächtiges, orientalisch anmutendes Wickelkleid gehüllt hatte. Im schwachen Licht der Lampe über ihnen schätzte Henrik sie auf Ende vierzig. Sie sah zu ihm auf und lächelte.
»Bom dia!«, wiederholte er.
»Sehen Sie sich ruhig um!«, forderte sie ihn in passabel klingendem Deutsch auf.
Henrik blickte an sich hinab. »Woher …?« Was trug er an sich, dass sie ihn sofort als Deutschen identifiziert hatte? Seine Verwunderung ließ sie für einen kurzen Moment noch eine Spur breiter lächeln. Dann wurde sie ernst, und ein Schatten von Traurigkeit flog über ihr schmales Gesicht. »Ich habe lange mit einem Landsmann von ihnen zusammengearbeitet«, erklärte sie knapp, schob sich an ihm vorbei und stellte sich hinter die Verkaufstheke. »Suchen Sie was Bestimmtes?«
Henrik betrachtete die Frau, die ihn ihrerseits erwartungsvoll musterte. Eigentlich war sie zu jung, um aus der Hippiegeneration übrig geblieben zu sein. Trotzdem lief sie herum wie Janis Joplin. War sie Martins Angestellte –oder gar mehr? Es wäre angebracht, sich vorzustellen, aber die Worte wollten einfach nicht aus seinem Mund. Was in erster Linie daran lag, dass er selber noch nicht bereit war, den Letzten Willen seines Onkels zu akzeptieren.
Das Chaos um ihn herum, dieses Haus mit der verrußten Fassade inmitten dieser fremden Stadt, das alles machte die Entscheidung nicht einfacher. Genauso wie die Rätsel um den Mann selbst, dessen Vermächtnis er hier entgegennehmen sollte.
»Den Besitzer«, erwiderte er deshalb. Eine absolut unangebrachte Antwort, aber letztlich entsprach sie seinem Ansinnen. Er suchte Martin Falkner oder dessen Geist, wenn man so wollte. Wohlwissend, dass sein Onkel ihm seine zahllosen Fragen nicht mehr beantworten konnte.
Die Miene der Frau versteinerte. Die Offenheit in ihren Zügen wich einem unübersehbaren Misstrauen. »Wer sind Sie?«
Nun gab es keine Ausflüchte mehr. »Martin war mein Onkel«, gestand er und schaffte es nicht, ihr dabei direkt in die dunklen, von feinen Fältchen umrahmten Augen zu blicken, die sich sogleich mit Tränen füllten.
»Dann wissen Sie doch …« Die Wörter, die ihm danach entgegenschlugen, waren fremd und durchzogen von Trauer und Wut.
Er ließ sie ausreden, wartete, bis sie verstummte und sich mit dem Handrücken die Tränen von den hohen Wangen gewischt hatte. Sekunden verstrichen, in denen sie sich gegenseitig belauerten.
»Ich bin Henrik!«, brach er das Schweigen und hielt ihr die Hand hin. Sie zögerte, zuckte kurz, überlegte es sich dann anders und behielt die ihre hinter dem Tresen versteckt.
»Catia«, stellte sie sich vor. »Was wollen Sie hier? Nie hat sich seine Verwandtschaft für ihn interessiert, nicht einmal zur Beerdigung ist jemand aus Deutschland gekommen.« Aus ihrer Stimme war jede Wärme gewichen.
Henrik hatte nicht mit Vorwürfen gerechnet und daher auch keine Entschuldigung parat. Für was sollte er sich auch entschuldigen? Die Familie hatte ihm Martin all die Jahre vorenthalten. Ebenso dessen Tod, falls in Deutschland überhaupt jemand davon erfahren hatte. Catias heftige Reaktion bestärkte ihn in seiner Vermutung, dass sie Martin sehr nahegestanden hatte, auch wenn sie deutlich jünger war. Allerdings war auch sechzig heutzutage kein Alter mehr. Selbst der Notar hatte seinen Onkel als vitalen Mann bezeichnet.
»Haben Sie ein Foto?«
Catia starrte ihn verdutzt an. »Von Martin?«
Henrik nickte.
»Sie sind doch nicht extra nach Lissabon gekommen, um sich Fotos von ihm anzusehen?«
Eigentlich konnte er die Katze nun auch komplett aus dem Sack lassen. »Ich bin der … Erbe«, gab er zurück, was sie nach Luft schnappen ließ. Dieser weitere Schreck stimmte sie nicht milder. Die vertikale Falte zwischen ihren Brauen wurde noch tiefer. Ihre schlanken Hände klammerten sich an die Kante der Verkaufstheke. Sie sah an ihm vorbei und ließ ihren Blick durch das Antiquariat schweifen. »Was wird dann jetzt aus all dem?«
»Ich weiß es nicht«, gestand er.
»Martin hat ein Testament gemacht?«, murmelte sie kopfschüttelnd mehr zu sich selbst.
»Sie wussten nichts davon?«
»Er hat … nie darüber gesprochen.«
Er wollte erfahren, was sie für Vorstellungen hatte, wie es mit diesem Geschäft hier weitergehen sollte, doch eine andere Frage war schneller aus seinem Mund. »Waren Sie … zusammen?«
Das ließ Catias Temperament erneut hochkochen. »Sie wissen nichts über Ihren Onkel«, fauchte sie und schickte erneut eine Salve Portugiesisch hinterher. Auch wenn es nur Worte waren, duckte er sich weg, als hätte sie sich eines der Bücher neben der Kasse gegriffen und ihm entgegengeschleudert.
Die Frage war unsensibel, aber sie brachte zumindest in dieser Richtung Klarheit.
»Sie haben recht, ich weiß nichts über Martin. Leider habe ich ihn nie kennenlernen dürfen. Was ich bedaure. Nicht allein deswegen, weil er mich unverhofft beerbt hat. Sondern vor allem, weil ich denke, dass er es nicht verdient hat, von unserer Familie behandelt zu werden, als würde er nicht existieren. Auch ein Grund, warum ich hier bin. Ich suche eine Erklärung dafür, was ihn nach Lissabon getrieben hat. Will wissen, wie er gelebt und was ihn letztlich dazu bewogen hat, mich als seinen Erben zu bestimmen.«
Seine Aufrichtigkeit konnte Catia ein wenig besänftigen. »Es war die Liebe, die ihn hergeführt hat«, antwortete sie leise.
In diesem Moment bimmelte die Türglocke. Henrik folgte Catias Blick. Zwischen den Regalen erschien ein dürrer Typ mit einer gigantischen Menge Dreadlocks auf dem Kopf. Seine Jeans wies etliche Löcher auf, das verwaschene T-Shirt hing ihm weit über den Hosenbund. Trotz seines Auftretens war er nicht mehr der Jüngste, stellte Henrik beim Näherkommen fest.
»Olá, Catia!«, grüßte der Mann und schlurfte in seinen Flipflops zum Tresen. Hinter seinem rechten Ohr steckte ein Joint.
Ich bin in einer verdammten Hippie-Kommune gelandet.
»Paco«, grüßte Catia knapp, »ich hoffe, du hast was für mich!« Sie hatte in ein gut verständliches Englisch gewechselt, wohl um dem Neuankömmling zu signalisieren, dass Portugiesisch aktuell kein Gehör fand.
Paco schien dies nicht weiter zu verwundern, denn er antwortete ebenso verständlich. »Die Miete, ja … scheiße, Catia, ich weiß … aber, da gibt es eine kleine Verzögerung. Unser nächster Gig ist erst morgen …«
»Paco, dieses Problem habt ihr jeden Monat, und um genau zu sein, ihr seid bereits sechs Wochen in Verzug. Aber das ist ja nun nicht mehr meine Angelegenheit. Du kannst deine Miete künftig bei ihm abliefern.« Sie wies mit dem Kinn auf Henrik, was den Mann dazu veranlasste, sich den Haarvorhang aus dem Gesicht zu schieben. Seiner Mimik war zu entnehmen, dass er Henrik zuvor nicht wirklich registriert hatte. Die naheliegende Erklärung für sein verzögertes Reaktionsvermögen war wohl den in Cannabispflanzen enthaltenen Wirkstoffen geschuldet. Trotz seiner unverkennbaren Überraschung schaffte Paco es kaum, die Lider über seinen graugrünen Augen zur Gänze zu öffnen. Er lächelte für zwei weitere Sekunden, dann klappte langsam sein Kinn nach unten. Man konnte ihm ansehen, wie sein marihuanageschwängertes Hirn zu arbeiten begann. Er zeigte mit dem Finger auf Henrik.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, was du eben gesagt hast«, wandte er sich an Catia, ohne den Blick von Henrik zu nehmen. »Reden wir wegen ihm die ganze Zeit Englisch?«
Ein Schnellspanner war er nicht, jedenfalls nicht in seinem derzeitigen Zustand.
Catia hob ihre Brauen und nickte. »Martins Erbe«, bestätigte sie Pacos fragenden Blick. Der trat einen Schritt zurück, und seine schmalen Schultern fielen noch ein Stück weiter nach vorne, sodass Henrik für einen Moment befürchtete, Paco würde sich vor ihm verbeugen. Doch dann machte der Dürre auf dem Absatz kehrt und stürmte aus dem Antiquariat. Selbst Catia wirkte erstaunt. »Jetzt geht es wohl los«, sagte sie und seufzte.
3