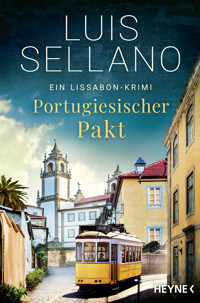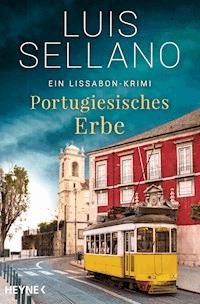11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lissabon-Krimis
- Sprache: Deutsch
Wer nach Lissabon kommt, sollte unbedingt im Pôr do sol zu Abend essen. Die Küche ist hervorragend, und die Terrasse bietet einen traumhaften Blick auf die Altstadt und den Hafen. Womöglich ist es aber auch nicht ganz ungefährlich dort. Es heißt, dass mehrere Gäste nach dem Verzehr der portugiesischen Köstlichkeiten plötzlich verstorben sind. Der ehemalige Polizist Henrik Falkner beschließt, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Als Kellner mischt er sich unter die Belegschaft, um herauszufinden, wer von seinen neuen Kollegen möglicherweise ein Mörder ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
„Die scharfen Küchenmesser tanzten nur so über die Schneidebretter und hackten in irrwitzigem Tempo Knoblauch, Kräuter und Gemüse klein. Das Olivenöl zischte in den Pfannen, während die Zwiebelwürfel glasig wurden, die Hitze die Poren des Fleisches verschloss oder den Fisch auf den Punkt garte. Teller klapperten, Töpfe scharrten über den Gasflammen. Die Spülmaschinen pumpten und gurgelten. Ein Dutzend Frauen und Männer, Köche und Küchenhilfen, werkelten vor sich hin, als ginge es um ihr Leben, aber niemand blickte in seine Richtung. Noch immer hatte Henrik keine brauchbare Vermutung, wer von den Angestellten des Pôr do sol derjenige war, den er zu identifizieren versuchte. Nein, er konnte hier nicht weg. Nicht bevor er herausgefunden hatte, wer von diesen Leuten ein Mörder war.“
Der Autor
Luis Sellano ist das Pseudonym eines deutschen Autors. Auch wenn Stockfisch bislang nicht als seine Leibspeise gilt, liebt Luis Sellano Pastéis de Nata und den Vinho Verde umso mehr. Schon sein erster Besuch in Lissabon entfachte seine große Liebe für die Stadt am Tejo. Luis Sellano lebt mit seiner Familie in Süddeutschland. Regelmäßig zieht es ihn auf die geliebte Iberische Halbinsel, um Land und Leute zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.
Lieferbare Titel
Portugiesisches Erbe, Portugiesische Rache, Portugiesische Tränen, Portugiesisches Blut, Portugiesische Wahrheit
LUIS SELLANO
Portugiesisches
Schicksal
EIN LISSABON-KRIMI
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Rezepte auf U2/U3 aus Sylvie da Silva, Lissabon – Das Kochbuch
mit freundlicher Genehmigung des Südwest Verlags.
Abbildungen © Virginie Garnier
Karte siehe hier: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Originalausgabe 04/2021
Copyright © 2021 by Luis Sellano
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Schlück GmbH, 30161 Hannover
Redaktion: Tamara Rapp
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (eskystudio, lauravr, Pakhnyushchy, Tetiana Chernykova, PhuchayHYBRID)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-26459-8V003
www.heyne.de
Prolog
Dunkelrote Rinnsale bahnten sich ihre gewundenen Wege über die Stirn, längs der Schläfen und dann die Wangen hinab. Die Frau schrie laut und schrill. Gerade so, als steckte ein Messer in ihrer Brust. Völlig unverhältnismäßig, fand Henrik.
Steif aufgerichtet saß sie da und fuchtelte mit den Armen, während sich nun auch der Kragen ihrer weißen Bluse rot färbte. Das war der Moment, der ihren Begleiter aus seiner Starre riss. Er schoss von seinem Stuhl hoch, griff sich die Stoffserviette neben dem Teller und war mit drei ungelenken Schritten um den Tisch herum. Bei ihr angelangt, schien er allerdings nicht zu wissen, wohin er das gestärkte Leinen zuerst pressen sollte. Verunsicherung und Wut funkelten aus seinen Augen.
»Desculpe!«, entschuldigte sich Henrik Falkner zum dritten oder vierten Mal und wich einen weiteren Schritt zurück, um dem Mann mehr Platz für seine Erstversorgung zu lassen. Unter seinen Fußsohlen knirschte es; er war in die Glasscherben getreten, die auf den gebohnerten Holzdielen verstreut lagen.
Die beiden Gäste kamen aus Belgien, soweit er das ihrer Unterhaltung hatte entnehmen können. Der Mann war groß und breit und hatte schon vor dem Debakel eine ungesunde Röte im Gesicht gehabt, die nun prompt in einen Purpurton überging. Die Frau schrie noch immer wie am Spieß. Dafür war es um sie herum still geworden. Bis auf das enervierende Kreischen der Belgierin existierten quasi keine anderen Geräusche mehr in dem lang gestreckten Raum. Endlich drückte der Mann ihr die Serviette ins Gesicht, so unbeholfen, dass es aussah, als wollte er sie vor allem zum Schweigen bringen.
»Desculpe, Senhora!«, murmelte Henrik erneut. Ich sollte ihm irgendwie helfen, dachte er, auch wenn er nicht wusste, wie. Denn ohne Frage würde jede weitere Geste von ihm, jede gut gemeinte Form der Unterstützung die Situation nur noch verschlimmern. Bevor er sich noch einmal entschuldigen konnte, wurde er ruppig zur Seite gestoßen. Robert schob sich zwischen ihn und das Paar, dem Henrik mit einem einzigen Moment der Unachtsamkeit den Abend verdorben hatte. Der stiernackige Robert, der vorgab, Franzose zu sein, was man ihm nur schwer abnahm, weil er den unverkennbaren Akzent dermaßen übertrieb, dass es sich eher wie eine Parodie anhörte. Robert mit seiner lächerlich dick aufgetragenen Arroganz, der ihn eingestellt hatte und mit dem er es sich keinesfalls verscherzen durfte. Robert, sein neuer Chef.
Soeben hatte er nicht nur Henrik, sondern auch den Begleiter der Frau zur Seite gedrängt, ohne das offenbar zu merken. »Verschwinde!«, zischte er jetzt über die Schulter und begann dann der Belgierin den Rotwein von den Wangen zu tupfen, den ihr Henrik vor kaum zehn Sekunden über den Kopf gekippt hatte. Zugleich wandte er sich mit mantraartig wiederholten Entschuldigungsfloskeln an die beiden Gäste, in einer Sprache, die sich tatsächlich einigermaßen französisch anhörte.
Henrik musste sich beherrschen, um sich nicht nach den Scherben des Weinglases zu bücken, in denen er stand. Er krampfte seine Hände um das Tablett, auf dem er eben noch den vollmundigen, samtrot schimmernden Douro durch die Gaststube balanciert hatte. Dann endlich, nach einem weiteren, wilden Schnauber Roberts in seine Richtung, schaffte er es, sich abzuwenden, und flüchtete mit eingezogenem Kopf am Ausschank vorbei in die Küche. Er hatte es wirklich vermasselt.
»Geile Show!«, empfing ihn Nuno mit einem breiten Grinsen. »Voll über die Birne, Meisterleistung, Senhor Falkner. Schade, dass ich zu ölige Finger habe, um mein Handy aus der Tasche zu ziehen. Und hör nur, alemão, sie schreit immer noch!« Der rundliche Koch, der für die Beilagen zuständig war, feixte. Von seinem Arbeitsplatz aus verfügte er über eine gute Sicht in den Gastraum und konnte daher alles haarklein verfolgen. Offensichtlich fühlte er sich bestens unterhalten durch das Chaos, das Henrik gerade angerichtet hatte.
»Danke für die Anteilnahme«, knurrte Henrik. Er beobachtete, wie zwei seiner Kolleginnen aus dem Service ihrem Chef zu Hilfe eilten, bevor ihm klar wurde, dass er auch hier im Weg stand. Die Leute draußen warteten auf ihr Mittagessen, und er blockierte den Durchgang von der Küche ins Restaurant. Also verdrückte er sich in Richtung der Spülecke, in der ein Pakistani, dessen Namen er sich noch nicht hatte merken können, Essensreste von den Tellern spritzte. Das würde vermutlich bald seine Aufgabe sein – vorausgesetzt, dass ihn dieser Vorfall nicht komplett den Job kostete. Das war es dann wohl mit seiner Karriere als Kellner gewesen …
Dabei konnte er eigentlich gar nichts für das Malheur. Das volle Weinglas war ihm nur deshalb vom Tablett gerutscht, weil ein Gast am Tisch neben den Belgiern eine unachtsame, ausholende Bewegung machte, der Henrik in einem Reflex ausgewichen war. Was nicht nur ihn, sondern vor allem den Rotwein in eine unwiederbringliche Schieflage gebracht hatte. Ehe er noch länger über die Sache nachdenken konnte, stürmte Robert herein und brüllte seinen Namen, was ohne Frage nicht nur hier in der Küche zu hören war.
»’enrik! Verflucht, ’enrik!« Der zum Cholerischen neigende Restaurantleiter entdeckte ihn, stapfte auf ihn zu und hob drohend den Zeigefinger. »Wir spreschen uns nach der Schischt!«, zischte er, schnappte dann nach Luft wie ein Karpfen auf dem Trockenen, drehte sich um und ließ ihn stehen.
Henrik sah sich um. Keiner in der Küche wagte es, den Kopf zu heben. Entweder weil keiner von ihnen angepflaumt werden wollte, oder aber um die Schadenfreude darüber zu verbergen, dass es diesmal Henrik erwischt hatte. Der eine oder die andere unter dem Küchenpersonal war sicher nicht unglücklich darüber, dass soeben die Chancen gestiegen waren, den neugierigen alemão endlich loszuwerden. Welcher Art auch immer die Gefühle dieser Leute ihm gegenüber waren, sie beschäftigten sich auffällig hingebungsvoll mit ihren Aufgaben. Die scharfen Küchenmesser tanzten nur so über die Schneidebretter und hackten Knoblauch, Kräuter und Gemüse in irrwitzigem Tempo klein. Das Olivenöl zischte in den Pfannen, während die Zwiebelwürfel glasig wurden, die Hitze die Poren des Fleisches verschloss oder den Fisch auf den Punkt garte. Teller klapperten, Töpfe scharrten über den Gasflammen. Die Spülmaschinen pumpten und gurgelten. Ein Dutzend Frauen und Männer, Köche und Küchenhilfen, werkelten vor sich hin, als ginge es um ihr Leben, aber niemand blickte in seine Richtung. Henrik stand da, das Tablett schützend wie einen Schild vor die Brust gepresst. Sollte Robert ihn jetzt tatsächlich hinauswerfen, wäre der ganze Aufwand, den er die letzten Tage betrieben hatte, völlig umsonst gewesen. Und das war es, was ihn wirklich wurmte. Es ging ihm nicht um den Anschiss, den er von Robert kassieren würde. Den konnte er wegstecken. Nicht aber eine fristlose Entlassung. Noch nicht! Schließlich hatte er immer noch keine brauchbare Vermutung, wer von den Angestellten des Pôr do sol derjenige war, den er zu identifizieren versuchte. Nein, er konnte hier nicht weg. Nicht bevor er herausgefunden hatte, wer von diesen Leuten ein Mörder war.
MONTAG
Menu do dia
Feijoada com polvo
Bohneneintopf mit Oktopus
Espetadas
Rinderfiletspieße mit gebackenen Kartoffeln und Tomaten
Suspiros
Baisers mit Datteln und Feigen
1
»Man riecht es immer noch!«
Erschrocken fuhr Henrik herum und schrammte mit der Schulter am Regalbrett entlang. Bücher polterten zu Boden. Eines platschte in den Farbeimer zu seinen Füßen, und die Tünche schwappte über seine Sportschuhe.
»Merda!«, fluchte er, weil ihm beim Versuch auszuweichen auch noch der Malerpinsel aus der Hand rutschte. Weiße Farbe spritzte überallhin. Adriana stand im Mittelgang und lachte. Sie musste sich regelrecht angeschlichen haben, was nicht schwer war, da wegen der Malerarbeiten die Tür zum Antiquariat sperrangelweit offen stand. So konnte das Glockenspiel darüber keine Besuche ankündigen. Henrik blickte auf seine mit Farbe verschmierten Hände und liebäugelte kurz mit dem Gedanken, sie zur Strafe dafür, dass sie ihn erschreckt hatte, zu umarmen. Da würde ihr das freche Grinsen sicher sofort vergehen. Offenbar erahnte sie seine finsteren Absichten, denn sie hob abwehrend den dicken Aktenordner.
»Ich war gerade in der Gegend, da dachte ich, ich bringe dir ein paar alte Steuerunterlagen vorbei, die bei mir nur Platz wegnehmen. Platz, der ja jetzt in deinem Laden wieder zur Genüge vorhanden ist.«
Jetzt, da ein großer Teil des Inventars abgefackelt ist, dachte Henrik den Satz zu Ende. Leider war der Laden von dem Feuer betroffen und nicht das Büro, was wesentlich weniger schmerzhaft gewesen wäre. »Leg sie auf den Tresen«, bat er und blieb in der Farbpfütze stehen, weil er nicht noch mehr Flecken verursachen wollte. Er hätte sich nicht nur mit einer alten Zeitung als Unterlage für den Farbkübel begnügen, sondern großflächig Plastikplanen auslegen sollen, selbst wenn es nur ein paar Stellen waren, die er noch auszubessern hatte. Aber hinterher war man ja immer schlauer.
Vor mittlerweile über vierzig Jahren war Henriks Onkel Martin Falkner seiner Liebe nach Lissabon gefolgt und hatte damals in der Rua do Almada dieses Antiquariat erstanden. Samt dem Haus, in dem sich der Laden befand und in dem darüber noch Wohnungen waren, die Martin vermietete, bis auf die eine, die er selber bezog. Und dann, nach all der Zeit in Portugal, war ihm nichts Besseres eingefallen, als das Ganze seinem Neffen zu vererben – obwohl sie sich nie persönlich kennengelernt hatten. Henrik hatte sich dieser Sache also nur unter größten Vorbehalten genähert. Und das durchaus zu Recht, da sich bald nach Antritt seines Erbes herausstellte, dass mehr dahintersteckte als verstaubte Bücher und Antiquitäten. Viel mehr!
Seit dem Feuer vor drei Monaten, das ebenfalls diesem viel mehr zu verdanken war, war einiges passiert. Die meisten Schäden, die von den Flammen verursacht worden waren, wie die zerstörten Regale oder der angesengte Holzboden, waren repariert. Der Bestand an Büchern, Gemälden, Möbeln und sonstigem Inventar, das nicht mehr zu retten gewesen war, hatte er längst entsorgt. Dennoch musste er Adriana recht geben. Wenn man das Antiquariat betrat, stieg einem immer noch der typische beißende Geruch kalter Asche in die Nase, offene Ladentür hin oder her. Dieser eindringliche Gestank war wie eine Mahnung. Nicht alles konnte mit frischer Farbe überstrichen oder mit neuem Holz verkleidet werden. Wie sehr man sich auch bemühte, es blieb immer etwas zurück.
»Wie wäre es mit einem Kaffee?«, fragte Adriana, nachdem sie den Aktenordner neben die Kasse gelegt hatte.
Die schöne Adriana. Die Frau mit der erotischsten Unterlippe, die ihm je untergekommen war. Wie immer sah sie hinreißend aus, selbst in ihrem Businesslook, der wie fast immer aus einem marineblauen, eng taillierten Kostüm bestand, dessen Rock gerade so übers Knie reichte. Darunter trug sie die klassische weiße Bluse, und Henrik hielt es durchaus für Absicht, dass diese weit genug aufgeknöpft war, damit die Spitzen ihrer Unterwäsche gerade so zu erkennen waren. Zu diesem Outfit gehörte auch der strenge Knoten, in dem ihr Haar nach hinten gebunden war – Haar, aus dem neuerdings der rötliche Glanz von polierten Kastanien leuchtete. Die Frisur betonte ihre hohen Wangen und die Herzform ihres Gesichts. Doch egal, worin sie steckte und wie auch immer sie ihre Haare arrangierte, sie hatte stets dieselbe unwiderstehliche Wirkung auf ihn, und das wusste sie verdammt gut.
»Ich …« Er streckte die Arme von sich und sah an sich hinunter. Die Wandfarbe klebte nicht nur an seinen Händen. »So?«
»Handwerker finde ich irgendwie sexy«, meinte sie und lächelte provozierend.
Er unterdrückte einen Seufzer. »Adriana, was willst du eigentlich?«
»Ach, sei nicht gleich wieder eingeschnappt. Denkst du etwa immer noch, dass ich für den Feind arbeite?« Sie setzte das Wort Feind mit ihren Fingern in Anführungszeichen. »Glaubst du nach wie vor, dass ich dich bespitzle, so wie ich es angeblich schon bei deinem Onkel getan haben soll? Ernsthaft, denk mal darüber nach, wie dämlich sich das auf Dauer anhört! Als hätte ich nichts Besseres zu tun …«
Er war nicht überzeugt. Sie konnte ihre Unschuld noch so oft beteuern, er war nicht davon abzubringen, dass sie genau mit der Aufgabe betraut war, die sie so vehement leugnete. »Den Kaffee serviere ich dir ein anderes Mal, versprochen«, beschwichtigte er sie. »Ich muss das heute endlich fertig machen.« Er deutete auf die halb gestrichene Wand mit den hässlichen Flecken.
Sie lächelte, aber nun kam es ihm gezwungen vor. Sie konnte es überhaupt nicht leiden, wenn man ihr eine Abfuhr erteilte. »Ich nehme dich beim Wort«, erwiderte sie halb bissig, halb spöttisch. »Und vergiss nicht, meu coração, ich behalte dich im Auge!« Sie wandte sich ab, und er sah ihr nach, bis sie aus der Tür war.
Denkst du etwa immer noch, dass ich für den Feind arbeite?
Der Feind.
Er hob den Pinsel auf und warf ihn in den Farbeimer. Der Feind hat nun schon sehr lange Zeit stillgehalten. Eine Stille, die Henrik mit einem Mal recht trügerisch vorkam.Mit dem Kopf voller düsterer Gedanken stieg er hinauf in seine Wohnung, um sich zu waschen.
2
Er konnte Catia im Laden hören, und augenblicklich fiel ihm die Sauerei mit der Wandfarbe wieder ein, die er vorhin hinterlassen hatte. Leise schlich er um die Regale herum. Sie hockte auf den neu verlegten Holzbohlen und versuchte, die weiße Tünche wegzuschrubben.
»Du musst das nicht tun!«, sagte er harscher als beabsichtigt.
Sie drehte sich nicht nach ihm um, scheuerte einfach weiter mit dem Putzlumpen zwischen ihren knochigen Händen. »Es macht mir nichts aus«, erwiderte sie.
»Ich habe das Chaos verbrochen, ich beseitige es auch!«
Da endlich hörte sie auf. Sie ließ den Lumpen in der milchigen Brühe liegen und erhob sich, wobei sie das Regal zu ihrer Rechten zu Hilfe nahm. Langsam drehte sie sich zu ihm um. Ihr störrisches Haar steckte unter einem bunt gemusterten Seidentuch, doch eine Strähne war herausgerutscht und hing ihr ins Gesicht. Mit einer fahrigen Bewegung wischte sie die Haare mit dem Handrücken zur Seite und hinterließ dabei einen blassen Farbstreifen auf ihrer Stirn. Schweiß glänzte auf ihrem schmalen Nasenrücken. Nach wie vor wirkte sie ausgezehrt und zerbrechlich. Obwohl sie nun schon seit einem Vierteljahr wieder für ihn im Antiquariat arbeitete, hatte sich ihre Verfassung nicht gebessert. Sie war psychisch angeschlagen, und das spiegelte sich auch in ihrer Körperhaltung wider. Er wusste nicht mehr, was er noch für sie tun konnte, wie er mit ihr umgehen sollte. Freundlichkeit und Nachsicht halfen genauso wenig wie Distanziertheit. Mehrfach hatte er ihr versichert, dass es vorbei und die Zeit der Unruhe und Kämpfe ausgestanden war. Dass man sie nun in Frieden lassen würde. Doch sie hielt nichts von seinen Beteuerungen. Was vermutlich in erster Linie daran lag, dass er es selbst nicht glaubte. Es waren leere Phrasen, um sie zu besänftigen, und auf die fiel sie nicht herein.
»Gut, dann sortiere ich Bücher«, gab sie trotzig zurück.
Er sah auf die Uhr an seinem Handgelenk, dann zu Boden. »Das reicht auch morgen, du kannst für heute Schluss machen!« Er versuchte milde zu klingen, doch Catia stand vor ihm, als wäre sie festgewachsen. Schließlich war er es, der sich abwandte und um den Tresen herum ins Büro ging. In die Abstellkammer, die ein schwerer Brokatvorhang vom Verkaufsraum trennte. Vor dem Schreibtisch blieb er stehen und horchte. Irgendwann vernahm er ihre leisen Schritte und wenige Sekunden darauf das Knarzen der Holztreppe, über die sie hinauf in ihre Wohnung unterm Dach stieg. Dort oben hatte er ihr zwei Zimmer überlassen, weil derjenige, der sie einst bewohnt hatte, nicht wieder aufgetaucht war. Henrik wusste, dass sie dort oben ausharren würde bis zum nächsten Tag – oder besser gesagt bis zu dem Moment, da er ihr wieder gestattete, im Antiquariat ihre Arbeit zu verrichten. Er wusste, dass die Musiker, die eine Etage tiefer wohnten, für sie einkauften, weil Catia das Haus nicht verließ. Sie wollte nicht oder konnte nicht. Vermutlich eher Letzteres. Ihre seelische Verfassung schien es einfach nicht zu erlauben. Auch darüber hatte er versucht mit ihr zu reden, nur um festzustellen, dass er nicht gut darin war. Er taugte nicht als Therapeut. Jeder Ansatz eines Gesprächs, das er in diese Richtung hatte führen wollen, versandete, ehe es wirklich in Gang kam. Sie brauchte professionelle Hilfe, daran hatte er keinen Zweifel, denn ihr Zustand war besorgniserregend. Und dabei hatte er ihr das Schlimmste noch gar nicht offenbart. Seit einem Vierteljahr kannte er die Wahrheit über den Verbleib ihres Sohnes Flávio, dem man ihr kurz nach der Geburt weggenommen hatte. Wie sollte er ihr jemals über dessen Schicksal berichten, ohne dass sie völlig daran zerbrach?
Überrascht stellte er fest, dass er den Aktenordner, den ihm Adriana vorhin auf die Verkaufstheke gelegt hatte, in den Händen hielt. Er hatte ihn mit ins Büro genommen, ohne es zu bemerken. Statt ihn zu den anderen Steuerunterlagen der letzten fünfzehn Jahre ins Regal zu stellen, setzte er sich damit an den Schreibtisch. Es hatte bislang keinen Anlass gegeben, an Adrianas Arbeit zu zweifeln. Nicht wenn es um fiskalische Aspekte ging. Da vertraute er ihr tatsächlich ohne großes Nachdenken. Das Finanzamt stellte seine Forderungen, die er noch immer pünktlich hatte leisten können und auf denen stets die Beträge ausgewiesen waren, die ihm Adriana vorweg genannt hatte. Keine Beanstandungen also, weder vom Finanzamt noch von ihm. Hier war diese Frau ein Profi, genau wie bei der anderen Sache. Eigentlich öffnete er den Ordner also nur, um ihn oberflächlich durchzublättern. Mehr um sich abzulenken als aus echtem Interesse. Die ersten Seiten umfassten maschinell erzeugte Schreiben des Finanzamts, von denen er mit seinen Portugiesischkenntnissen nur wenig verstand. Lediglich die Zahlentabellen sah er sich genauer an. Jene Summen, die von dem Geschäftskonto abgingen und von Geldern ausgeglichen wurden, die nicht in erster Linie von den Einnahmen aus den Verkäufen im Antiquariat oder den Mietentgelten seiner Mitbewohner stammten. Den größten Teil seiner Ausgaben deckte nämlich ein Fonds, den Martins ehemaliger Lebensgefährte, der Kunstmaler João de Castro, eingerichtet hatte. Eine lange Geschichte. Lang und traurig – denn beide waren längst tot. João ebenso wie Henriks Onkel.
Henrik versuchte auch diesen Gedanken sogleich wieder loszuwerden. Er hatte sich vorgenommen, nach vorne zu schauen. Die Probleme der nahen Zukunft anzupacken und die Vergangenheit ruhen zu lassen. Zumindest für eine Weile. Doch beides gestaltete sich gleichermaßen schwierig.
Das Antiquariat warf kaum etwas ab, und momentan befand Henrik sich ohnehin auf einer Durststrecke, bedingt durch die Renovierung des Hauses, die immer noch anhielt. Die Handwerker hatten keine Eile – sofern man überhaupt welche bekam. Der durch den portugiesischen Wirtschaftsaufschwung erfolgte Bauboom in der Stadt machte es manchmal unmöglich, Leute zu finden, die Böden verlegten oder Schreinerarbeiten verrichteten. Hinzu kam, dass die hohe Nachfrage die Preise nach oben trieb. Das Darlehen, das Henriks Mutter ihm für die Bauarbeiten am Haus in der Rua do Almada zur Verfügung gestellt hatte, schmolz schneller dahin als erwartet. Schließlich handelte es sich nicht mehr nur um die Schäden, die ein leckes Wasserrohr im Gemäuer des zweihundert Jahre alten Hauses verursacht hatte. Nicht allein um die durch Taubenkot und Abgase entstandenen Emissionsschäden an der Fassade. Oder um das marode Dachgebälk. Nein, da war auch noch das Feuer vor drei Monaten, das einen Teil des Ladens gefressen hatte. Ein mutwillig gelegter Brand, der Spuren vernichten sollte – und gleichzeitig neue Wahrheiten zutage gefördert hatte …
Alles hängt irgendwie zusammen! Ja, diese Einsicht quälte ihn schon, seit er sein Erbe in Lissabon angetreten hatte.Doch auch diese Dämonen wollte er ruhen lassen, bis er sich ausreichend erholt hatte. Oder bis sich neue Erkenntnisse einstellten, die ein weiteres Handeln unumgänglich machten. Besonders, was diese eine Sache anging. Kaum regte sich dieser Gedanke in seinem Kopf, fühlte er wie immer tiefe Betroffenheit. Nicht alle seine privaten Ermittlungen konnte er wirklich ruhen lassen. Wenn er sich in seiner Phase der Rekonvaleszenz auf etwas konzentrieren wollte, dann darauf, endlich Licht in das rätselhafte Ende seines Freundes Bruno zu bringen.
Der Geistliche – ein Priester der Kirchengemeinde São Vicente de Fora – war vor rund drei Monaten tödlich verunglückt. Mit dem Fahrrad. Diese Todesursache stellte für Henrik eine schmerzhafte Parallele zum Tod seiner Ehefrau Nina dar, die auf ihrem Fahrrad von einem unter Drogen stehenden Mann überfahren worden war. Nun gab es also noch jemanden, der ihm nahegestanden und den er auf tragische Weise verloren hatte. Und zwar durch die Schuld eines anderen. Jedenfalls glaubte er das, obwohl er damit bislang alleine auf weiter Flur stand.
Ja, es lag noch einiges im Argen in der Stadt am Tejo, was es umso schwerer machte, sich positiv auf die Zukunft auszurichten. Vor allem, weil sein Erscheinen in Lissabon immer wieder Auslöser für Ereignisse gewesen war, die eine Gefahr für Leib und Leben mit sich brachten – nicht nur für ihn selbst, sondern bedauerlicherweise auch für einige andere Leute. Pater Bruno mit seinem fragwürdigen Unfall zählte definitiv dazu. Und es waren in den vergangenen Jahren auch noch andere Verbrechen verübt worden, die bis heute nicht gesühnt waren. Allen voran der Tod seines Onkels. Auch dessen Mörder, der sich weiß der Teufel wo verkrochen hatte, war weiterhin auf freiem Fuß. Das Gleiche galt natürlich für den Auftraggeber des Mordes. Noch eine offene Rechnung, die es irgendwann zu begleichen galt.
Und dann war da leider Gottes noch Rafael de Bragança. Ebenfalls ein Mörder, nicht verurteilt, ja nicht einmal angeklagt. Die Beweise, dass der Adelige einst Martins Lebensgefährten João de Castro umgebracht hatte, wurden von Henrik sicher verwahrt. Auch in diesem Fall wartete er auf eine Gelegenheit, das Material der Polizei zu übergeben. Eine nervenaufreibende Lage, in der er da steckte, und das bei seinem nicht gerade geduldigen Temperament. Doch da hatte sich etwas verändert in den letzten Wochen, ohne dass er dafür eine echte Erklärung fand. Er hoffte nur, dass es ihm gelang, sich diesen indifferenten Zustand zu bewahren, ohne irgendwann zu explodieren.
Doch im Moment schien jegliche Konfrontation wie auf Eis gelegt, und auch wenn es Henrik einerseits ein Gräuel war, dass dieser Mensch trotz seiner Verbrechen immer noch alle Freiheiten besaß, war er doch andererseits froh über die Verschnaufpause, die ihm gerade gegönnt war. Vielleicht hatte de Bragança sich in seinem Palast in den Sintra-Bergen verkrochen oder irgendwo auf einer Insel in der Karibik. Henrik wusste es nicht. Er wusste nur, dass er keine Sekunde unaufmerksam sein durfte, solange der Dämon, wie ihn sein Onkel genannt hatte, irgendwo dort draußen lauerte. Es war ebenso unmöglich, seinem Einfluss zu entkommen, wie ihn selbst zu fassen zu kriegen. So viel stand fest. Doch irgendwann in unbestimmter Zukunft würde Henrik sich damit befassen müssen, damit er wirklich ungetrübt nach vorn blicken konnte.
Und bis es so weit war, musste er sich zusammenreißen und durfte sich nicht von Wut und Verzweiflung treiben lassen. Schau nach vorne! Eine Parole, die er sich momentan ständig auferlegte, ganz so, wie es ihm seine Mitmenschen in Lissabon vormachten. Einen Schritt nach dem anderen. Von einem Tag auf den nächsten. Sich nicht von vornherein damit verrückt machen, was der neue Tag brachte, oder gar die neue Woche, der neue Monat. Lebe im Jetzt, dann lebst du besser!
Seine blätternden Finger waren mittlerweile bei den Rechnungen angelangt, die Martin für das Steuerjahr 2015 eingereicht hatte. Die üblichen Firmen, Lieferanten und Abgaben, nichts, was er nicht schon einmal gesehen hatte.
Plötzlich hielt er inne und blätterte drei Seiten zurück.
Pôr do sol? Schon wieder?
Henrik wischte nochmals ein paar Blätter zurück, dann wieder weiter nach vorne. Verglich die Datumsangaben. Öffnete schließlich den Bügel, um die abgehefteten Quittungen herauszunehmen und in einer Reihe vor sich auf den Schreibtisch zu legen. Fünfmal innerhalb von drei Wochen hatte Martin zwischen Mai und Juni 2015 in einem Restaurant namens Pôr do sol gegessen. Zweimal mittags, dreimal abends, offenbar immer allein. Keine Geschäftsessen also, weshalb Henrik sich fragte, warum er die Bewirtungsbelege überhaupt eingereicht hatte. Abgesehen davon, dass es Adriana vermutlich trotzdem geschafft hatte, dass ihm die Mehrwertsteuerbeträge angerechnet worden waren, kamen ihm diese Restaurantrechnungen einigermaßen seltsam vor. Unwillkürlich spürte er ein bedeutungsvolles Kribbeln unterm Zwerchfell. Verdammt! Er hatte doch eigentlich genug andere ungeklärte Dinge am Hut.
Henrik meinte, von dieser Lokalität schon gehört zu haben, die sich oben am Schlossberg befand und seine Gäste neben dem kulinarischen Angebot vor allem mit einer traumhaften Aussicht über das Alfama-Viertel, den Hafen und den Sund der Tejo-Mündung verwöhnte. In erster Linie ein Touristenlokal, gehobene Preisklasse, wie er zu wissen glaubte. Kein Etablissement, das wirklich zu Martin gepasst hatte. Von einer plötzlichen unterschwelligen Erregung gepackt, überprüfte er die restlichen Belege aus dem Steuerordner und dann auch diejenigen aus dem Vorjahr – ohne jedoch noch mal auf eine Quittung aus dem Pôr do sol zu stoßen. Wie es aussah, war es bei diesen fünf Besuchen aus dem Jahr 2015 geblieben. Vielleicht sollte er einfach Adriana anrufen, um sie zu bitten, auch die Unterlagen von 2016 für ihn durchzusehen. Nein, besser nicht, entschied er nach kurzer Überlegung. Sie würde Fragen stellen, und das wollte er unbedingt vermeiden. Was hätte er ihr auch antworten können? Alles, was er hatte, waren eine Handvoll Belege von einem exklusiven Restaurant in der Costa do Castelo – und ein Bauchgefühl.
3
Der November war erst wenige Tage alt und fühlte sich immer noch an wie ein sonniger Oktober. Dieses Jahr war ungewöhnlich heiß und viel zu trocken gewesen. Die Leute klagten. Besonders weil das warme Wetter und die damit verbundene Wasserknappheit weiter anhielten. Ein Drama für die Landwirtschaft, nicht nur in Portugal, wie er wusste. Dennoch war hier keine Klimahysterie zu spüren, wie er es von Fernsehbildern aus Deutschland her kannte. Noch ein guter Grund, um in Lissabon zu bleiben, wo in der Regel alles im erträglichen Rahmen der Normalität ablief.
Über der Stadt strahlte auch heute ein endlos blauer Himmel. Das Thermometer war zum Nachmittag hin wieder bis an die Zwanzig-Grad-Marke geklettert. Nur in den Windböen, die vom Atlantik her den Fluss heraufbliesen, konnte man eine Spur der Kühle erahnen, die einen vor der Tür stehenden Winter ankündigte. Die Lisboetas waren auf den zu erwartenden Wetterumschwung schon länger vorbereitet oder sehnten ihn womöglich auch herbei. Bereits Anfang Oktober hatten die Ersten ihre Wintermäntel und dicken Jacken aus den Schränken geholt, während die Touristen noch in kurzen Hosen und T-Shirts herumflanierten. Tradition oder übersensibles Kälteempfinden? Wie auch immer, bisweilen sorgte der Anblick von Leuten, die so demonstrativ eingebildeten Minusgraden trotzten, für einige Irritation.
Außer dem nach wie vor prächtigen Wetter genoss Henrik auch die Vorzüge der Nebensaison. Zumindest unter der Woche waren die Straßen seit etwa einem halben Monat deutlich leerer, da im Hafen unter anderem weniger Kreuzfahrtschiffe anlegten. Das konnte man nur als angenehm empfinden – vorausgesetzt, man war kein Händler und vom Geschäft mit den Touristen abhängig. Wozu Henrik sich keineswegs zählte. Diese Hoffnung hatte er schon früh nach der Übernahme des Antiquariats aufgegeben. An Tagen wie heute fand er es jedenfalls herrlich, über das sahneweiße Pflaster des schachbrettartig angelegten Baixa-Viertels zu schlendern und dabei nicht ständig ins Gedränge zu geraten oder Leuten ausweichen zu müssen, die ihre Umwelt ausschließlich durch Handykameras wahrnahmen.
Allein das schlechte Gewissen darüber, dass er eigentlich Besseres zu tun hätte, als hier durch die Straßen und Gassen zu spazieren, trübte seine Stimmung. Henrik wäre nicht Henrik gewesen, wenn er nach den dramatischen Vorfällen und dem Verlust von Pater Bruno nicht mit dem Gedanken gespielt hätte, Lissabon zu verlassen. Denn wenn er eins nicht wollte, dann eine Marionette von de Bragança zu sein, so wie es sogar sein Onkel auf gewisse Weise all die Jahre gewesen war.
Lissabon verlassen …
Ein schmerzlicher Gedanke, aber letztlich immer eine Option, die er nie völlig aus seinem Kopf verbannte. Ein Lebensplan B, wenn man so wollte. Jetzt, da das Haus in der Rua do Almada weitgehend renoviert war, wäre es ein Leichtes gewesen, es gut zu verkaufen. Er war sicher, er würde Gewinn machen und seiner Mutter das geliehene Geld unverzüglich zurückzahlen können. Diesen Schritt hätte er freilich auch unternehmen können, direkt nachdem er von dem Erbe erfahren hatte. Vieles wäre ihm erspart geblieben, hätte er das Antiquariat sofort aufgelöst. Dessen Geheimnisse, die so viel Unheil und Schrecken bargen, wären damit unwiederbringlich ausgelöscht worden. Ja, das hätte er tun können. Doch er hatte damals recht schnell gemerkt, dass er nicht loslassen konnte. Und dieses Gefühl überwog auch weiterhin alle anderen. Er wollte nicht loslassen, weder das Antiquariat noch Lissabon. Und schon gar nicht Helena.
Während ihn all diese Dinge beschäftigten, fanden seine Füße den Weg hinauf in die Costa do Castelo. Eine Straße, die er gut kannte, denn gleich sein allererster Fall in Lissabon hatte ihn hierhergeführt. Auch wenn diese traurige und grausame Geschichte erst eineinhalb Jahre zurücklag, kam es ihm wie eine Ewigkeit vor.
An dem Straßenzug, der unterhalb der massiv und hoch aufragenden Burgmauern des Castelo de São Jorge lag, hatte sich indes nichts verändert. Weil der Schlossberg mit seiner imposanten, im 12. Jahrhundert von den Mauren erbauten Anlage jährlich Hunderttausende von Touristen anzog, tat man viel dafür, diesen Teil der Stadt von seiner besten Seite zu präsentieren. Kaum eines der Gebäude, die sich hier aneinanderreihten, war nicht erst kürzlich renoviert oder komplett neu wiederaufgebaut worden. Auch das Restaurant Pôr do sol hatte einen frischen Anstrich in jenem traditionellen Ockerton, der neuerdings eine Renaissance erfuhr und immer häufiger Verwendung fand. Der Eingang wirkte ziemlich unscheinbar, wie auch das Schild darüber. Darüber hinaus sah der Betreiber offenbar keinen Anlass, eine Speisekarte neben die Tür zu hängen. Dafür prangte dort eine Reihe von Auszeichnungen diverser Restaurant- und Reiseführer. Da man von außen nicht sehen konnte, was den Gast drinnen erwartete, wies ein weiteres Schild auf die herrliche Aussicht und das Versprechen hin, diese nicht nur von der Terrasse, sondern auch von den Plätzen im Innenbereich genießen zu können. Was hatte Martin bloß dazu bewegt, dieses Lokal vor fünf Jahren näher unter die Lupe zu nehmen?
Henrik schaute sich um. Die Straße war verwaist. Oben auf dem Platz vor dem großen ehrwürdigen Torbogen, durch den man in die Burg gelangte, herrschte zwar der übliche Trubel, doch je mehr sich die Gassen den Berg hinab verzweigten, um so dünner wurde der Strom der Passanten. Er war unschlüssig, ob er hineingehen sollte. Ganz allein. Außerdem war es viel zu früh. Höchstens kurz nach fünf Uhr, wenn er nach dem Sonnenstand und dem weichen Licht ging, das die Gasse flutete und der Stadt eine goldene Unschuld verlieh, die sie nicht besaß.
Das Lokal hatte durchgehend geöffnet, aber um diese Zeit würde er allenfalls Gäste aus Deutschland, den Niederlanden oder Skandinavien antreffen. Vielleicht noch ein paar Engländer und Iren.
Auf der anderen Straßenseite saß eine ältere Dame auf einem Klappstuhl vor einem Souvenirgeschäft. Das Schaufenster bot das übliche Sammelsurium an Fliesen mit Straßenbahnmotiven, portugiesischen Gockeln in allen Größen, Sardinen aus Stoff zum Aufhängen oder echt und in Blechdosen konserviert, dazu T-Shirts, Tücher, Taschen und Sandalen. Die Frau erwiderte seinen Blick. Es lag eine gewisse Skepsis in ihren Zügen.
»Ist es wirklich so gut, wie man immer hört?«, fragte er und ging zu ihr über die Straße.
Die Senhora, die sich trotz der immer noch milden Temperatur in eine Strickjacke gehüllt hatte und vermutlich schon jenseits der siebzig war, machte keine Anstalten, sich zu erheben. Offensichtlich hatte sie sofort erkannt, dass er nichts bei ihr im Laden kaufen würde, weshalb es sich für sie nicht lohnte, den bequemen Platz aufzugeben.
»Es ist die Aussicht. Da ist dann das Essen weniger wichtig«, erklärte sie.
»Das klingt ja nicht allzu berauschend.«
»Sehen Sie mich nicht so an, glauben Sie etwa, ich kann es mir leisten, dort zu essen? Ich gebe nur weiter, was die Leute so reden. Aber ich will Sie nicht aufhalten, also nur zu!« Sie wedelte mit der Hand hinüber zum Eingang des Pôr do sol.
Henrik musste lächeln. »Sie haben mich nicht überzeugt, außerdem esse ich lieber traditionell.«
Die Alte nickte. »Da tun Sie auch gut daran. Haben Sie eine Zigarette?«
Leider musste er passen und schüttelte den Kopf. Für ein paar Sekunden tat er so, als interessierte er sich für ihre Auslage.
»Kennen Sie den Besitzer?«, fragte er dann möglichst unverfänglich, ohne sie anzusehen.
»Früher kannte ich jeden, der hier in der Ecke einen Laden oder ein Lokal führte, aber heute … ständig neue Gesichter, neue Inhaber. Es ist ein Graus, wozu diese Stadt verkommt. Fragen Sie die Leute hier im Viertel, wie viele es sich noch wirklich erlauben können, hier zu leben, seit ausländische Investoren alles aufkaufen. Es ist eine Schande, gerade für uns ältere Leute. Wir werden regelrecht vertrieben aus Häusern, in denen wir unser ganzes Leben verbracht haben.«
Henrik schenkte ihr einen mitfühlenden Blick. Er kannte die Thematik. Egal ob bei ihm drüben im Bairro Alto oder hier im Alfama: Wer sein Appartement über Airbnb an Urlauber vermietete, konnte ein Vielfaches von dem verdienen, was er über normale Mieteinkünfte erzielte. Dieser Verlockung war nur schwer zu widerstehen, und so versuchten viele Immobilienbesitzer diejenigen loszuwerden, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten in ihren Häusern wohnten.
»Es wird immer schlimmer«, schimpfte die Frau – ungeachtet der Tatsache, dass sie selbst von den Touristen lebte – und empfahl ihm dann entschieden: »Gehen Sie lieber woanders essen!« Sie hatte sich unüberhörbar in Rage geredet. »Was hier serviert wird, bekommt nicht jedem.«
»Jetzt machen Sie mich aber neugierig«, erwiderte Henrik.
Sie winkte ab und fing an, an den Knöpfen ihrer Strickjacke herumzunesteln. »Na ja, es ist natürlich schon eine Weile her«, murmelte sie schließlich.
Henrik sagte nichts, signalisierte lediglich durch ein leichtes Nicken, dass er bereit war, weiter zuzuhören.
»Es gibt da so ein Gerücht.« Sie schielte zu ihm hoch, als wollte sie prüfen, ob sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte.
»Ein Gerücht?«, wiederholte er leise.
»Wie gesagt, das liegt schon eine ganze Weile zurück, damals gehörte das Restaurant noch jemand anderem … Na, jedenfalls erzählen sich die Leute aus der Nachbarschaft, dass eine Frau, die dort gegessen hat, kurz darauf gestorben ist.«
4
Diese Information machte es Henrik unmöglich, dem Pôr do sol keinen Besuch abzustatten. Durch einen lang gezogenen Gang gelangte er direkt auf die Terrasse und begriff augenblicklich, was mit der fantastischen Aussicht über die Stadt gemeint war, von der auf den Bewertungsportalen im Internet zu lesen war. Im Moment wurde das imposante Panorama durch den sich mit intensiven Rottönen ankündigenden Sonnenuntergang jenseits der Brücke des 25. April noch verstärkt und bot ein romantisches Postkartenmotiv, das schon fast kitschig anmutete. Eine Inszenierung, die einen buchstäblich bannte. Weit im Westen konnte man den Atlantik erahnen, der die Sonne in verschwenderischem Farbenspiel bald zur Gänze in sich aufnehmen würde und dessen salzigen Atem man förmlich riechen konnte. Ein Pult hielt Henrik davon ab, direkt an die Brüstung zu treten, um dem grandiosen Schauspiel noch ein paar Schritte näher zu sein. Das Schild davor bat darum, hier zu warten, bis man in Empfang genommen wurde. Großflächige Glaswände erlaubten wie versprochen auch jenen, die drinnen einen Platz gewählt hatten, den Blick über den Fluss zu genießen. Auf der Terrasse selbst waren lediglich zwei Tische besetzt, denn tatsächlich war es mittlerweile zu kühl, um noch draußen zu essen. Soweit Henrik es durch die Fenster beurteilen konnte, war es im Restaurant deutlich voller. Vermutlich wussten die Leute, was man verpasste, wenn man um diese Jahreszeit zu spät für den Sonnenuntergang dran war. Immerhin blieb einem in jedem Fall das Lichtermeer der Stadt entlang des Tejos und von jenseits des Flusses als Entschädigung. Und natürlich die kulinarischen Verführungen. Obwohl ihm bei dem Gedanken an die Speisekarte im Aushang der Magen knurrte, hatte Henrik nicht wirklich vor, hier zu essen. Genau genommen verfügte er über gar keinen Plan, wie er seine Anwesenheit erklären wollte. Die Bewirtungsbelege in Martins Unterlagen hatten ihn hergelockt, und die rätselhafte Andeutung der Händlerin hatte seine Absichten verstärkt, sich hier einmal umzusehen. Mehr war da bislang eigentlich nicht, doch gerade dieses Fehlen weiterer Informationen fühlte sich ziemlich intensiv an. Nun, welche Erklärung hatte er, sobald man von ihm wissen wollte, warum er hier am Empfang stand? Er konnte sich wohl kaum danach erkundigen, ob man sich an einen älteren Herrn erinnerte, der hier vor fünf Jahren ein paarmal gegessen hatte. Ebenso unklug wäre es, sich nach einem Todesfall zu erkundigen, den es in Zusammenhang mit dem Restaurant einmal gegeben haben sollte.
»Kommst du wegen des Jobs?«
Verdutzt wandte er sich der jungen Frau zu, die ihn angesprochen hatte – und reagierte zu seiner eigenen Überraschung geistesgegenwärtig. »Sim, sim! Ja, der Job, deshalb bin ich hier!«
Ihre lange, fast bis zum Boden reichende Schürze in Bordeauxrot, die sie eng um die schmalen Hüften gebunden hatte, und die schwarze Bluse, die sie trug, verrieten, dass sie zum Servicepersonal gehörte. Ihr brünettes Haar reichte ihr bis zum spitzen Kinn und war rundherum in der gleichen Länge geschnitten. Sie musterte ihn aus dunklen Augen und legte den Kopf leicht schräg. »Du bist kein Portugiese«, stellte sie fest, kaum dass er den Mund aufgemacht hatte.
»Ist das ein Problem?«, fragte er zurück.
Sie zuckte mit den Schultern. »Muss der Chef entscheiden«, erklärte sie und bedeutete ihm, ihr zu folgen.
Er trottete ihr nach, an der aufgemauerten Theke und der automatischen Schiebetür vorbei, die in die Küche führte und weiter in den Gang, über den man zu den Toiletten gelangte. Am Ende des Korridors gab es weitere Türen, auf denen Schilder darauf aufmerksam machten, dass nur Personal Zutritt hatte. Sie öffnete eine davon, ohne anzuklopfen, und ließ ihm dann den Vortritt. Zusammen mit der Kellnerin fand sich Henrik nun in einem Raum mit hoher Decke und Oberlicht wieder, der halb Lager, halb Büro zu sein schien. Beinahe wie zu Hause in der Rua do Almada, nur mit deutlich mehr Platz. Im vorderen Bereich reihten sich vier mächtige, deckenhohe Stahlregale, vollgepackt mit haltbaren Lebensmitteln und Kram, der wohl für die Dekoration der Tische und des Restaurants Verwendung fand. Ein brusthoher, mit Spirituosen jeglicher Art gefüllter Raumteiler trennte das eigentliche Lager vom Büro weiter hinten. Der billige Schreibtisch aus Pressspan dort war ebenfalls von Regalen umgeben, die hauptsächlich Aktenordner enthielten. Trotz des ganzen Durcheinanders konnte man den massiven, schwarz lackierten Safe, der in der linken Ecke an die Wand gerückt war, nicht übersehen. Ebenso wenig wie den gedrungenen Mann, der zwischen den Lebensmittelregalen stand, ein Klemmbrett in den großen Händen. Er inspizierte offenbar den Lagerbestand. Das grelle Neonlicht spiegelte sich auf dem kahlen Schädel.
»Was?«, zischte er, ohne in ihre Richtung zu schauen.
»Der Neue«, verkündete die Bedienung, hauchte Henrik dann ein sehr leises »Viel Erfolg!« zu und lächelte kurz, bevor sie sich eilig zurück in den Gang verdrückte. Hinter ihr fiel die Tür ins Schloss, und der Lärmpegel aus der Küche verstummte abrupt.
Der Chef des Hauses trug Schwarz. Statt in der Schürze fand sich bei ihm der dunkle Rotton der Hausfarbe in der Krawatte wieder, die er um seinen kaum vorhandenen Hals geschlungen hatte. Er war nicht sonderlich groß, besaß aber die Kompaktheit eines Kampfstiers. Seine Präsenz füllte den Raum. In den Gesichtszügen lag unterschwellige Wut, als hätte man ihn gerade für das Duell mit einem Torero angestachelt und ihn in die Arena getrieben.
»Mein Name ist Falkner!«, stellte Henrik sich vor und bekam damit endlich die Aufmerksamkeit des grobschlächtigen Mannes, der sich von den Paketen mit Nudeln und Bohnen ab- und sehr langsam ihm zuwandte. »’enrik?« Der Mann wippte einmal über Fersen und Ballen und kam dann mit wiegendem Schritt auf ihn zu.
Henrik war sofort versucht zurückzuweichen und konnte sich nur mit Mühe davon abhalten. Der Restaurantchef trat unverhältnismäßig nah an ihn heran, fast als wollte er ihn beschnüffeln. Vermutlich tat er das sogar, ging Henrik im nächsten Moment durch den Kopf. Die Nase des Mannes war breit, wie platt gedrückt, und erinnerte an den lädierten Zinken eines Boxers. Außerdem wirfst du gelegentlich was ein, dachte Henrik bei sich, nicht allein der rot geränderten Augen wegen.
»Wo’er?«
»Deutschland«, klärte Henrik ihn auf, denn seine Herkunft war auf kurz oder lang ohnehin nicht zu verbergen.
»Und dein Portugiesisch?«
»Ich komm zurecht.«
Für einige lauernde Sekunden herrschte Stille, dann entspannte sich das Gesicht seines Gegenübers, und er lachte laut auf. »Isch bin Robert!«, stellte er klar, mit einem französischen Akzent, der so klischeehaft klang, dass man ihn kaum für echt halten konnte. »Du ’ast Erfahrung in der Gastronomie, ’enrik?«
Hatte er nicht, doch er nickte tapfer. Er konnte Robert ansehen, dass dieser ihn durchschaute – und doch sein Flunkern bereitwillig hinnahm, was die Situation noch widersinniger machte. Ihm wurde klar, er war gerade dabei, sich in eine ziemlich verrückte Geschichte hineinzumanövrieren. Offensichtlich hatte sich heute jemand im Pôr do sol als Kellner vorstellen wollen. Vielleicht war diese Person einfach nur unpünktlich gewesen, vielleicht hatte sie es sich anders überlegt. Was immer sich auch zugetragen hatte oder noch passieren würde, Henrik war gerade im Begriff, den Platz des Unbekannten auf dreiste Weise einzunehmen, ohne irgendeine Ahnung, was hier für eine Arbeit auf ihn wartete. Und der Restaurantchef spielte bereitwillig mit. In der Tat wirkte er, als hätte er sogar Spaß an diesem Husarenstück.
»Wo ’ast du schon überall gekellnert?«
»Drüben im Bairro Alto, im Tasco do Chico und im Do Manel.« In beiden Lokalen war er vor Kurzem tatsächlich essen gewesen. »Und im Esquina«, fügte er schnell noch an.
Robert nickte. »Ah, bei Victor.«
Mist, er kennt Victor! Wie leicht musste es für den Restaurantchef sein, diese Angaben zu überprüfen. Und Henrik konnte kaum davon ausgehen, dass sein Nachbar und Barbetreiber Victor ihm den Gefallen tat, seine spontan zusammengedichtete Legende zu bestätigen. Nicht nach allem, was zwischen ihnen vorgefallen war. Er hoffte, ihm stand der Ärger über seine leichtfertige Behauptung nicht allzu auffällig ins Gesicht geschrieben. Doch nun konnte er nicht mehr zurückrudern.
Robert schob sein Boxerkinn vor. »Isch soll also einen alemão einstellen?«, fragte er, mehr an sich selbst gewandt und mit überzogener Theatralik. »Aber klar, wir ’aben ’ier viele deutsche Urlauber, viele Kreuzfahrtouristen …«
»Da kann das von Vorteil sein«, bestätigte Henrik.
Auffallend laut trommelte Robert mit den Fingern auf dem Klemmbrett herum. »Isch will ehrlisch sein, ’enrik, isch bin skeptisch, das gebe isch offen zu. Das Gastgewerbe ist das ’ärteste Business über’aupt, wir können uns zu keiner Zeit einen Fehler leisten. Niemals! Andererseits sind wir gerade außer’alb der ’auptsaison, was eine gute Zeit ist, jemanden zur Probe arbeiten zu lassen. Du kriegst den Job als Kellner, allerdings für den Lohn eines Spülers, bis du dich bewährt ’ast. Kannst du damit leben?«
»Probezeit, wunderbar«, sagte Henrik. »Wann fange ich an?«
»Gleisch, alemão, gleisch!«
5
Die digitale Anzeige am Metroabgang auf dem Largo do Chiado zeigte an, dass es beinahe drei Uhr war. Ausgelaugt und müde, wie er sich fühlte, hatte sich sein Denken auf die Befürchtung reduziert, dass er nie wieder aus seinen Schuhen herauskommen würde. Seine Füße brachten ihn um. Es wäre besser gewesen, ein Taxi zu nehmen, aber er musste das Geld zusammenhalten, momentan noch mehr als sonst. Auch wenn er jetzt einen neuen Job hatte. Doch der Lohn eines Spülers war ein Witz, der bar auf die Hand ausbezahlt wurde. Ohne Quittung – ein Armutszeugnis für die Branche oder vielleicht auch nur für die Unternehmensphilosophie des Pôr do sol. Was sagten diese kläglichen paar Kröten über die Anerkennung und Wertschätzung aus, die Robert seinen Mitarbeitern entgegenbrachte? Henrik konnte es immer noch nicht fassen, für wie wenig Geld Menschen bereit waren, ihre Zeit und Energie zu verkaufen.
Nachdem er vor einer halben Stunde seine neue Arbeitsstelle verlassen hatte, war ihm anfangs der Fußmarsch bis hinüber ins Bairro Alto noch wie eine gute Idee vorgekommen, auch wenn seine Beine vom vielen Hin- und Herlaufen schmerzten. Aber als er aus dem Restaurant hinaus auf die Straße getreten war, hatte die Stadt mitten in der Nacht so wunderbar still gewirkt. Und es war vor allem diese Stille, die er nach diesen langen, arbeitsreichen Stunden im Pôr do sol genießen wollte. Zusätzlich zu der klaren, kühlen Luft, die sich herrlich anfühlte in seiner Lunge und vor allem in seinem Kopf. Jedenfalls auf den ersten einhundert Metern. Dann gewann der drückende Schmerz in seinen Schuhen die Oberhand über den versöhnlichen Atem der Stadt, und Henrik fühlte sich plötzlich unangenehm ernüchtert. Wie hatte er nur auf diese Schnapsidee kommen können, als Aushilfskellner anzuheuern?
Auch wenn Robert von Nebensaison gesprochen hatte, war das Restaurant bis vor einer guten Stunde beinahe durchgängig ausgebucht gewesen; kein Tisch war unbesetzt geblieben. Was mochte sich dort wohl erst während der Hauptsaison abspielen …
Den ganzen Abend über war Henrik keine Pause vergönnt gewesen. Nach einer knappen Einführung durch Robert hatte ihn die Kellnerin, die ihn entdeckt hatte, unter ihre Fittiche genommen. In einem Crashkurs von dreißig Minuten erfuhr er von ihr alles darüber, was er im Service zu leisten und auf was er zu achten hatte. Seine Einweiserin hieß Carde, war Anfang zwanzig und studierte Wirtschaftswissenschaften. Dass sie sich nur wenige Stunden nach Schichtende im Vorlesungssaal an ihrer Uni einfinden musste, schien offenbar kein Problem für sie zu sein. Henrik hingegen konnte sich im Moment noch nicht einmal vorstellen, überhaupt je wieder aus dem Bett zu steigen – sobald er es erst mal hineingeschafft hatte. Jedenfalls half Carde ihm nach dem Anlernen noch beim Umbinden der schwarzen Servierschürze und warf ihn dann ins kalte Wasser. So absolvierte er seine ersten acht Stunden als Aushilfskellner in einem der angesagtesten Lokale in Lissabon. Zu seiner Überraschung wirkte selbst Robert nach dieser ersten Schicht zufrieden mit ihm. Irgendwie wenigstens. Er war von seinem zum Aufbrausen neigenden Chef zwar nicht explizit gelobt worden, wurde allerdings auch nicht gemaßregelt, wenn er etwas falsch angepackt hatte. Zumindest nicht, wie er es bei anderen seiner Mitstreiter ab und an erleben durfte. Noch hatte er wohl eine Galgenfrist, wenn er die Blicke und Gesten seiner Kolleginnen und Kollegen richtig gedeutet hatte. Heute durfte der Neue sich das noch leisten, ab morgen sah das womöglich schon ganz anders aus.
Morgen!
Während er sich benommen und mit schwerem Schritt die Rua do Loreto entlangschleppte, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, morgen noch einmal hinzugehen. Unter dem honiggelben Licht der Straßenbeleuchtung verlief sich um ihn herum das Partyvolk, das aus den Bars und Clubs des Ausgehviertels Bairro Alto heimwärts strebte. Das war der Unterschied zum Alfama, in dem seine neue Arbeitsstelle lag. Dort waren die Gassen und Gässchen um drei Uhr nachts wie ausgestorben. Die Bewohner des Fischerviertels hüteten um diese Zeit längst ihre Betten, genau wie die Touristen, die in den Hotels abgestiegen waren, in ihren Appartements, die sie über Airbnb gebucht hatten, oder die, die in ihre Kabinen an Bord der Kreuzfahrtschiffe zurückgekehrt waren. Dass es im Pôr do sol heute überhaupt so spät geworden war, hatte Robert eine Ausnahme genannt. Wobei Henrik eher vermutete, dass sein neuer Chef ihn damit nur besänftigen wollte, um sicherzugehen, dass er nachmittags wieder auf der Matte stand.
War er verrückt genug, das auch zu tun? Immerhin war er den ganzen Abend so damit beschäftigt gewesen, bei seinem Kellnerjob alles richtig zu machen, dass ihm keine Zeit geblieben war, sich dem zu widmen, wofür er dort eigentlich angeheuert hatte. Und es war nicht abzusehen, ob sich dieser Zustand schnell genug bessern würde. Während seine lädierten Füße mit den Unebenheiten des Kopfsteinpflasters kämpften, bezweifelte er stark, dass es irgendeinen Sinn hatte, diese irrwitzige Idee weiterzuverfolgen. Und so spielte es im Moment auch keine Rolle mehr, wie sehr ihn interessierte, was Martin mit seinen Besuchen im Pôr do sol bezweckt hatte. Oder, genauer gesagt, wen sein Onkel dort vor fünf Jahren ins Visier hatte nehmen wollen.
Im Gehen schüttelte er über sich selbst den Kopf. Es war doch eigentlich höchst unwahrscheinlich, dass die Zielperson seines Onkels nach so langer Zeit überhaupt noch in diesem Restaurant anzutreffen war. Und das war nicht das Einzige. Natürlich konnte Martins Interesse einem Mitarbeiter gegolten haben, doch es bestand genauso die Möglichkeit, dass er dort einen Restaurantgast observiert hatte.
Gegen all diese Zweifel sprach lediglich sein Bauchgefühl. Und die simple Tatsache, dass es in diesem frühen Stadium seiner Ermittlung in jeder Hinsicht einfacher war, seine Aufmerksamkeit auf das Restaurantpersonal zu richten. Leider hatte es seither auch einen Besitzerwechsel gegeben, was seine Chancen weiter verringerte, unter den Mitarbeitern denjenigen anzutreffen, für den sich sein Onkel womöglich interessiert hatte. Diese Ausgangssituation, zusammen mit der arg dünnen Faktenlage, ließ es nicht gerade lohnenswert erscheinen, diese Plackerei noch einmal auf sich zu nehmen.
Eine Frau ist gestorben, nachdem sie dort gegessen hat.
Nun, genau das war der Punkt, der ihn bei der Stange hielt. Und dass es sich um jenes Restaurant handelte, zu dem Martin ihn geführt hatte. Zwei bemerkenswerte und verdächtige Umstände verwiesen ihn auf das Pôr do sol, das musste für den Moment genügen.
Eine Frau ist gestorben, nachdem sie dort gegessen hat. Eine Aussage, die vorerst lediglich auf Gerüchten basierte und daher beinahe wie ein Schauermärchen anmutete. Eben eine jener Geschichten, die man zwischen Tür und Angel beim Gemüsehändler oder über den Tresen des Stehcafés hinweg erzählt bekam und auf die man besser nichts gab. Jedenfalls, wenn man nicht zusätzlich noch auf einen Hinweis im Antiquariat in der Rua do Almada gestoßen war. Auf eine versteckte Botschaft von Martin Falkner.