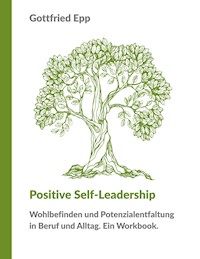
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wozu? Sie wollen Ihre Stärken und inneren Treiber besser verstehen und wirksam in den Alltag integrieren? Sie wollen konstruktiver mit den eigenen Ressourcen umgehen und Entwicklungschancen entdecken? Sie wollen etwas für Ihre Gesundheit tun und Ihre Potenziale entfalten? Wie? Dieses Buch unterstützt Sie dabei Ihren Weg zu finden. Positive Self-Leadership ist mehr als nur eine Ergänzung zu den Leadership-Themen und Methoden. Es ist ein Thema für uns alle - und nicht nur für Führungskräfte. Das >Positive< weist auf die Positive Psychologie hin, die man mit >Schwächen managen, Stärken und Potenziale stärken!< zusammenfassen kann. Es ist also kein >Du musst nur positiv denken, das Schlechte ausblenden, und Du wirst alles schaffen< Geschwafel. Dieses Buch orientiert sich an evidenzbasierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie. Durch zahlreiche Übungen können Sie Ihre Erkenntnisse und Ideen sofort im eigenen (Arbeits-)Alltag umsetzen. It is a Workbook! Was? Das Buch beschreibt im ersten Teil Grundbegriffe zu den Themen Self-Leadership, Potenzialentfaltung und Wohlbefinden. Mit mehreren Selbstcoaching-Übungen zum Auffinden Ihrer inneren Treiber (des >Why<) gipfelt der erste Teil. Im zweiten Teil steht das Praxismodell für Positive Self-Leadership im Mittelpunkt. Als Metapher dient das PERMA-SL-Dashboard, welches ein Analyse- und Steuerinstrument für das eigene Wohlbefinden ist. Vertiefende theoretische Ausführungen leiten zur reflektiven Auseinandersetzung mit den acht Dimensionen hin: Positive Emotions, Engagement & Flow, Relationships, Meaning & Purpose, Accomplishment, Selbstbestimmung, Optimistic Coping und Gesundheit. www.eudaimonic.at
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Prolog
1.1 Positive Leadership needs Positive Self-Leadership
1.2 PERMA: The Human Dashboard
1.3 PERMA-SL-Dashboard zur Steuerung des Positive Self-Leadership
1.4 Kapitelüberblick
1.5 Hinweise und Tipps
T
EIL
I: E
INFÜHRUNG
& G
RUNDBEGRIFFE
2 Self-Leadership
2.1 Kognitionsbasierte Strategien
2.2 Natürliche Belohnungsstrategien
2.3 Soziale Strategien
3 Potenzialentfaltung
3.1 Vier Ebenen des Zuhörens & In-sich-hineinhörens
3.2 Vom Presencing zum Performing
3.3 Theorie U in der Praxis: Impulse für die Personalentwicklung
4 Innere Treiber
4.1 Ressourcen
4.2 Werte
4.3 Tugenden und Charakterstärken
5 Wohlbefinden
5.1 PERMA als Metamodell
5.2 Subjektives Wohlbefinden
5.3 Psychologisches Wohlbefinden
5.4 Eudaimonische und hedonistische Orientierung
T
EIL
II: V
ERTIEFUNG
& P
RAXIS
6 Entwicklung des Praxismodells für Positive Self-Leadership
6.1 Faktoren des Praxismodells
6.2 Umsetzung mit dem PERMA-SL-Dashboard
7 Positive Emotionen
7.1 Die Broaden-and-Build-Theorie
7.2 Angebrachte und unangebrachte Negativität
7.3 Die zehn positiven Emotionen
7.3.1 Freude (Joy)
7.3.2 Dankbarkeit (Gratitude)
7.3.3 Gelassenheit und Heiterkeit (Serenity)
7.3.4 Interesse (Interest)
7.3.5 Hoffnung (Hope)
7.3.6 Stolz (Pride)
7.3.7 Inspiration (Inspiration)
7.3.8 Vergnügen (Amusement)
7.3.9 Ehrfurcht (Awe)
7.3.10 Liebe & Verbundenheit (Love)
7.4 Positive Ratio: Positive Emotionen sind messbar
7.5 Positive Ratio in Teams
7.6 Sechs gute Gründe für positive Emotionen
8 Engagement & Flow
8.1 Das Flow-Konzept von Mihaly Csikszentmihalyi
8.2 Charakterstärken und Flow
8.2.1 Charakterstärken und PERMA
8.2.2 Charakterstärken als Burnoutprävention
8.2.3 Lebens- und Arbeitszufriedenheit: Hilfreiche Charakterstärken
8.3 Signaturstärken: „Das bin ganz Ich“
9 Relationships
9.1 Schlüsselfaktor Vertrauen
9.2 Vertrauen und Feedback
9.2.1 Ich-Botschaften
9.2.2 Die Abstraktionsleiter
9.2.3 Werkzeug: Auf gute Nachrichten positiv reagieren
9.3 Konfliktkompetenzen für Positive Self-Leadership
9.3.1 Die berufliche Rolle
9.3.2 Die 9 Konfliktstufen nach Glasl
9.3.3 Rollen und Ich-Zustände
9.3.4 Konfliktlösungsstrategien
9.4 Psychologische Sicherheit: Vertrauen auf Team- und Organisationsebene
9.5 Machtspiele und Wachstumsräume
10 Meaning & Purpose
10.1 Empirische Sinnforschung: Was ist Sinn?
10.2 Sinnerfüllung & Lebensbedeutungen
10.3 Sinnerfüllung und Sinnkrise: Ein Doppelkontinuum
10.4 Existenzielle Indifferenz
10.5 Sinn in der Arbeitswelt
10.6 Kriterien für berufliche Sinnerfüllung
10.7 Messung der beruflichen Sinnerfüllung
10.8 Arbeitszufriedenheit (allein) ist zu wenig
10.9 Gefahren der beruflichen Sinnerfüllung
11 Accomplishment
11.1 Promotionsfokus und Präventionsfokus
11.2 Fixed Mindset & Growth Mindset
11.3 Benefit Mindset for Everyday Leadership
12 Selbstbestimmung
12.1 Selbstbestimmungstheorie
12.2 Motivationspotenzial: “Like a bridge over troubled water”
12.3 Maslow reloaded: Selbstbestimmung und Selbstverantwortung
12.4 Die Ebenen der Bedürfnispyramide
12.5 Die Bedürfnispyramide in der Arbeitswelt
12.6 Die Bedürfnispyramide als Pyramide und Phasenmodell
12.7 Fünf Impulse zur Weiterentwicklung des eigenen Positive Self-Leadership.
13 Optimistic Coping
13.1 Psychologisches Kapital
13.2 Erlernter Optimismus
13.3 Verdichtete Manöverkritik
14 Gesundheit
14.1 Psychische Gesundheit: Ein Doppelkontinuum
14.2 Salutogenese
14.3 Gesunde Arbeitsbedingungen
14.4 SelfCare: Gesundheitsförderliche Selbstführung
14.5 Gesundheit als Faktor der Symbiose
15 Epilog: Danksagung
16 Anhang
16.1 Tabellenverzeichnis
16.2 Abbildungsverzeichnis
16.3 Übungen
16.4 Praxisbeispiele
16.5 PERMA-SL-Dashboard Reflexionsübungen
16.6 Stichwortverzeichnis
16.7 Literaturverzeichnis
16.8 Über den Autor
1 Prolog
1.1 Positive Leadership needs Positive Self–Leadership
1.2 PERMA: The Human Dashboard PERMA–SL–Dashboard zur Steuerung des
1.3 Positive Self–Leadership
1.4 Kapitelüberblick
1.5 Hinweise und Tipps
Die ersten Worte eines Buches, so sagt man, seien immer die Schwierigsten. Dabei ist es wie bei jeder Veränderung, man beginnt mit einem ersten Schritt. Es ist noch nicht ganz klar, was dabei rauskommt und wie es im Detail ausschaut.
Wie fängt man nun ein Buch an, in dem es darum geht, den Unterschied zwischen Glück und Wohlbefinden sowie Leadership und Self-Leadership zu erläutern. Und warum das so wichtig für die eigene Gesundheit und das Ausleben der Potenziale ist. Wie man später genauer nachlesen kann, geht es beim hedonistischen Wohlbefinden vor allem um „happiness“ – also Spaß haben und glücklich sein. Das ist zwar auch wichtig. Für eine Langzeitwirkung sollte man jedoch auf das eudaimonische Wohlbefinden (eudaimonic wellbeing) achten. Das Wort „eudaimonisch“ kommt übrigens von Aristoteles und bedeutet so viel wie „ein gutes Leben führen“ und „seine Potenziale entfalten“. Daher kommt auch der Untertitel „Potenzialentfaltung und Wohlbefinden für Beruf und Alltag“.
In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit der Positiven Psychologie im Allgemeinen und dem Positive Leadership im Speziellen sowie den Themen Potenzialentfaltung und potenzialfokussierte Entwicklung beschäftigt. Im letzten Jahr sind in Webinaren und in den sozialen Medien (twitter, LinkedIn) immer wieder das Thema „Self-Leadership“ bzw. „Selbstführung“ aufgetaucht. Auch wenn es manchmal nur Teilaspekte davon waren, wie sich bei der genaueren Recherche gezeigt hat. Deshalb habe ich selbst mit der Recherche begonnen, und als ersten Schritt einen kleinen Selbstlernkurs für meine Webseite gestaltet. Dieser ist aus der ursprünglichen Intention „eine kleine Marketingmaßnahme zu machen“ entstanden. Ich glaube, dafür ist das „PERMA-Dashboard“ mit ca. 50 A4 Seiten eigentlich zu lang – aber was weiß ich schon von Marketing. Als im Herbst dann erkennbar wurde, dass die Corona-Pandemie noch länger dauern würde, habe ich mich dazu entschlossen, aus den bisher gesammelten Ideen, Texten und eigenen Blogbeiträgen ein Buch zu machen. Damit habe ich mir auch einen Lebenswunsch erfüllt. So bin ich losgegangen, und habe recherchiert, getextet und gelayoutet – Step by Step.
Ich lade Sie ein sich auf den Weg der kleinen Schritte zu machen, weil …
Self-Leadership
ein Thema für alle
ist – und nicht nur für Führungskräfte. Führungsarbeit (Leadership) passiert ständig, und Self-Leadership umso mehr. Es beginnt mit dem Aufstehen und endet mit dem Einschlafen.
Self-Leadership mehr ist als nur eine Ergänzung
zu den Leadership-Themen und Methoden
Das „Positive“ kommt von der
Positiven Psychologie
. Dort steht
„Schwächen managen, Stärken stärken“
im Mittelpunkt. Es ist also mehr als ein reines
„Du musst nur positiv denken, das Schlechte ausblenden, und Du wirst alles schaffen“
Geschwafel.
Apropos Geschwafel, das gibt es hier nicht. Dieses Buch orientiert sich an
evidenzbasierten, wissenschaftlichen Erkenntnissen
. – (hoffentlich)
gut lesbar
und
verständlich.
Natürlich dürfen dabei
positive Emotionen
und ein Schuss
Humor
vorkommen.
Durch
Praxisbeispiele
werden Anwendungen der theoretischen Modelle vorgestellt
Durch die vielen
Übungen
kann man es sofort im eigenen (Arbeits-)Alltag umsetzen. Deshalb heißt es ja auch
Workbook
.
Im folgenden Abschnitt gehe ich auf die wichtigsten Begriffe und den Fokus meines Buches ein. Abgerundet wird dieses Einleitungskapitel von einer Kurzzusammenfassung der einzelnen Kapitel und Hinweisen zur Anwendung des Buches in der Praxis.
1.1 Positive Leadership needs Positive Self-Leadership
Beim Thema Leadership wird aktuell viel über die komplexen Herausforderungen diskutiert. Bei der Frage, was erfolgreiche Führungsarbeit ausmacht, kommt jedoch häufig ein wesentlicher Faktor zu kurz: die inneren Prozesse des Leaders. Denn für effektives Leadership ist Self-Leadership eine wichtige Voraussetzung.
Leadership wird gemeinhin mit Führungsarbeit oder der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, gleichgesetzt. Es ist eine effektive Fremdbeeinflussung im Sinne von „Yes, we can!“. Positive Leadership fokussiert ganz im Sinne der Positiven Psychologie auf die Stärken und Ressourcen der Mitarbeiter. Ein wichtiger Leitsatz lautet dabei: „Schwächen managen, Stärken stärken!“
Während sich der Begriff Leadership auf die Beeinflussung anderer Personen bezieht, versteht man unter Self-Leadership die Beeinflussung eigener innerer oder gedanklicher Prozesse. Es ist also eine effektive Selbstbeeinflussung im Sinne von „Yes, I can!“. Oftmals wird der Begriff Selbstführung synonym verwendet. Beim Positive Self-Leadership steht gemäß der Positiven Psychologie die Fokussierung auf die eigenen Potenziale, also die besonderen Talente und Begabungen, im Mittelpunkt. Es ist somit Selbstführung auf der Grundlage der Positiven Psychologie.
Warum Positive Self-Leadership so wichtig ist?
Ich unterstütze seit 2013 Menschen dabei, ihre eigenen Potenziale zu entdecken und zu entwickeln. Die Beratung nennt sich „Potenzialanalyse“, und besteht aus einem Erstgespräch, einer Testphase (mit psychologischen Tests) und einem Auswertungsgespräch. In diesen Coachingprozessen fällt mir häufig auf, dass viele Coachees (bzw. meine Kunden*innen) zu wenig oder gar nicht auf ihre Bedürfnisse achten. Dies ist ihnen oft gar bewusst. Sie nehmen es als gegeben hin, und hinterfragen es deshalb auch nicht. Noch häufiger trauen sich die Kunden*innen nicht, etwas zu unternehmen. In der Arbeitswelt hat dies oft mit hierarchischen Strukturen zu tun. Auch im privaten Umfeld lässt man sich gerne von außen leiten „Ich kann ja nicht, weil mein Chef / meine Partner*in / mein Vater / meine Mutter will von mir, dass ich …“ Man will es allen recht machen, und stellt externale Bedürfnisse und Anforderungen in den Vordergrund. Die eigenen Bedürfnisse werden dabei vernachlässigt. „Auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, hat nichts mit Egoismus zu tun.“ ist eine dabei effektive Rückmeldung – eigentlich schon eine Intervention. Wer auf die eigenen Bedürfnisse achtet, in sich hineinhört, weiß was gut für ihn/sie ist und kann leichter entscheiden, was er/sie machen will.
Die Grundlage für Positive Leadership bilden eben nicht nur Methoden und Tools, sondern in erster Linie die eigene Haltung und das eigene Verhalten. Positive Leadership beginnt somit mit dem Positive Self-Leadership – einer stärkenorientierten Selbstführung.
Positive Self-Leadership kann man (grob) unter zwei Blickwinkeln betrachten. Einerseits auf der Methoden- und Tools-Ebene und anderseits auf der persönlichen Ebene.
Bei den Methoden und Tools geht es z.B. um Zeitmanagement (2 Minuten Regel, 72 Stunden Regel, Kanban-Board, …), Leitsätze (Eat the frog, Zero Email Box, …) und andere Tools (SMART, VARES, …). In diesem Buch beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der persönlichen Ebene, und lernen dazu die acht Faktoren für gelungene Selbstführung kennen.
Glückliche Menschen sind erfolgreicher – nicht umgekehrt!
In einer Metastudie von Lyubomirsky, King und Diener (2005) wurden über 225 Einzelstudien analysiert. Zufriedene Mitarbeiter*innen erreichten im Durchschnitt eine um 31 % höhere Produktivität, 37 % mehr Verkaufsabschlüsse sowie eine dreimal (!!!) so hohe Kreativität. Zudem wurde eine deutlich erhöhte Leistungsfähigkeit festgestellt.
Eine aktuelle Studie der Universität Oxford (Bellet et al. 2019) zeigt ähnliche Ergebnisse. Die Befragten (n=1800) zeigten um 13 % höher Verkaufsabschlüsse, in Wochen in denen sie sich glücklich einschätzten.
Auch immer wieder interessante Erkenntnisse liefert der Erfinder des PERMA-Lead©- Profilers Markus Ebner mit seinem Team. Hier zwei wirklich interessante Ergebnisse zu Positive Leadership. In einer Pilotstudie wurden Extremgruppen verglichen: Führungskräfte mit hohen PERMA-Lead-Werten mit Führungskräften mit niedrigen PERMA-Lead-Werten. Es zeigte sich, dass dies nicht nur zu deutlich zufriedeneren, motivierteren und gesunderen Mitarbeitern*innen führt, sondern auch zu höherer Kundenzufriedenheit und sogar höheren Verkaufszahlen. Ebenso bemerkenswert sind Ergebnisse einer bislang noch nicht publizierten Studie (Ebner 2021). In Teams mit ausgeprägten Positive Leadership (gemessen durch höhere PERMA-Lead Werte) sind die Mitarbeiter*innen im Durchschnitt deutlich zuversichtlicher, gut durch eine Krise zu kommen. Positive Leadership und Positive Self-Leadership haben also nichts mit sogenannter „Sozialromantik“ zu tun. Es ist kein „Nice-to-have“ – es ist ein „Must-have!“
PERMA als Grundlage für Flourishing
In der Pflanzenwelt wird PERMAkultur mit nachhaltiger Landwirtschaft und Gartenbau assoziiert. In der Positiven Psychologie sprechen wir von Aufblühen bzw. vom Flourishing. Der Vergleich lässt sich noch weiter „spinnen“. In der PERMAkultur geht es hier wie da nicht nur um „ein bisschen aufblühen“ oder etwas „möglichst effizient zum Blühen zu bringen, um die Ernte zu maximieren.“
Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, der auf wissenschaftlichen, evidenzbasierten Erkenntnissen aufbaut, und gänzlich auf „esoterischen Hokuspokus“ verzichtet. PERMA ist ein Akronym und wurde vom Martin Seligman (2011) entwickelt und konzipiert. Mittlerweile sind die theoretische Fundierung und die Wirksamkeit von PERMA vielfach belegt.
Der Begriff Flourishing ist aus der Pflanzenwelt entlehnt, und lässt sich mit „Aufblühen“ übersetzen. Dazu zählen das bewusste Wahrnehmen und Erleben
von positiven Eindrücken und Erfahrungen (Positive Emotions),
das Meistern der Aufgaben im Beruf und im Alltag (Engagement & Flow),
das Erleben von unterstützenden Beziehungen (Relationships),
von sinnvollen und sinnstiftenden Aufgaben und Tätigkeiten (Meaning & Purpose)
und von Erfolgserlebnissen (Accomplishment).
Das Ausleben von PERMA – sowohl in der Arbeit als auch im Alltag – stärkt das persönliche Wohlbefinden und ermöglicht die Potenzialentfaltung. Das PERMA-Modell kann auch als Meta-Modell verstanden werden, in dem man verschiedene Modelle unterordnen kann. Die beiden bekanntesten Bücher zur Positiven Psychologie im deutschsprachigen Raum „Positive Leadership“ (Ebner 2019) und „Arbeit besser machen“ (Rose 2019) orientieren sich am PERMA-Modell, und sind entsprechend gegliedert. Auch die neueren kürzeren Bücher zu den Themen „Positiv Führen in schwierigen Zeiten“ (Thiele 2020) oder „Führen mit Sinn“ (Rose 2020) orientieren sich genauso am PERMA-Modell.
Daher lag es auf der Hand, das PERMA-Modell als Ausgangspunkt zu wählen. Hierzu möchte ich Ihnen die Metapher des PERMA-Dashboards vorstellen.
1.2 PERMA: The Human Dashboard
In seinen Vorlesungen erzählt Martin Seligman (Seligman et al 2020, Course 1) über den Beginn seiner Präsidentschaft der American Psychological Association im Jahre 1998 und seinen Weg zum PERMA-Modell. Beim Unkrautjäten in seinem Garten gab ihm seine Tochter einen entscheidenden Dankanstoß. Dabei bemerkte er, dass die Psychologie nur halb fertig ist: „I realized, that my profession, psychology, was half-baked. That the part that had been baked and the part that I was proud of was the alleviation of suffering, but the part that was unbaked, the part that was missing, was a psychology of well-being.“ (ebd., Module 1.3).
Für Seligman (ebd.) haben drei wichtige Dinge gefehlt:
Eine
psychologische Theorie des Wohlbefindens
(theory of well-being). Fast alle Theorien und Modelle in der Psychologie beschäftigen sich Krankheiten und psychischen Störungen – mit dem was fehlt.
Es gibt keine
Messinstrumente für Wohlbefinden
.
Es gab keine
Interventionen, um das Wohlbefinden zu stärken und zu verbessern
. Die meisten Interventionen und Therapien zielten darauf ab, das Leiden (durch Krankheit und Störungen) zu vermindern.
Wie sich gezeigt hat, hat sich das PERMA-Modell zum zentralen Paradigma der Positiven Psychologie entwickelt. Seligman bezeichnet in seinen Vorlesungen das PERMA-Modell als das „human Dashboard“.
Woher kommt der Dashboard-Vergleich?
Der Begriff „Dashboard“ bezieht sich ursprünglich auf das Armaturenbrett im Auto oder das Cockpit im Flugzeug. Ein Dashboard ist also ein System zur Visualisierung aktueller Daten, mit dem Ziel der Steuerung des aktuellen Geschehens.
Seligman vergleicht ein Dashboard mit dem Cockpit eines Flugzeugs. Es gibt verschiedenste Messinstrumente wie Tachometer, Höhenmeter, Tankanzeige, Radar, Außentemperatur, Innentemperatur, usw. Die Frage ist: Gibt es eine einzige Anzeige, die anzeigt, wie es dem Flugzeug gerade geht? Bzw. anders formuliert: Reicht es, wenn sich der Pilot auf eine einzige Anzeige konzentriert?
Die Antwort ist natürlich: nein! Es kommt darauf an, welche Prioritäten man setzt:
Wenn man versucht, so schnell wie möglich von Wien nach Pennsylvania zu fliegen, ist der Tachometer entscheidend.
Wenn man versucht, so bequem wie möglich dorthin zu gelangen, sollte man auf das Wetterradar achten.
Wenn man versucht, so wirtschaftlich wie möglich dorthin zu gelangen, ist die Tankanzeige bzw. die Verbrauchsanzeige, die entscheidende Anzeige.
Es ist also nicht eine einzelne Anzeige, die beschreibt, wie es einem Flugzeug geht. Es hängt von der Mission ab. Je nach Mission und Prioritätensetzung wird man einen Faktor in den Mittelpunkt stellen. Ein Flugzeug hat zwar relativ viele Analyse- und Steuerungssysteme. Ein Flugzeug ist somit sehr kompliziert. Dennoch bleibt ein Flugzeug im Sinne Heinz von Foersters eine „triviale Maschine“. Bei trivialen Maschinen hat ein bestimmter Input einen Output zur Folge. Wenn der Pilot die Schubkraft erhöht, fliegt das Flugzeug schneller. Wenn man im Auto auf das Gaspedal steigt, beschleunigt es.
Wir Menschen verfügen über wesentlich mehr Funktionen, und verfügen zudem über ein Eigenleben. Wir sind daher „nicht triviale Maschinen“. Wir sind komplex. Ein bestimmter Input hat nicht automatisch einen bestimmten Output zur Folge. Dennoch ist es hilfreich, sich zu überlegen, auf welche Faktoren man achten sollte. Und so kommen wir zurück zum PERMA-Modell. Seligman (2020) bezeichnet PERMA als das „Human Dashboard“.
1.3 PERMA-SL-Dashboard zur Steuerung des Positive Self-Leadership
Die Metapher des Human-Dashboard habe ich auch für dieses Buch aufgegriffen. Wie sich in der Entwicklung eines Praxismodells gezeigt hat, ist es sinnvoll das PERMA-Modell um drei weitere Faktoren zu erweitern.
Positive Emotions:
Wie kann ich positive Emotionen bewusster wahrnehmen?
Engagement & Flow:
Wie kann ich meine Charakterstärken gezielt einsetzen?
Relationships:
Wie kann ich die sozialen Beziehungen zu meinen Arbeitskollegen*innen stärken?
Meaning:
Woran erkenne ich sinnerfüllende Elemente in meinem täglichen Tun?
Accomplishment:
Wie kann ich meine eigenen Leistungen wertschätzen?
Selbstbestimmung:
Wie erkenne ich meine Gestaltungspielräume?
Optimistic Coping:
Wie kann ich hoffnungsvoll und optimistisch aktuelle Herausforderungen bewältigen?
Gesundheit:
Was kann ich im Alltag für meine psychische und physische Gesundheit tun?
Das PERMA-SL-Dashboard erfüllt somit zwei wichtige Aufgaben
Analysetool:
Eine Analyse dient zur Bestimmung des aktuellen IST-Zustandes. Dies wird durch die Pegelanzeige im oberen Bereich abgebildet.
Steuerinstrument:
Durch das Verschieben des Schiebereglers kann der jeweilige Faktor erhöht (nach oben) oder abgeschwächt (nach unten) werden.
Abb. 1: Das PERMA-SL-Dashboard
Das PERMA-SL-Dashboard: Ein Mischpult für Wohlbefinden & Potenzialentfaltung
Während meines Studiums in Salzburg durfte ich in der Gründerphase des Freien Radios, der Radiofabrik, dabei sein. Zu Beginn hatten wir noch kleine 4 und 8 Spur Mischpults. Im ersten echten Studio waren es dann 16 Spuren. Auf jeder Spur befand sich eine Tonquelle: Mikro 1, Mirko 2, CD 1, CD 2, PC-Audio, usw. Viele von uns kamen so mit professioneller Audiotechnik in Berührung, und lernten diese nach und nach besser kennen.
Eines der wichtigsten Prinzipien war das sogenannte Aussteuern. Also wie laut ist die jeweilige Tonspur. So konnten Menschen die sehr laut und solche die eher eine ruhige Stimme hatten mit demselben Mikrophon arbeiten und Sendungen gestalten.
Einerseits musste man beachten, nicht zu laut zu werden. Dann wurde das Signal abgeschnitten und es krachte im Radio. Also schon eher im oberen Bereich, aber eben nicht zu hoch.
Anderseits musste man darauf achten, dass das Tonsignal nicht zu leise wurde. Dies war manchmal bei schlechten Tonaufnahmen wie z.B. Interviews mit lauten Hintergrundgeräuschen durchaus eine Herausforderung. Bei guten Tonaufnahmen, wie z.B. beim Abspielen einer CD, war es jedoch ein Kinderspiel.
Warum erzähle ich Ihnen diesen Vergleich?
Weil die Metapher des PERMA-SL-Dashboards genauso funktioniert. Es besteht einerseits die Gefahr, dass man auf einer einzelnen Spur zu laut wird. Das könnte bedeuten, dass man in der täglichen Routine zu stark auf Sinnerleben fixiert ist. Und im Gegenzug zu wenig auf das Aufbauen von unterstützenden Beziehungen und / oder das bewusste Wahrnehmen von Erfolgen vergisst.
Das Übersteuern am Mischpult kann mit dem übermäßigen Ausleben von Stärken gleichgesetzt werden. Manchmal wird man erst so richtig gut, wenn man seine größten Stärken etwas zurücknimmt: Humor gezielt einsetzen, Zurückhaltung statt übermäßiger Bescheidenheit, Zuhören und neues erfahren, usw. Genauso wie ein starkes Tonsignal, dann am besten ist, wenn man es gut aussteuert.
Wenn ein Kanal zu niedrig aussteuert, muss man diesen lauter aufdrehen. Wenn dies nicht reicht braucht man einen Verstärker. Das Pendant zu Verstärkern sind in der Positiven Psychologie die Positive Interventionen. Diese haben eine durch Studien nachgewiesene gesundheitsfördernde Wirkung und sollen leicht und täglich anwendbar sein, sodass man diese gut in den Alltag integrieren kann. Deshalb gibt´s im vorliegenden Buch jede Menge Übungen, die Sie sofort ausprobieren können!
1.4 Kapitelüberblick
Das Buch gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt (Kapitel 1 bis 5) werden wichtige Begriffe erläutert und ein Praxismodell für Positive Self-Leadership vorgestellt. Im zweiten Abschnitt werden die acht Faktoren detaillierter erläutert. Dabei werden wichtige theoretische Modelle, Studienergebnisse, Praxisbeispiele und Übungen vorgestellt.
Im zweiten Kapitel Self-Leadership geht es um einen zentralen Begriff dieses Buches. Self-Leadership ist die zielorientierte Selbstbeeinflussung von Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen zur Steigerung der persönlichen Effektivität und Leistung. Im fähigkeitsbezogenen Self-Leadership-Ansatz wird zwischen natürlichen Belohnungsstrategien, kognitionsbasierten und sozialen Strategien unterschieden.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Potenzialentfaltung. Potenziale sind was noch werden könnte, Potenziale sind mein inneres Bestes! Wie wir unserer eigenen „highest future possibility“ näherkommen, lernen wir mit der Theorie U und den vier Ebenen des Zuhörens.
Im vierten Kapitel dreht sich alles um das „Why“ – was sind unsere Antreiber. Zunächst werden die Begriffe Ressourcen, Werte, Charakterstärken sowie Ziele und Visionen unterschieden. In mehreren Übungen können Sie sich Ihren Visionsbaum erarbeiten.
Im Kapitel Wohlbefinden kommen wir zunächst auf das PERMA-Modell als Metamodell zurück, und vergleichen im Anschluss subjektives und psychologisches Wohlbefinden. Danach geht es um die Unterscheidung zwischen hedonistischer und eudaimonischer Orientierung.
Mit dem sechsten Kapitel beginnt der zweite Abschnitt dieses Buches. In diesem Kapitel werden das Praxismodell und die Umsetzung mit dem PERMA-SL-Dashboard vorgestellt.
Im siebten Kapitel wird mit den Positiven Emotionen der erste Positive Self-Leadership Faktor vorgestellt. Herzstück dieses Kapitel sind die Forschungen von Barbara Fredrickson über positive Emotionen.
Im achten Kapitel stehen Engagement und Flow - der Motivationsfaktor im PERMA-Modell – im Mittelpunkt. Wie in der Überschrift schon erkennbar, wird das Flow-Erleben hier eine wichtige Rolle spielen.
Das neunte Kapitel Relationships dreht sich um soziale Beziehungen und Wirkfaktoren gelingender zwischenmenschlicher Kommunikation. Dabei beschäftigen wir uns mit den Kompetenzen, die für ein gelungenes Miteinander wichtig sind. Es geht also um Selbstvertrauen, Vertrauen und psychologische Sicherheit.
Im zehnten Kapitel Meaning & Purpose steht die Sinnerfüllung im Mittelpunkt. Wir schauen uns an, warum Kohärenz, Bedeutsamkeit, Orientierung und Zugehörigkeit für die Sinnerfüllung in Beruf und Alltag unverzichtbar sind.
Im elften Kapitel über Accomplishment geht es um das bewusste Wahrnehmen von vollendeten Leistungen. Ebenso werden die Modelle des Fixed and Growth Mindset, und deren Weiterentwicklung das Benefit Mindset vorgestellt.
Das zwölfte Kapitel beschäftigt sich mit der Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung. Die Selbstbestimmungstheorie und die drei Pfeiler des Motivationspotenzial werden veranschaulicht. Was die Bedürfnispyramide nach Maslow mit Selbstverantwortung zu tun hat, rundet dieses Kapitel ab.
Im 13. Kapitel wurde bei der Namensgebung etwas in die Trickkiste gegriffen. Hinter dem Optimistic Coping verstecken sich die Konzepte von Psychologischen Kapital und dem erlernten Optimismus.
Das 14. Kapitel Gesundheit rundet die acht Faktoren des Praxismodells ab. Gesundheit wird hier als Doppelkontinuum verstanden: Gesundheit ist keine eindimensionale Skala von krank bis gesund. Gesundheit erkennt man (a) am Wohlbefinden, welches zum Aufblühen (Flourishing) führt, und (b) an der Abwesenheit von (psychischer) Erkrankung.
Die Danksagung finden Sie im Epilog. Im Anhang finden Sie das Tabellen- und das Abbildungs- und das Literaturverzeichnis sowie einen Überblick über die Übungen und Praxisbeispiele.
1.5 Hinweise und Tipps
Das vorliegende Buch versteht sich als (kleines) Nachschlagewerk, als Orientierungshilfe und als Workbook gleichermaßen. Sie haben also mehrere Varianten wie Sie es verwenden können:
In jedem Kapitel sind die wichtigsten Begriffe und die dazugehörigen Modelle bzw. Theorien dargestellt. Verständlichkeit und Lesbarkeit sind dabei oberste Prämissen. Es geht dabei darum, eine Einführung in den jeweiligen Themenbereich, als auch die Verknüpfung zu anderen Themen aufzuzeigen. Im Sinne einer wissenschaftlichen Genauigkeit wurden die verwendeten Quellen bestmöglich zitiert. So kann man in den Originalquellen nachlesen, wenn „man es genauer wissen möchte“. Ebenso - im Sinne der wissenschaftlichen Genauigkeit – habe ich versucht, exakte Definitionen zu finden. Ich finde nichts mühsamer, wenn in Vorträgen, Webinaren o.ä. Begriffe verwendet werden, ohne dass auf die verwendete (exakte) Definition hingewiesen wird. Besonders wenn es um sogenannte Januswörter geht, wo jede/r hineinpackt was er/sie für – abhängig vom Wissenstand für wichtig – hält. Denken Sie an Agilität, Mindset, New Work oder Purpose, um nur ein paar zu nennen. Nicht alle Begriffe lassen sich 1:1 übersetzten, deshalb habe ich manchmal den englischen Originalbegriff in Klammer dazu geschrieben oder bin – wie z.T. bei den Kapitelüberschriften – beim Originalbegriff geblieben.
Die Idee der Orientierungshilfe hat für mich eine zweifache Bedeutung. Man kann den aktuellen Status analysieren. Dazu stehen Ihnen acht Faktoren des Positive Self-Leadership zur Verfügung. Gleichzeitig kann man den aktuellen Status immer in Bezug auf ein Prozessmodell betrachten. Wo stehe ich gerade in der Entwicklung? Was wäre ein sinnvoller nächster Schritt? Das Schrauben an einem Regler des PERMA-SL-Dashboard hat meistens Auswirkungen auf die anderen Faktoren. Das ist das Wunderbare an diesem Modell.
Das Buch ist ebenso ein Workbook. Zur Vertiefung einzelner Aspekte finden Sie Praxisbeispiele aus der Literatur und aus eigener Erfahrung sowie jede Menge Übungen zum Ausprobieren. Deshalb lege ich Ihnen an Herz, die Impulse für eine „Anleitung für mich Selbst“ am Ende der Kapitel des Praxismodells auszufüllen – und von Zeit zu Zeit auf Aktualität zu überprüfen.
Ich mag es nicht so gerne, wenn man mit Übungen ein Buch „vollschmiert“. Deshalb gibt es die Übungen auch als Download. Den Link finden Sie im Anhang.
TEIL I: EINFÜHRUNG & GRUNDBEGRIFFE
2 Self-Leadership
2.1 Kognitionsbasierte Strategien
2.2 Natürliche Belohnungsstrategien
2.3 Soziale Strategien
In diesem Kapitel geht es um Self-Leadership, einen zentralen Begriff dieses Buches. Self-Leadership ist die zielorientierte Selbstbeeinflussung von Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen zur Steigerung der persönlichen Effektivität und Leistung. Sofern nicht anders gekennzeichnet, werden das Self-Leadership-Konzept von Marco Furtner bzw. Marco Furtner und Urs Baldegger herangezogen. Self-Leadership stärkt die Kompetenzen im Umgang mit persönlichen und externen Leistungsansprüchen. Im Vergleich zu „statischen“ Motivationskonzepten beschreibt das Self-Leadership einen anwendungsorientierten und selbstbeeinflussenden Prozess.
Leadership & Self-Leadership
Während beim Self-Leadership die Beeinflussung von inneren (gedanklichen) Prozessen einer Person (=ich selbst) im Mittelpunkt stehen, fokussiert sich Leadership auf die äußere Beeinflussung von anderen Personen.
Self-Leadership bezeichnet man deshalb als effektive Selbstbeeinflussung: „Yes I can!“ Oftmals wird der Begriff Selbstführung synonym verwendet.
Leadership ist demnach die effektive Fremdbeeinflussung: „Yes we can!“ Leadership lässt sich am besten mit Führungsarbeit bzw. Führung übernehmen übersetzen.
Self-Leadership ist ein zielorientierter und selbstbeeinflussender Prozess zur Steigerung der persönlichen Effektivität und Leistung. Self-Leadership steigert sowohl die Selbstmotivation und Leistung, und ist eine wichtige Voraussetzung für aktives und effektives Leadership.
Ausgangspunkt: Fähigkeitsbezogenes Self-Leadership
Der gewählte Ansatz ist klar von verwandten Konzepten wie Selbstregulation und Motivation abgrenzbar. Weiters handelt es sich um ein fähigkeitsbezogenes Konzept. Das heißt die drei Self-Leadership Dimension kann man trainieren und entwickeln.
Das Trainieren von Self-Leadership bietet zahlreiche Vorteile. Hier eine Auswahl:
Steigerung der mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit
Erhöhung des Glaubens an sich selbst – der Selbstwirksamkeit
Reduktion des persönlichen Stressempfindens und Versagensängste
Stärkung der Selbstverantwortung, Ziele und Vorhaben tatsächlich umzusetzen
Förderung der Selbstmotivation
Steigerung von Flow-Erleben, Fähigkeit zu Kreativität und Innovation
Förderung von Teameffektivität
Stärkung der Leadership-Kompetenzen
Der fähigkeitsbezogene Self-Leadership-Ansatz besteht aus drei Strategiedimensionen.
Tab. 1: Fähigkeitsbezogenes Self-Leadership
Kognitionsbasierte Strategien
Selbstbeobachtung, Selbstzielsetzung, Selbstverbalisierung, Selbsterinnerung
Natürliche Belohnungsstrategien
Positiver Fokus, Intrinsifizierung, Erfolgsvisualisierung
Soziale Strategien
Gruppenoptimierung, Leistungsbezugnahme
2.1 Kognitionsbasierte Strategien
Jede Handlung und jede Verhaltensänderung haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Daher sollte man die eigenen Handlungen und Gedanken regelmäßig reflektieren. Durch die Selbstbeobachtung reflektiert man z.B. konkretes Verhalten in Gesprächen mit Mitarbeiter*innen oder Kunden*innen. Bei einer Stärken-Schwächen-Analyse kann professionelle Unterstützung durch einen Coach oder Berater hilfreich sein. Selbstverbalisierung („Ich schaffe es“, „Ich kann es“) und Selbsterinnerungen helfen uns den Fokus auf wichtige Ziele im Auge zu behalten. Selbsterinnerungen sind äußere Hinweise, wie z.B. Fotos, Videos, Zitate, Leitsprüche oder ein persönliches Motto. Perfektionisten rate ich zum Motto „Done is better than perfect!“.
Selbstbeobachtung und Selbstanalyse
Das regelmäßige Beobachten und Reflektieren über sich selbst wird als Selbstbeobachtung verstanden. Dazu zählen u.a. Potenzialanalysen oder Stärken-und-Schwächen-Analyse, manchmal auch mit professioneller Unterstützung durch einen Coach oder Berater.
Die hohe Kunst der Selbstbeobachtung kommt in der Kompetenz zur Achtsamkeit zum Ausdruck. Achtsamkeit ist die absichtliche und nichtbewertende Beobachtung aller inneren und äußeren Erfahrungen im gegenwärtigen Moment. Unter den inneren Erfahrungen versteht man auftauchende Gedankenmuster und Emotionen. Herausfordernd dabei ist ebenso beim Beobachten und Wahrnehmen nicht unmittelbar in die Interpretation (Suche nach Kausalität des Geschehens) und in die Bewertung (gefällt mir oder gefällt mir nicht) zu verfallen.
In diesem Zusammenhang fällt mir der Begriff des „Sofortismus“ von Bernhard Pörksen ein. Wir sind stark darauf konditioniert auf jegliche Information eine Bewertung parat zu haben. Im Sinne des Self-Leadership würde uns hier mehr Gelassenheit und mehr Mut zum Bekennen des Nichtwissens bzw. Noch-Nichtwissens sehr helfen.
Zur Selbstbeobachtung zählen auch sämtliche Formen der Reflexion. Dies kann in Gruppen- oder Teamsetting sein (Supervision, Intervision, Retrospektive, Teamcoaching), Einzelsetting (Supervision, Coaching oder Psychotherapie) oder auch ganz allein in Form von Tagebuchmethoden (3 Good Things Exercise).
Selbstzielsetzung
Bei der Selbstzielsetzung kann man zwischen lang-, mittel- und kurzfristigen Zielsetzungen unterscheiden. Weiters kann man zwischen konkreten Zielen oder Aufgaben und der Entwicklung von Kompetenzen differenzieren. Eine gute Selbstzielsetzungsstrategie beginnt mit dem Langzeitziel: Was möchte ich in 5 oder 10 Jahren erreicht haben? Das kann z.B. eine bestimmte Ausbildung wie der Abschluss eines Studiums, das Erreichen eines bestimmten Karrierestatus oder die Familiengründung sein. Langzeitziele sind Lebensziele, die manchmal sehr klar sind, jedoch weitaus häufiger nicht bewusst sind.
Die langfristige Selbstzielsetzung ist von vielen Faktoren abhängig:
Menschlichen Grundbedürfnissen: Macht, Leistung und Anschluss
Persönlichen Werten: Offenheit für Wandel (Selbstbestimmung, Stimulation, Hedonismus) vs. Bewahrung des Bestehenden (Sicherheit, Tradition, Konformität), Selbststärkung (Leistung, Macht) vs. Selbstüberwindung (Universalismus, Humanismus)
Persönlichkeitseigenschaften und Charakterstärken
Aktuelle und zukünftige familiäre und berufliche Situation
u.v.m
Der Langzeitstrategie sollte man die mittelfristigen Ziele (nächsten 6 bis 12 Monate) und die kurzfristigen Ziele (nächste 4 Wochen) unterordnen.
Eine zweite Differenzierung der strategischen Selbstzielsetzung betrifft die Art des Ziels:
Konkrete Aufgabe bzw. Projekt: Aufsetzen einer Webseite, Beitrag schreiben, …
Berufliches: Arbeiten in einem bestimmten Aufgabenbereich, bestimmte Position, …
Ausbildung: Studium, Lehrgang, Gewerbeberechtigung erlangen, …
Persönliche und soziale Kompetenzen: Achtsamkeit, konstruktives Feedback geben, aktives Zuhören, …
Selbstverbalisierung
Selbstmotivation kann durch Selbstverbalisierung und positive Selbstgespräche gestärkt werden. Wenn während der Zielerreichung Rückschläge und unmotivierte Phasen auftreten, kann man mit positiven Selbstgesprächen („Ich schaffe es“, „Ich kann es“) die Motivation steigern und die Selbstwirksamkeit stärken. Achtsame Selbstbeobachtung kann man mittels positiver Selbstverbalisierung dem Loslösen einer Negativspirale gegensteuern. Studien haben gezeigt, dass negative Gedanken und Emotionen dreimal so stark wirken wie positive. Barbara Fredrickson empfiehlt daher mindestens dreimal häufiger positive Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Dies gilt natürlich auch sich selbst gegenüber. Selbstverbalisierungen und Selbstgespräche können laut in eigenen Räumlichkeiten (Büro, Dusche oder im Auto) und leise in Form einer Meditation oder eines inneren Dialogs gestaltet werden.
Selbsterinnerung
Neben den inneren Wiederholungen und Selbstgesprächen der persönlichen Leit- und Zielgedanken wirken äußere Erinnerungshilfen unterstützend. Diese können digital, analog oder menschlich sein. Digitale Selbsterinnerungen sind z.B. Fotos, Videos, Zitate, Leitsprüche oder ein persönliches Motto auf dem Smartphone oder am Laptop. Analoge Selbsterinnerungen sind beispielsweise Postits oder Postkarten, die man sich in Büro hängt. Auch Fotos von Preisverleihungen oder Diplomüberreichungen wirken stärkend auf die Selbstmotivation und Selbstwirksamkeit. Zu guter Letzt kann man seine Kollegen*innen, Führungskräfte, Freunde oder Familienangehörige dazu animieren, regelmäßig lobende und aufbauende Worte auszusprechen. Weg vom „Nicht geschimpft ist schon gelobt genug!“, und hin zu „Nicht gelobt ist schon geschimpft genug!
2.2 Natürliche Belohnungsstrategien
Die natürlichen Belohnungsstrategien bilden das Herzstück des Self-Leadership. Sie zielen auf die intrinsische Motivation ab, also die Motivation aus sich selbst heraus. Diese ist stark davon abhängig, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und bewerten. Anstatt destruktiver Elemente („Da ich immer nervös bin, schaffe ich keine ordentliche Präsentation.“) ist ein positiver Fokus der Aufmerksamkeit empfehlenswert: „Ich werde mich gut vorbereiten, und eine tolle Präsentation halten!“. Ebenso versucht man bei der Erfolgsvisualisierung sich im Hier und Jetzt vorzustellen, dass man das Ziel schon erreicht hat: „Ich halte gerade eine ausgezeichnete Präsentation.“
Positiver Fokus & Entwicklung der Aufmerksamkeit
Ein und dieselbe Situation kann positiv oder negativ bewertet werden. Die Bewertung ist stark von der jeweiligen Aufmerksamkeit (und auch Achtsamkeit) abhängig. Man kann die destruktiven, negativ bewerteten und unwichtigen Dinge in den Mittelpunkt stellen. Oder man lernt mit den „negativen“ Aspekten umzugehen, und konzentriert sich auf die positiven und konstruktiven Dinge. Damit ist nicht gemeint das Negative einfach auszublenden, und das Positive übermäßig zu verstärken. Denken Sie einfach an einen Bergkletterer. Variante 1: Er blendet das Negative (z.B. Absturzgefahr) aus, weil er von seinen Kletterkünsten überzeugt ist. Daher verzichtet er auf sämtliche Schutzausrüstungen. Oder Variante 2: Er nimmt die Risiken bewusst wahr, und nimmt seine gut gewartete Schutzausrüstung mit. Somit kann er sich voll und ganz auf seine Stärken im Klettern konzentrieren.
Für das Einstellen des positiven Fokus kann man sich die ABC-Methode aus der kognitiven Verhaltenstherapie zu Nutze machen. Das A steht für die Situation bzw. Aufgabe, das B für die kognitive Bewertung und das C für das Verhalten.
Praxisbeispiel 1: ABC-Methode
Nehmen wir als Beispiel (A) einen Bergwanderer, der eine Wanderung zu einer Berghütte machen will. In der destruktiven Variante drängen sich Ängste und alles was schief gehen könnte bei der Bewertung (B) in den Mittelpunkt:
„Ich werde wahrscheinlich den Weg nicht finden.“
„Wahrscheinlich habe ich zu wenig Wasser dabei.“
„Der Weg wird zu steil und zu schwierig sein.“ usw.
In Folge erwartet man sich von der Wanderung nichts Gutes. Entsprechend negativ sind die Erwartungen für das Verhalten (C)
„Ich glaube nicht, dass ich es zur Berghütte schaffe.“
„Ich werde umkehren müssen, weil ich zu wenig Wasser habe und der Weg zu steil ist.“
Wenn man sich auf den positiven Fokus konzentriert, sucht man konstruktive Erklärungsversuche (B):
„Ich habe mir die Route genau angeschaut, und kann mich gut vorbereiten.“
„Ich habe genug Wasser eingepackt. Zudem habe ich rausgefunden, dass es unterwegs einige Trinkstellen gibt.“
„Ich habe mir eine Wanderkarte gekauft, falls das Navi ausfällt oder kein Signal bekommt.“
Auf die funktionale Bewertung (B) folgen positive Verhaltenserwartungen (C):
„Der Schwierigkeitsgrad passt gut zu meiner Kondition und meiner Erfahrung im alpinen Gelände.“
„Da ich mich gut vorbereitet habe, kann ich die Natur bei der Wanderung genießen“
Sowohl innere (Gedanken, Einstellungen, Werte) und äußere Reize (Situation, Kontext, Aufgabe) beeinflussen unsere Emotionen und unser Verhalten. Gedanken können als Schlüssel zur Veränderung der Situationswahrnehmung gesehen werden. Das ABC-Modell nutz die kognitive Umstrukturierung. Dysfunktionale und negative Gedanken sollen dabei abgeschwächt und durch funktionale Gedanken ersetzt werden.
Situationsmodifikation
Bei der Situationsmodifikation versucht man bewusst intrinsisch belohnende Aspekte zu fördern. Manchmal fällt es schwer, sich für eine Aufgabe zu motivieren. Und manchmal macht man eine Aufgabe nur weil man es machen muss, und ein anderes Mal geht’s ganz leicht von der Hand. Woran liegt´s, und was können wir tun?
Tab. 2: Stufen der Situationsmodifikation (Intrinsifizierung)
Externale Regulation
Durch Belohnung und Vermeidung von Strafen
Introjektion
Die Aufgabe selbst ist zwar mäßig interessant. Zweck der Aufgabe ist die Demonstration der eigenen Fähigkeiten, wodurch man sich wertvoller und z.T. stolz fühlt.
Identifikation
Das eigene Verhalten wird bereits als selbstbestimmt wahrgenommen. Die eigentliche Motivation ist noch auf das Ergebnis (Ruhm, Prestige, Geld) ausgerichtet.
Integration
Die Übereinstimmung zwischen den eigenen Bedürfnissen und der Aufgabe nimmt weiter zu, und man erlebt sich als sehr selbstbestimmt.
Intrinsische Motivation
Man identifiziert sich zu 100% mit der Aufgabe und geht voll und ganz in ihr auf. Flow-Erleben begünstigen Kreativität und Innovation.
Von externer Regulation spricht man bei Aufgaben und Tätigkeiten, die man tun muss, weil man sonst mit negativen Konsequenzen zu rechnen hat. Man macht die Steueroder Rechnungsüberweisung am letztmöglichen Zeitpunkt, um Mahngebühren zu verhindern. In manchen Onlineshop wird man erfolgreich mit Belohnungen zum Kaufen verleitet: „Heute 10 Bonuspunkte“. Externe Regulation, und damit auch die externale Motivation, basiert auf der Vermeidung von Strafen und Sanktionen sowie in Aussicht gestellte Belohnungen.
In der zweiten Stufe der Introjektion ist die Aufgabe zwar immer noch mäßig interessant, jedoch erhält man dabei die Möglichkeit eigene Kompetenzen zur Schau zu stellen. „Ich schreibe diesen Projektbericht, um zu zeigen, dass ich das Abrechnungssystem und das Layouten von Berichten beherrsche.“
In der Stufe der Identifikation wird das eigene Handeln bereits als selbstbestimmt wahrgenommen. Die Motivation wird jedoch noch weitgehend vom Ergebnis bestimmt. „Wenn ich den Bericht bis übermorgen schreiben kann, werden mich aufgrund der komplexen Voraussetzungen alle bewundern.“ „Durch die höheren Verkaufsabschlüsse kann ich mit einer Bonuszahlung rechnen.“
In der Integrationsphase wird die Aufgabenerfüllung mit den eigenen Bedürfnissen verknüpft. Man erlebt die Aufgabenerfüllung vermehrt als sinnvolle Tätigkeit die den eigenen Werten und Bedürfnissen entspricht: „Eigentlich freue ich mich schon auf ein nettes Gespräch mit meiner Kundin.“
Wenn die intrinsische Motivation vollends ausgeprägt ist, identifiziert man sich vollkommen mit der Aufgabe und man erlebt sich als sehr selbstbestimmt: „Das ist genau meins.“ In der Positiven Psychologie spricht man vom Flow-Erleben. Man befindet sich in einer Art Schaffensrausch und die Aufgabe geht leicht von der Hand. Je besser man seine Charakterstärken einsetzen kann, desto stärker ist die intrinsische Motivation ausgeprägt. (siehe Kapitel 8 Engagement & Flow)
Erfolgsvisualisierung
Bei der Erfolgsvisualisierung versucht man sich im HIER und JETZT vorzustellen, dass man das Ziel schon erreicht hat:
„Ich halte gerade eine ausgezeichnete Präsentation.“
Das Erinnern und Herbeirufen vergangener Erfolgserlebnisse kann dabei ebenso hilfreich sein: „Letzte Woche habe ich dieses Thema schon sehr gut präsentiert.“ Weiters kann man sich eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe vorstellen: „Nach der tollen Präsentation werden wir eine nette Diskussion haben. Und danach gibt´s ein paar leckere Snacks.“ Nutzen Sie dabei alle Sinneskänale (hören, sehen, riechen, fühlen) zur Stärkung der Erfolgsvisualisierung. Die Erfolgsvisualisierung spricht die mentale Vorstellungskraft, die inneren Bilder, an. Neurologisch könnte man sagen, man trainiert mit Hilfe der Spiegelneuronen.
2.3 Soziale Strategien
Zu den sozialen Self-Leadership-Strategien zählen die Gestaltung unserer Beziehungen sowie der Leistungsvergleich. Eine gelungene Gestaltung der Beziehungen zu Teammitgliedern oder Kollegen*innen kommt in Freude und Spaß am alltäglichen Tun zum Ausdruck. Die Basis dafür ist wertschätzendes und konstruktives Feedback. Wir vergleichen uns immer mit anderen, ob wir wollen oder nicht. Bewusst oder unbewusst messen wir uns an absoluten Standards, Gruppennormen und den eigenen Ansprüchen. Zu hohe Ansprüche an sich selbst, Perfektionsstreben und die Bereitschaft für Überstunden verstärken die Burnout-Gefahr.
Beziehungsgestaltung
Unter Beziehungsgestaltung ist in diesem Kontext, die Gestaltung der Zusammenarbeit gemeint. Wie man seine romantische Beziehung in der Partnerschaft bildet, ist zweifellos ein wichtiger Aspekt. Vielleicht der wichtigste im privaten und familiären Kontext, aber eben nicht der einzige.
Ein gelungene Beziehungsgestaltung kommt in Freude und Spaß am alltäglichen Tun zum Ausdruck. „Was brauche ich von meinen Kollegen*innen, Freunden*innen, … um gut arbeiten zu können?“ ist eine wichtige Frage an sich selbst. Dahinter verstecken sich die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen.





























