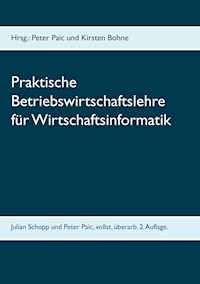
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neu im Internet unter www.wirtschaftsinformatik.cc und in der zweiten Auflage ist das stark erweiterte Angebot an Wiederholungs- und Übungsfragen. Darüber hinaus haben aktuelle Ereignisse aus der Ökonomie, wie die Finanzmarktkrise oder auch die Diskussion zum Wirtschaftswachstum Einzug gehalten. Ein neues Sachregister rundet das Angebot dieses praxisorientierten Lehrbuches ab und macht die Arbeit noch komfortabler. Zentrale Innovation dieser zweiten Auflage ist die methodische Erweiterung zur Wissensvermittlung. Jedes Kapitel spiegelt eine Vorlesungseinheit wider, welche durch Wiederholungsfragen und praktische Übungsaufgaben ergänzt und gefestigt wird. Neu ist hierbei unser Onlineangebot zur Wissensvermittlung. Unter www.oekonomiequiz.de bieten wir ein auf das Lehrbuch abgestimmtes Ökonomie-Quiz an. Hier können Sie Ihren Lernfortschritt, zugeschnitten auf die jeweiligen Kapitel, auf spielerische Art und Weise testen. Das kostenlose Angebot ermöglicht ein nachhaltiges und effektives Lernen mit Spaß. Das jetzt auf 340 Seiten angewachsene Lehrbuch orientiert sich am Curriculum deutscher Hochschulen für Wirtschaftsinformatik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort Fa. Kienbaum„Praktische Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsinformatik“
Die Informationstechnik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. IT durchdringt heutzutage sämtliche Bereiche – von Arbeits- und Produktionsprozessen bis hin zu Produkten und Dienstleistungen. Doch trotz der steigenden Durchdringung sowie einer auf allen Ebenen wachsenden Sensibilität für die voranschreitende Digitalisierung stellt die Einbettung der IT in die Unternehmenslandschaft für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Schließlich geht es nicht nur um die Einführung der Informationstechnologie als solcher, sondern vielmehr um die effiziente und vor allem nahtlose Verzahnung von IT und Business.
Dieser Brückenschlag zwischen IT und Business erfordert ein Umdenken. In der Vergangenheit bestand die Aufgabe der Informationstechnologie darin, als effizienzsteigernder „Erfüllungsgehilfe“ dem proprietären Unternehmensgeschäft beiseite zu stehen. Führungskräfte hatten in der Regel keine IT-Affinität und die Informations-technologie diente dem primären Zweck, Kosten zu senken. Die Rolle, die zukünftig von IT eingenommen wird, entspricht vielmehr der eines in alle Geschäftsbereiche eingebetteten Wertschöpfungstreibers, dessen Qualität neben der Sicherstellung des IT-Betriebs darin liegen muss, unternehmerische Potenziale zu erkennen und diese in Abstimmung mit den Fachbereichen umzusetzen. Nur so werden Unternehmen Synergien schaffen, dem durch kürzer werdende Produktlebenszyklen steigenden Kosten- sowie Innovationsdruck gerecht werden und langfristig im Wettbewerb bestehen können.
Damit dies gelingen kann, wird von Führungskräften und Nachwuchsmanagern zukünftig verstärkt ein interdisziplinäres Wissen gefordert. Betriebs- und Volkswirte werden nicht mehr um eine gewisse IT-Affinität herumkommen. Ebenso müssen aber auch Informatiker und IT-Spezialisten über den Tellerrand hinausschauen und sich mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Prozessen vertraut machen. Für die Symbiose aus IT und Business sind schließlich eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis grundlegend. Neben den die Kommunikation betreffenden Faktoren dient eine gemeinsame Wissensbasis aber auch dem Schaffen von Akzeptanz und Bereitschaft. Akzeptanz neue Lösungsansätze und Verfahren zuzulassen und Bereitschaft, diese auch gemeinsam umzusetzen.
Mit dem vorliegenden Lehrbuch ist es Herrn Dr. Peter Paic und seinen Mitstreitern Frau Kirsten Bohne und Herrn Julian Schopp auf beeindruckende Weise gelungen, die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und Methoden in verständlicher Weise und abgestimmt auf die Bedürfnisse von Wirtschaftsinformatikern, Informatikern und IT-Spezialisten darzustellen. Die Firma Kienbaum freut sich sehr, die künftigen Arbeitnehmer/-innen und Führungskräfte mit diesem Buch unterstützen zu können.
Düsseldorf im September 2016
Kienbaum Management Consultants GmbH
Johannes Schlosser, Director / Mitglied der Geschäftsleitung
Vorwort zur zweiten vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage
Ich freue mich dass Sie unsere zweite vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage „Praktische Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsinformatik“ in Händen halten.
Dank der Rückmeldungen unserer Leser konnten wir viele wertvolle Anregungen aufgreifen. Dazu gehört eine Vielzahl an neuen Wiederholungs- und Übungsfragen oder die vollkommen neu überarbeiteten Kapitel „Einführung in die Ökonomie“ und „Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung“. Auch aktuelle Ereignisse aus der Ökonomie, wie der Diskurs über den Zusammenhang der Vermögensverteilung und dem Wirtschaftswachstum sowie die Finanzmarktkrise fanden Berücksichtigung. Ein neu eingerichtetes Sachregister rundet das Angebot dieses praxisorientierten Lehrbuches ab und macht die Arbeit komfortabler.
Das Ökonomie-Quiz unter www.bwl-wirtschaftsinformatik.de ist die zentrale Neuerung dieser zweiten Auflage. Spiegelt jedes Kapitel im Buch eine Vorlesungseinheit wider, die durch Wiederholungsfragen und Übungsaufgaben ergänzt werden, erweitert hier ein Ökonomie-Quiz das methodische Vorgehen. Mit dem eng an dem Lehrbuch abgestimmten Online-Quiz, können Sie Ihren Lernfortschritt, passgenau auf das jeweilige Kapitel in spielerische Art und Weise testen. Das kostenlose Ökonomie-Quiz ermöglicht ein nachhaltiges und effektives Lernen mit Spaß.
Diese Weiterentwicklung des Lehrbuches lebt von der Begeisterung und dem ehrenamtlichen Engagement aller Beteiligten in ihrer Freizeit. Mein besonderer Dank gilt hier insbesondere den Studierenden Patrick Vaccaro und Nils Fischer aus dem Grundkurs Wirtschaft 1 der Hochschule Ruhr-West sowie dem Programmierer Reiner Pappers für die inhaltliche und technische Realisierung des Ökonomie-Quiz. Gleichfalls bedanken möchte ich mich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei Julian Schopp und Kirsten Bohne. Mit Unterstützung der Fa. Kienbaum konnten wir erste wichtige Schritte zur methodischen Weiterentwicklung realisieren. An dieser Stelle möchte ich Herrn Johannes Schlosser für diese Unterstützung danken.
Marienthal an der Issel im September 2016
Dr. Peter Paic
Vorwort zur ersten Auflage
Die Idee zu diesem Lehrbuch entstand in den Vorlesungen zum Grundkurs Wirtschaft I für Wirtschaftsinformatiker an der Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr am Campus Bottrop.
Warum gibt es dieses Lehrbuch für Wirtschaftsinformatiker? Die in der Tat zahlreich vorliegenden Abhandlungen - sowohl in der Betriebswirtschaftslehre als auch in der Informatik - greifen selten das Spektrum beider Disziplinen auf. Die existierenden interdisziplinären Werke konzentrieren sich meist auf den Kontext der Projektarbeit.
Ein praxisbezogenes Einstiegswerk, das adäquat auf die Anforderungen von Wirtschaftsinformatikern an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaftslehre und Informationstechnik zugeschnitten ist, fehlt.
So entstand das vorliegende Werk „Praktische Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsinformatiker“, ein speziell für Wirtschaftsinformatiker zugeschnittenes Lehrbuch, das erste ökonomische Zusammenhänge aufgreift und die praxisbezogene Lücke zwischen Betriebswirtschaftslehre und Informationstechnik schließt.
Die Inhalte und Anforderungen orientieren sich an dem Curriculum für Wirtschaftsinformatiker an den deutschen Hochschulen. Ein Ziel dieses Lehrbuches ist es, auch Neulingen und Seiteneinsteigern die Welt der Wirtschaft und speziell der Betriebswirtschaftslehre von Anfang an näherzubringen. Dieser Ansatz wird getragen von einem Lehrkonzept, dessen roter Faden auch dem Fachfremden erlaubt, sich sukzessive und zielorientiert in die zentralen ökonomischen Fragestellungen einzuarbeiten und darauf aufbauend komplexere betriebswirtschaftliche Fragestellungen im IT-Umfeld zu lösen.
Dieses Buch eignet sich somit nicht nur für die studierenden Wirtschaftsinformatiker, sondern insbesondere auch für Informatiker, Selbstständige oder Freelancer, die sich ohne Vorkenntnisse in betriebswirtschaftliche Fragestellungen einarbeiten möchten.
Das methodische Konzept fußt auf drei Säulen: Die erste Säule bilden die vielfältigen Anregungen und Kritiken der Studierenden aus den Vorlesungen zur Wirtschaft an der Hochschule Ruhr-West. Ihre Anmerkungen hatten einen wichtigen Einfluss auf die Entstehung und Ausrichtung des Lehrbuches, sowohl hinsichtlich der Methodik als auch der Didaktik. Die zweite Säule bildet die Praxis. Im Mittelpunkt stehen hier die vielfältigen beruflichen Erfahrungen innerhalb der Informationstechnik kombiniert mit den betriebswirtschaftlichen Anforderungen moderner Unternehmen. Diese praxisbezogene Kombination der Kenntnisse zwischen Informatik und Wirtschaft ist zentraler Inhalt des Bachelorstudiums.
Dritte Säule ist die methodische Aufbereitung des Lehrstoffes. Die einzelnen Kapitel spiegeln Vorlesungseinheiten wider, welche durch Wiederholungsfragen und Übungen ergänzt und gefestigt werden. Somit kann der aufgenommene Stoff besser verarbeitet werden und mit den praktischen Übungen wird die Entwicklung eigener Lösungsansätze gefördert.
Der vorliegende Band ist der erste von zwei Teilen und behandelt die Grundlagen der Wirtschaft von der historischen Entwicklung über zentrale moderne volkswirtschaftliche Annahmen, das interne und externe Rechnungswesen sowie die Investitionsrechnung bis hin zum Gründungsmanagement.
Der zweite Band orientiert sich an dem Kurs Wirtschaft II mit den Schwerpunkten Mikro- und Makroökonomie, Organisation, Marketing und Vertrieb sowie Personalwesen.
Meinen herzlichen Dank möchte ich insbesondere Herrn Prof. Dr. Marc Jansen, Leiter des Instituts für Informatik an der Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr und Bottrop aussprechen. Seine Unterstützung und aktive Förderung des Lehrbuchprojektes haben wesentlich zum Gelingen und Erscheinen dieses Bandes beigetragen.
Bedanken möchte ich mich auch für die zahlreichen Ideen und ihr unterstützendes Engagement, insbesondere in den Anfangsmonaten, bei Björn Wenzel und Lena Scharre. Für das Lektorat, die wertvolle Kritik und viele Anregungen bedanke ich mich bei Kirsten Bohne.
Mein besonderer Dank gebührt meinem Koautor Julian Schopp. Mit seinem Verständnis, seiner Kreativität und seinem unermüdlichen Einsatz hat er einen maßgeblichen Anteil am Gelingen dieses Werkes.
Marienthal an der Issel im Oktober 2014
Dr. Peter Paic
Inhaltsverzeichnis
1. Ökonomie
1.1 Einführung in die Ökonomie
1.2 Meilensteine des ökonomischen Denkens
1.3 Individuelle Entscheidungsprozesse
1.4 Gruppenspezifische Entscheidungsprozesse
1.5 Wie die Volkswirtschaft funktioniert
1.6 Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen
1.6.1 Von der Subprime-Krise zur europäischen Schuldenkrise
1.6.2 Verteilung und Wirtschaftswachstum
2. Betriebliches Rechnungswesen
2.1 Einführung in das Rechnungswesen
2.1.1 Adressatenkreise des Rechnungswesens
2.1.2 Aufgabe und Funktionen des Rechnungswesens
2.1.3 Bereiche des Rechnungswesens
2.2 Das externe Rechnungswesen – Inventur, Inventar, Bilanz
2.2.1 Die Inventur
2.2.2 Inventurverfahren (zeitlich)
2.2.3 Inventurmethoden (mengenmäßig)
2.2.4 Das Inventar
2.2.5 Die Bilanz
2.3 Die doppelte Buchführung
2.3.1 Erfolgsneutrale Geschäftsvorfälle
2.3.2 Instrumente der doppelten Buchführung
2.3.3 Eröffnung und Abschluss der Konten
2.3.4 Erfolgsbuchungen
2.4 Grundbegriffe des Rechnungswesens
2.5 Rechtliche Grundlagen der Buchführung
3. Jahresabschlussanalyse
3.1 Finanzwirtschaftliche Analyse
3.1.1 Investitionsanalyse
3.1.2 Finanzierungsanalyse
3.1.3 Liquiditätsanalyse
3.2 Erfolgswirtschaftliche Analyse
3.2.1 Rentabilitätsanalyse
3.2.2 Aufwandsstrukturanalyse
3.2.3 Bewertung der Analyseergebnisse
4. Kosten- und Leistungsrechnung
4.1 Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung
4.2 Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
4.2.1 Einzel- und Gemeinkosten
4.2.2 Variable und fixe Kosten
4.3 Abrechnungsprozess der Kosten
4.4 Kostenrechnungssysteme
4.5 Grundprinzipien der Kosten- und Leistungsrechnung
4.6 Die Kostenartenrechnung
4.6.1 Materialkosten
4.6.2 Personalkosten
4.6.3 Kalkulatorische Kosten
4.7 Die Kostenstellenrechnung
4.7.1 Gliederungskriterien für Kostenstellen
4.7.2 Kostenstellenrechnung mittels Betriebsabrechnungsbogen
4.8 Kostenträgerrechnung
4.8.1 Kostenträgerstückrechnung
4.8.2 Kostenträgerzeitrechnung
4.9 Teilkosten- und Deckungsbeitragsrechnung
4.9.1 Einstufige Deckungsbeitragsrechnung (Direct Costing)
4.9.2 Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
5. Investitionsrechnung
5.1 Einführung in die Investitionsrechnung
5.2 Statische Verfahren der Investitionsrechnung
5.2.1 Rechnungsgrößen der statischen Investitionsrechnung
5.2.2 Kostenvergleichsrechnung
5.2.3 Gewinnvergleichsrechnung
5.2.4 Rentabilitätsrechnung
5.2.5 Amortisationsrechnung
5.3 Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung
5.3.1 Kapitalwertmethode
5.3.2 Annuitätenmethode
5.3.3 Methode des internen Zinssatzes
5.3.4 Dynamische Amortisationsrechnung
5.4 Nicht-monetäre Verfahren der Investitionsrechnung
6. Gründungsmanagement
6.1 Was ist Gründungsmanagement?
6.1.1 Persönliche Eigenschaften und Umfeld des Gründers
6.1.2 Gründungsformen
6.1.3 Gründungsphasen
6.1.4 Gründungsidee und Kreativitätstechniken
6.2 Der Gründungsplan
6.3 Der Businessplan
6.3.1 Die Beschreibung des Gründungsvorhabens
6.3.2 Der Marketingplan
6.3.3 Der Managementplan
6.3.4 Der Finanzplan
7. Lösungen der Wiederholungsfragen
7.1 Wiederholungsfragen Kapitel 1.1
7.2 Wiederholungsfragen Kapitel 1.2
7.3 Wiederholungsfragen Kapitel 1.3
7.4 Wiederholungsfragen Kapitel 1.4
7.5 Wiederholungsfragen Kapitel 1.5
7.6 Wiederholungsfragen Kapitel 1.6
7.7 Wiederholungsfragen Kapitel 2.1
7.8 Wiederholungsfragen Kapitel 2.2
7.9 Wiederholungsfragen Kapitel 2.3
7.10 Wiederholungsfragen Kapitel 2.4
7.11 Wiederholungsfragen Kapitel 2.5
7.12 Wiederholungsfragen Kapitel 3
7.13 Wiederholungsfragen Kapitel 4.1 und 4.2
7.14 Wiederholungsfragen Kapitel 4.3 bis 4.5
7.15 Wiederholungsfragen Kapitel 4.6
7.16 Wiederholungsfragen Kapitel 4.7
7.17 Wiederholungsfragen Kapitel 4.8
7.18 Wiederholungsfragen Kapitel 4.9
7.19 Wiederholungsfragen Kapitel 5
7.20 Wiederholungsfragen Kapitel 6.1
7.21 Wiederholungsfragen Kapitel 6.2
7.22 Wiederholungsfragen Kapitel 6.3
8 Lösungen der Übungsaufgaben
9 Abbildungsverzeichnis
10 Literaturverzeichnis
11 Register
1. Ökonomie
„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein.
Die öffentlichen Schulden müssen verringert
werden. Die Arroganz der Behörden muss
gemäßigt und kontrolliert werden.
Die Zahlungen an ausländische Regierungen
müssen reduziert werden, wenn der Staat
nicht Bankrott gehen will.“
Marcus Tullius Cicero, Röm. Schriftsteller und Politiker, 106 – 43 v.Chr.).
Die Ökonomie beschäftigt die Menschheit seit jeher. Wie das Beispiel Ciceros zeigt, haben damalige Fragestellungen über die Jahrtausende nichts an Aktualität eingebüßt.
Opfert man einen ganzen Tag mit der Jagd auf Mammuts oder nutzt man die Zeit um Hirschen nachzustellen? Man könnte allerdings auch die Gruppe aufteilen und sich mit beidem beschäftigen. Allein das Abwägen solcher Fragestellungen kann schon als ökonomisches Denken gewertet werden.
Die Grundannahmen ökonomischen Denkens hatten einen ersten Kristallisationspunkt in der klassischen Zeit Griechenlands und entwickelten sich im Laufe der Zeit fort. Von den ersten Ansätzen in Mesopotamien vor ca. 3000 Jahren bis zum Beginn der ersten industriellen Revolution bis zu Adam Smith, widmen wir uns ihrer historischen Entwicklung und den begrifflichen Definitionen.
Wir betrachten die Rolle der Individuen in einer Volkswirtschaft von der Wahl und dem Abwägen von Alternativen über die Betrachtung von Opportunitätskosten bis hin zur rationellen Entscheidungsfindung und der Wirkung von Anreizen. Dem schließen sich ökonomische Fragestellungen von Gruppen und Organisationen innerhalb der Gesellschaft an. Ist der Handel vorteilhaft für die Gesellschaft? Wie sieht die ideale Marktform aus und darf der Staat intervenieren?
Im dritten Teil betrachten wir die Funktion einer Volkswirtschaft und ihrer Einflussgrößen auf den Wohlstand ihrer Bewohner, den Messgrößen einer Volkswirtschaft, wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und auf das Wirtschaftswachstum.
Erörtert werden die Bedeutung der Preise und des Geldumlaufs im Monetarismus sowie aktueller Fragestellungen im europäischen Kontext bis hin zum Konjunkturzyklus und dem gesellschaftlichen Zielkonflikt zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit.
Abschließend gehen wir auf aktuelle ökonomische Entwicklungen ein. Dazu zählen die Entwicklung von der US Subprime-Krise bis zur europäischen Schuldenkrise sowie die zunehmend ungleiche Verteilung der Einkommen und Vermögen als ein Hemmnis für das Wirtschaftswachstum.
Lernziele:
Sie kennen die Bedeutung und wissenschaftliche Einordnung der Ökonomie.Sie kennen die Meilensteine in der Geschichte des ökonomischen Denkens.Sie kennen die Grundlagen individueller Entscheidungsprozesse in einer Volkswirtschaft.Sie kennen die gruppendynamischen Grundlagen des ökonomischen Zusammenwirkens in einer Gesellschaft.Sie kennen die Funktion einer volkswirtschaftlichen Gesamtwirtschaft.Sie kennen die Ursachen, Hintergründe und Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008.Sie kennen die aktuelle Diskussion über die Einkommens- und Vermögensverteilung als eine mögliche Ursache ausbleibenden Wirtschaftswachstums.1.1 Einführung in die Ökonomie
Der antike griechische Haushalt gilt als Keimzelle des ökonomischen Denkens. So leitet sich der Begriff „Ökonomie“ vom griechischen „Oekonomicus“ ( oikos, „das Haus“ und nomos, „Gesetz“ oder „Regel“) ab und bedeutet so viel wie „kluge Hauswirtschaftsführung“ (Schumpeter 1954, S. 90).
In einem privaten Haushalt sind wichtige ökonomische Entscheidungen zu treffen. Dies betrifft die Wahrnehmung der zu erledigenden Haushaltsaufgaben sowie die Verwendung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Bei den Haushaltsaufgaben geht es darum, die zu erledigen Aufgaben auf die Mitglieder zu verteilen und festzulegen, wer beispielsweise im Haushalt die Reinigung, die Essenszubereitung, den Einkauf oder die Reparatur des Hauses übernimmt.
Ebenso müssen im Haushalt Entscheidungen über die Verwendung der nur begrenzt vorhandenen finanziellen Mittel getroffen werden. Welche finanziellen Ressourcen sollen für Nahrung, Kleidung, Werkzeuge oder Bildung aufgebracht werden? Die Wahl und die Entscheidung über den Einsatz der personellen und der Verwendung der finanziellen Ressourcen finden auch unter der Berücksichtigung der Fähigkeiten und Wünsche der Haushaltsmitglieder statt.
Definition Ökonomie:
„Ökonomie ist die Lehre von der Verwertung und Verteilung knapper Güter. Knapp ist jedes Gut, für das es mehr Verwertungs- oder Konsumwünsche gibt als Chancen, es zu bekommen.“
Quelle: Blankertz 2005, S. 7.
Dieses ökonomische Prinzip aus dem privaten Haushalt lässt sich ebenso auf Städte, Länder oder die Welt übertragen. Die bestmögliche Bedürfnisbefriedigung vollzieht sich im privaten Haushalt nach den gleichen Prinzipien wie in der gesamten Gesellschaft. Auch hier werden Aufgaben und Arbeiten verteilt und es muss mit dem begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen (z. B. Geld) „gehaushaltet“ werden.
Die Gesellschaft steht vor der grundlegenden Entscheidung, wer Geld für welche Dienstleistung oder Ware bekommt. Gregory Mankiw, US-amerikanischer Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Harvard University, formuliert zugespitzt: „Die Gesellschaft muss darüber entscheiden, wer Kaviar isst und wer Kartoffeln.“ (Mankiw und Taylor 2012, S.3.).
Die Entscheidung über die Verteilung der Güter ist sehr bedeutsam, da nur die wenigsten unendlich vorhanden sind. Das hehre Wunschziel der Ökonomie, Güter so aufzuteilen, dass auch die knappen Bestände gerecht verteilt sind, wird nur selten erreicht. Der Begriff der „Ökonomie“ oder „Wirtschaft“ umfasst die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen. Welche Wünsche befriedigt werden, also die Entscheidung über die Zuordnung von knappen Ressourcen auf die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, nennt man in der Ökonomie „Allokation“.
Vorsicht: Die Informatik versteht unter dem Begriff der Allokation die Reservierung von Hauptspeicher oder anderen Ressourcen.
Den Rahmen ökonomischen oder auch wirtschaftlichen Handelns setzen die beteiligten Einrichtungen, ihre wirtschaftlichen Handlungen, geografische und institutionelle Aspekte sowie das menschliche Handeln.
Zu den wirtschaftlichen Einrichtungen gehören:
Unternehmen
private Haushalte
öffentliche Haushalte (Staat)
Zu den Grundlagen wirtschaftlichen Handelns zählen:
Herstellung von Gütern
Umlauf und Verteilung von Gütern
Verbrauch von Gütern
Wirtschaftliches Handeln findet zum Beispiel statt auf:
weltwirtschaftlicher Ebene
volkswirtschaftlicher Ebene
regionalwirtschaftlicher Ebene
betriebswirtschaftlicher Ebene
Wirtschaftliche Aktivitäten des Menschen:
Planmäßige und effiziente Entscheidung über knappe Ressourcen mit dem Ziel einer bestmöglichen Bedürfnisbefriedigung.
Gegenstand einer Volkswirtschaft ist die Ökonomie oder die Wirtschaft eines Volkes, d. h. die Gesamtheit aller in einem Staat lebenden Menschen und Unternehmen. Sowohl die Volks- als auch die Betriebswirtschaft basieren auf den Grundannahmen der Ökonomie: „Güter sind knapp und erfordern einen dementsprechenden ökonomischen Umgang“ (Mankiw und Taylor 2012, S. 3.).
Definition Volkswirtschaft:
Allgemein beschreibt der Begriff „Volkswirtschaft“ den Wirtschaftsraum eines Staates mit den ihm zugeteilten Wirtschaftssubjekten wie Haushalte, Unternehmen und Staat. Die „Volkswirtschaftslehre“ behandelt die Wissenschaft von der Bewirtschaftung knapper gesellschaftlicher Ressourcen.
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 3.
Die betriebswirtschaftliche Ebene nimmt die Perspektive eines Betriebes oder Unternehmens ein. Ziel der Betriebswirtschaftslehre ist die Beschreibung, Erklärung und Unterstützung von Entscheidungsprozessen in Unternehmen. Im Fokus stehen Aspekte des unternehmerischen Handelns hinsichtlich der Funktionsbereiche Produktion, Absatz, Investition und Finanzierung sowie dem Rechnungswesen.
Definition Allgemeine Betriebswirtschaftslehre:
„Die Bezeichnung Allgemeine Betriebswirtschaftslehre zielt auf jeden Teil der Betriebswirtschaftslehre, der sich mit den übergreifenden Aspekten des unternehmerischen Handelns befasst. So setzt sich die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre aus verschiedenen Sachfunktionslehren wie Produktion, Investition und Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Marketing zusammen.“
Quelle: Gablers Wirtschaftslexikon 2015
Günter Wöhe differenziert die unternehmerischen Entscheidungen in konstitutive Entscheidungen (Wahl der Rechtsform, Standortwahl oder Liquidation) und Ablaufentscheidungen (Produktions-, Absatz- und Finanzierungsentscheidungen), sowie einer prozessorientierten Unternehmensführung hinsichtlich: Unternehmensziele, Planung und Entscheidung, Organisation, Personalwirtschaft, Kontrolle und Informationswirtschaft. Nach Wöhe besteht der Hauptteil einer unternehmerischen Tätigkeit vorrangig aus Planungen und Entscheidungen“ (Wöhe 2010, S. 25 ff.).
Insbesondere der Zielsetzung eines praxisbezogenen- und unternehmerischen Handelns wollen wir mit dem vorliegenden Buch „Praktische Betriebswirtschaftslehre für Wirtschaftsinformatik“ nachkommen. Neben ausgewählten Sachfunktionen wie dem Rechnungswesen, Investition und Finanzierung verfolgt das Buch die Zielsetzung, grundlegende Beschreibungen und Erklärungen über die Funktion der Betriebswirtschaftslehrein Unternehmen aus Perspektive der Wirtschaftsinformatik darzulegen.
Abbildung 1: Einordnung der Betriebswirtschaft in die Wissenschaften
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wöhe 2010, S. 40.
Die Betriebswirtschaftslehre wird wie die Volkswirtschaftslehre als zweites Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften den Sozialwissenschaften zugeordnet. Die Abbildung 1 zeigt die Verzweigung aus den Wissenschaften zur Volks- und Betriebswirtschaft über die Realwissenschaften, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften auf.
Angrenzende Wissenschaften sind aus der Soziologie die Betriebs- und Arbeitssoziologie sowie aus der Psychologie die Wirtschafts- und die Sozialpsychologie. Zur besseren Übersicht werden angrenzende Wissenschaftszweige vereinfacht dargestellt.
In der Gesamtschau reichen die Erklärungsansätze der Ökonomie aber auch über die Gesichtspunkte der Güterverteilung hinaus. Unter der Prämisse: „Die Ökonomik befasst sich mit Möglichkeiten und Problemen der gesellschaftlichen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil“ (Homann und Suchanek 2005) entwickeln Homann und Suchanek ökonomische Grundannahmen und Verhaltensweisen weiter. Sie definieren daraus eine „individuelle Vorteils-Nachteils-Kalkulation“, aber sie sind auch davon überzeugt, dass diese Definition noch weit über den „Bereich der Wirtschaft“ hinausgeht und auch in Bereichen wie Kriminalität, Politik und Bürokratie, aber auch dem Heiraten Anwendung findet.
Zusammenfassung
Ökonomie ist die Lehre von der Verwertung und Verteilung knapper Güter. Knapp ist jedes Gut, für das es mehr Verwertungs- oder Konsumwünsche gibt als Möglichkeiten, es zu erlangen. Der Begriff der „Ökonomie“ oder auch „Wirtschaft“ umfasst die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen.
Zu den wirtschaftlichen Einrichtungen gehören Unternehmen, private und öffentliche Haushalte. Zu den Handlungen des Wirtschaftens zählen Herstellung, Verbrauch, Umlauf und Verteilung von Gütern. Solche Zusammenhänge bestehen zum Beispiel auf welt-, volks-, stadt- und betriebswirtschaftlicher Ebene. Unter der Prämisse einer optimalen Bedürfnisbefriedigung entscheidet das Individuum planvoll und effizient über die knappen Ressourcen.
Die Volkswirtschaft definiert sich als Wirtschaftsraum eines Staates mit dem ihm zugeteilten Wirtschaftsobjekten wie Haushalten, Unternehmen und Staat.
Die Betriebswirtschaftslehre konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Aspekte eines Unternehmens hinsichtlich Führung, Organisation, Steuerung sowie der technischen und finanziellen Abläufe eines Betriebes. Innerhalb der Wissenschaften leitet sich die Betriebswirtschaftslehre von den Real- über die Sozial- und die Wirtschaftswissenschaften zur Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ab.
Wiederholungsfragen
Erläutern Sie den Begriff der „Ökonomie“
Welchen ökonomischen Zusammenhang gibt es zwischen einem privaten Haushalt und der Volkswirtschaft?
Welche Grundlegende Entscheidung muss eine Gesellschaft nach der Aussage von Mankiw und Taylor treffen?
Welches Prinzip verbirgt sich hinter dem Begriff der „Allokation“?
Welche wirtschaftlichen Einrichtungen, die den Rahmen des ökonomischen Handelns setzen, kennen Sie?
Woraus setzen sich die Grundlagen wirtschaftlichen Handelns zusammen?
Nennen Sie drei Beispielebenen wirtschaftlichen Handelns.
Erläutern Sie die Begrifflichkeiten
Betriebswirtschaft
und
Volkswirtschaft
.
Worin unterscheidet sich die Betriebswirtschaft von der Volkswirtschaft?
Wie ist die Betriebswirtschaftslehre in den Kontext der Wissenschaften einzuordnen?
Literatur:
Blankertz, Stefan (2005): Kritische Einführung in die Ökonomie des Sozialstaates.
Gabler Wirtschaftslexikon (2015): Stichwort: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Springer Gabler Verlag (Hrsg.). Onlineabruf am 18.11.2015: http://wirtschaftslexikon.Gabler.de/Archiv/72054/allgemeine-betriebswirtschaftslehre-sachgebietstext-v6.html.
Homann, Karl und Suchanek, Andreas (2005): Ökonomie Eine Einführung, Mohr Siebeck Tübingen.
Mankiw, N. Gregory und Taylor, Mark P. (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag. Stuttgart.
Wöhe, Günter und Döring, Ulrich (2010): Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 24. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München.
Schumpeter, Joseph (1954): Geschichte der ökonomischen Analyse. Band 1; Vandenhoeck & Ruprecht, Deutsche Ausgabe von 1964 in der Neuauflage von 2007, Göttingen.
1.2 Meilensteine des ökonomischen Denkens
Die Ökonomie entwickelt sich als Wissenschaft in einem relativ kurzen Zeitraum mit dem Beginn der ersten industriellen Revolution zwischen der Mitte des 17. und dem Ende des 18. Jahrhunderts. Mit der Veröffentlichung von Adam Smiths „Wealth of Nations“ (1776) wurde der Grundstein für das moderne ökonomische Denken gelegt (Schumpeter 1954, S. 90).
Wir werfen einen Blick zurück, von den Anfängen der menschlichen Kultur im Zweistromland und des ökonomischen Denkens bis zu Adam Smith. Für die Betrachtung der historischen Entwicklung orientieren wir uns an der Vorgehensweise von Josef Schumpeter in seinem Werk „History of Economic Analysis“ (1954)1, und beginnen nach den ersten Spuren in Mesopotamien mit den Ansätzen ökonomischen Denkens in der griechischen Antike bei Platon und Aristoteles. Erweitert wird die historische Perspektive um wesentliche Meilensteine der betriebswirtschaftlichen Entwicklung.
Die ersten Spuren ökonomischen Handelns stammen aus Mesopotamien und finden sich auf ca. 3000 Jahre alten Keilschrifttafeln. Es handelt sich um zum Teil noch gültige Schuldscheine, die aus der Zeit 1073 bis 1056 vor Christus datieren (Stöckelhuber 2001, S.1). Die Keimzelle aller späteren Forschungen ist die griechische Wirtschaftslehre, wenngleich diese nie einen ebenso starken Einfluss auf unser heutiges Leben genommen hat wie die Überlieferungen in den naturwissenschaftlichen Bereichen wie beispielsweise in der Mathematik, Geometrie oder auch Astronomie (Schumpeter 1954, S.92).
Mit Xenophon (430–355 v. Chr.) und seinen Werken „Oikonomikos“ (Gespräch über die Haushaltsführung) und „De Vectigalibus“ (Mittel und Wege, dem Staat Geld zu verschaffen) erhalten wir einen ersten Eindruck über die damaligen Wirtschaftsverhältnisse. Bereits 380 v. Chr. beschrieb Xenophon in seiner Schrift „Oikonomikos“ Aspekte des Getreidehandels, der Arbeitsteilung und des unternehmerischen Gewinnstrebens. Diese ersten Beschreibungen waren insbesondere durch die Perspektive der Hauswirtschaftsführung geprägt (Schumpeter 1954, S. 93).
Mit Platon (427–347 v. Chr.) und Aristoteles (384–322 v. Chr.) halten erste Ansätze zur Betriebsführung und des ökonomischen Denkens Einzug. Platon mit seinen Werken „Politeia“ (Staat) und „Nomoi“ (Gesetz), Aristoteles mit „Politik“ und „Nikomachische Ethik“ haben bereits die Grundzüge der heutigen Ökonomie geprägt.
Während Platon einen, aus seiner Sicht, idealen Staat entworfen hat und Geld als „ein ‚Symbol‘ zur Erleichterung des Tausches“ ansah, hatte Aristoteles 350 v. Chr. bereits einen kritischen Ansatz zu diesem Thema: „Wenn aber Geld nicht mehr Mittel, sondern Zweck des Handelns ist, dann kommt es zur Gelderwerbskunst, der Chrematistik. Es geht dann nicht mehr darum, Gebrauchswerte zu tauschen, sondern um das Anhäufen von Geld.“ (Aristoteles: Polis)2. Seine Gedanken zu Geld und Zinsen, wie beispielsweise zur Gewinnorientierung, jederzeitigen Solvenz und Risikoverteilung waren lange Zeit prägend.
Die frühen Ansätze von Platon und Aristoteles blieben für lange Zeit die einzigen zu diesem Thema. In der mittelalterlichen Gesellschaft entwickelten sich die wirtschaftlichen Theorien kaum weiter. Eine mögliche Ursache dafür wird in der kirchlichen Haltung vermutet: „Die Kirche (hat) nie ein Paradies vor dem Tode versprochen, alles Denken war auf das ‚Jenseits’ ausgerichtet.“ (Ziegler 2008, S. 20).
Damit war das irdische Leben bedeutungslos im Vergleich zu dem, was einen nach dem Tod erwartete. Dementsprechend gab es auch keine wissenschaftlichen Bestrebungen, die ökonomische Grundordnung weiterzuentwickeln oder zu verändern (Schumpeter 1954, S. 114).
Im Jahre 1202 veröffentlichte Leonardo Fibonacci (1170–1240) mit seiner Schrift „Liber abbaci“, dass aus Indien stammende „dezimale Zahlensystem“. Sein Rechenbuch erschien in italienischer Sprache und wurde mit praktischen Beispielen aus dem Wirtschaftsleben veranschaulicht. Das Werk hatte einen großen Einfluss auf die italienischen Kaufleute, da sie mit den „indischen Zahlen“ besser und schneller rechnen konnten (Schumpeter 1954, S.).
Thomas von Aquin (1225–1274) nahm den kirchlichen Faden wieder auf und versuchte, die Lehre von Aristoteles mit der der Kirchenväter zu verbinden und beschäftigte sich in seiner „Summa Theologica“ unter anderem mit dem gerechten Preis (iustum pretium) und der Handelsspanne. Für ihn besitzen alle Güter einen „immanenten, inneren Wert“ (valor intrinsecus) nicht jedoch Geld, welches nur einen „aufgepfropften Wert“ (valor impositus) besitzt.
Ergo ist Geld für ihn lediglich ein Tauschmittel und der Geldzins wird als Wucher abgelehnt. Thomas von Aquin bejahte den Handel, sofern er dem Ausgleich mangelnder Waren zwischen Stadt und Land dient. Der Handel sei verwerflich, wenn er zu Lasten der Allgemeinheit geht oder die Schwächeren schädigt (Beutter 1989, S. 63 ff.; Schumpeter 1954, S. 126-139).
Weite Verbreitung fand das System der doppelten Buchführung von Luca Pacioli (1445–1517) in seinem Werk „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita“ (1494). Sein Werk beschrieb zwar nicht erstmalig das doppische System der Buchhaltung, doch erreichte es durch seine weite Verbreitung, dass dem Autor Pacioli die Erfindung der Doppik zugeschrieben wurde (Schumpeter 1954, S. 213). Mit dem Beginn der Reformation im 16. Jahrhundert beginnt auch die „Trennung von christlicher und ökonomischer Ethik. Traditionales wirtschaftliches Handeln wird durch rationales ökonomisches Handeln ersetzt“ (Ziegler 2008, S. 21).
Adam Smith (1723–1790) ging in die Geschichte als Vater der Nationalökonomie ein (Koesters 1985, S. 15). Smith veröffentlichte 1776 das Buch „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ und revolutionierte damit die gesamte Ökonomie. Smith gelang es die dato eher zerstreute Literatur zur Volkswirtschaftslehre systematisch zusammenzufassen und mit seinem Werk die Ökonomie als eigenständige Wissenschaft in der Gesellschaft zu etablieren.
Die Grundgedanken von Smith, die Freizügigkeit im Wirtschaftsleben (unsichtbare Hand), die Ablehnung eines staatlichen Dirigismus (Merkantilismus), seine Gedanken zum Lohn-Preis-Problem, zur Frage von Kapital und Zins oder zum Verhältnis vom natürlichen Preis und Marktwert der Waren haben Generationen von Nationalökonomen zu unzähligen Untersuchungen angeregt (Recktenwald 1978, S. 1 und Schumpeter 1954, S. 241). Am weitesten verbreitet sind seine Gedanken zur Arbeitsteilung, die er als „Spezialisierung von Aufgaben“ ansieht und die damit auch wieder auf den Tauschhandel von Gütern und Dienstleistungen zurückzuführen ist.
David Ricardo (1772-1823) entwickelte die Theorie der komparativen Kostenvorteile. In seinem 1817 veröffentlichten Buch „Principles of Political Economy and Taxtation“ begründet er das „ricardianische Außenhandelsmodell“. Demnach lohnt sich der Außenhandel für alle Volkswirtschaften, da alle Länder einen größtmöglichen Güterertrag erzielen, wenn sie Produkte mit geringen Arbeitskosten selber herstellen und die übrigen Güter im Handel (Austausch) beziehen. Darüber hinaus ist Ricardo insbesondere für seine Theorie der Bodenrente bekannt geworden (Schumpeter 1954, S. 741 f.).
Zusammenfassung
Die ersten Spuren ökonomischen Handelns stammen aus Mesopotamien und finden sich auf ca. 3000 Jahre alten Keilschrifttafeln. Es handelt sich um zum Teil noch gültige Schuldscheine die aus der Zeit 1073 bis 1056 vor Christus datieren.
Xenophon (380 v. Chr.) beschrieb in seiner Schrift „Oikonomikos“ erste Aspekte zum Getreidehandel, der Arbeitsteilung und dem unternehmerischen Gewinnstreben. Mit Platon (427–347 v. Chr.) und Aristoteles (384–322 v. Chr.) beginnen die ersten Ansätze ökonomischen Denkens. Der Gedankengang reicht vom Geld als Erleichterung zum Tausch bis hin zur Kunst des Gelderwerbs.
Fibonacci führte Im Jahre 1202 mit seiner Schrift „Liber abbaci“, dass aus Indien stammende „dezimale Zahlensystem“ ein. Das Werk hatte einen großen Einfluss auf die italienischen Kaufleute, da sie mit den „indischen Zahlen“ besser und schneller rechnen konnten.
Thomas von Aquin (1225–1274) nahm den kirchlichen Faden wieder auf und verband die Lehre Aristoteles mit der Kirche. Für ihn ist Geld lediglich ein Tauschmittel und der Geldzins wird als Wucher abgelehnt. Luca Pacioli verbreitet 1494 das System der doppelten Buchführung in seinem Werk „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita“. Adam Smith prägt mit seinen Gedanken zur Arbeitsteilung und der „unsichtbaren Hand“ den Zeitgeist bis heute. Anerkennung als eigenständige Wissenschaft erfährt die Ökonomie mit seinem Werk „Wealth of Nations“ (1776).
Die Abbildung 2 gibt eine Übersicht zu den Meilensteinen des ökonomischen Denkens.
Abbildung 2: Meilensteine des ökonomischen Denkens
Quelle: Eigene Darstellung.
David Ricardo (1772-1823) entwickelte die Theorie der komparativen Kostenvorteile und begründet damit das „ricardianische Außenhandelsmodell“. Insgesamt erlebte die Ökonomie ab dem 18. Jahrhundert mit der industriellen Revolution eine Blütezeit.
Wiederholungsfragen
Was für erste Indizien „wirtschaftlichen Handelns“ fanden sich vor rund 3000 Jahren in Mesopotamien?
Welchen ökonomischen Gedanken vertrat Platon?
Welchen kritischen ökonomischen Ansatz vertrat Aristoteles?
Warum entwickelten sich die ökonomischen Ansätze im Mittelalter nicht weiter?
Welche beiden Lehren verband von Thomas von Aquin?
Warum hatte das Werk von Leonardo Fibonacci einen großen Einfluss auf die italienischen Kaufleute?
Welcher besondere Verdienst wird Luca Pacioli mit seinem Werk „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita“ von 1494 zugeschrieben?
Mit welchem Werk und Autor fand die Ökonomie Einzug als anerkannte Wissenschaft?
Mit welchem zentralen Gedanken revolutionierte Adam Smith die Ökonomie?
Welches theoretische Modell entwickelte David Ricardo zum Außenhandel?
Literatur:
Aristoteles (1998): Politik. Schriften zur Staatstheorie. Verlag: Philipp Reclam Jun.
Beutter, Friedrich (1989): Thomas von Aquin (1224/25-1274). In: Starbatty, Joachim (2012): Klassiker des ökonomischen Denkens. Nikol Verlagsgesellschaft Hamburg.
Koesters, Paul-Heinz (1982): Ökonomen verändern die Welt. Wirtschaftstheorien, die unser Leben bestimmen. 1. Auflage. Verlag Gruner + Jahr & Co, Hamburg.
Platon (2010): Der Staat. Übersetzung von Otto Apelt. Anaconda Verlag. Köln.
Schumpeter, Joseph (1954): Geschichte der ökonomischen Analyse Band 1; Vandenhoeck & Ruprecht, Deutsche Ausgabe von 1964 in der Neuauflage von 2007. Göttingen.
Smith, Adam (1996): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen. Deutsche Übersetzung aus der fünften Auflage von 1789 von Horst Claus Recktenwald. München 1996. Deutscher Taschenbuchverlag.
Stöckelhuber, Birgit (2001): Begann die Eisenzeit in der Südosttürkei im Jahre 1069 vor Christus? Nicht eingelöste assyrische Schuldscheine als Indiz. Onlineabruf am 09.11.2015: http://www.wissenschaft.de/kultur-gesellschaft/archaeologie/-/journal_content/56/12054/1224321/Begann-die-Eisenzeit-in-der-S%C3%BCdostt_%C3%BCr kei-im-Jahre-1069-vor-Christus%3F/
Ziegler, Bernd (2008): Geschichte des ökonomischen Denkens. Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
1.3 Individuelle Entscheidungsprozesse
Die Erfordernisse ökonomischer Entscheidungen ergeben sich aus der Knappheit der Güter in einer Volkswirtschaft. Im Fokus stehen folgende Fragestellungen:
Was wird produziert?
Wie wird produziert?
Welche Ressourcen werden eingesetzt?
Für wen wird produziert (Verteilung)?
Hieraus leitet sich die klassische Definition der Volkswirtschaftslehre ab: „Wie bewirtschaftet eine Gesellschaft knappe Mittel?“. Dieser zentralen Fragestellung wollen wir uns mit der Betrachtung von zehn Annahmen zur Volkswirtschaft nähern. Die Annahmen und die Vorgehensweise basieren auf den Ausführungen von Mankiw und Taylor (2012) zur Volkswirtschaftslehre und werden um aktuelle Entwicklungen wie die Finanz- und Wirtschaftskrise erweitert. Den zehn Annahmen liegt keine wissenschaftliche Analyse zugrunde. Vielmehr helfen sie, einen Überblick zur Funktion und Wirkung einer Volkswirtschaft zu erhalten und weitergehende volkswirtschaftliche Fragestellungen zu illustrieren (Mankiw und Taylor 2012, S. 3 ff.).
Dazu gehen wir in den kommenden drei Kapiteln auf die Rolle des Individuums, gruppenspezifische Entscheidungen und die Funktion einer Volkswirtschaft ein. Weil das Verhalten einer Volkswirtschaft insbesondere durch das der Individuen geprägt wird, betrachten wir zuerst vier individuelle Regeln für Einzelentscheidungen.
Annahme Nr. 1: Menschen stehen vor Alternativen.
Um eine Entscheidung zu treffen, ist es erforderlich, Alternativen abzuwägen oder den Zielkonflikt aufzulösen. Mit den Worten: „Es gibt nichts umsonst“, fassen Mankiw und Taylor (2012) die Problematik zusammen. Um etwas zu bekommen, muss für gewöhnlich etwas hergegeben werden.
Nehmen wir eine Studentin als Beispiel. Ihre wertvollste Ressource ist die Zeit. Sie kann all ihre Zeit für das Studium im Fach Wirtschaft oder im Fach Informatik aufwenden oder sie kann ihre Zeit auf beide Fächer gleich verteilen. Mit jeder Stunde, die sie ein Fach studiert, verliert sie eine Stunde, in der sie ein anderes Fach hätte studieren können. Und mit jeder Stunde des Studierens, verzichtet sie auf eine Stunde Ruhen, Radfahren oder Tennisspielen.
Ebenso steht die Gesellschaft vor der Entscheidung verschiedener Alternativen oder vor Zielkonflikten. Die klassische Alternative lautet hier: „Kanonen oder Butter“. D. h., je mehr Ressourcen wir für die Verteidigung aufwenden (Kanonen), umso weniger verbleibt für den Konsum der privaten Haushalte und der Steigerung des Lebensstandards (Butter) (Mankiw und Taylor 2012, S.4).
Definition „Effizienz“:
Im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften definieren Mankiw und Taylor (2012) den Begriff wie folgt: „Effizienz ist die Eigenschaft einer bestimmten Ressourcenallokation, die Wohlfahrt aller Mitglieder der Gesellschaft zu maximieren“.
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S.185.
Der Begriff der „Effizienz“ (engl. efficiency) leitet sich von lat. efficientia (= Wirksamkeit) ab. Ein grundlegender Zielkonflikt der Gesellschaft liegt zwischen der Effizienz und der Gerechtigkeit. Zielt die Effizienz auf eine optimale Ausbeute der knappen Ressourcen ab, so geht es bei der Gerechtigkeit um die faire Verteilung der wirtschaftlichen Wohlfahrt. Effizienz und Gerechtigkeit stehen bei staatlichen Maßnahmen oftmals in einem Zielkonflikt.
Die „Gerechtigkeit“ (griechisch: dikaiosyne, lateinisch: justitia, englisch und französisch: justice) bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders.
Definition „Gerechtigkeit“:
Im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften definieren Mankiw und Taylor die Gerechtigkeit als: „Fairness der Wohlfahrtsverteilung unter den Mitgliedern einer Gesellschaft“.
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 185.
Annahme Nr. 2: Was für den Erwerb eines Gutes aufgegeben wird, bestimmt die Kosten dieses Gutes.
Wie wir der ersten Regel entnehmen können, sind alle Menschen in einer Volkswirtschaft bei dem Treffen von Entscheidungen einem Zielkonflikt ausgesetzt. Deshalb gilt es, vor einer Entscheidung Kosten und Nutzen von Alternativen miteinander zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen. Oftmals sind aber die Kosten einer Alternative nicht so offensichtlich wie auf den ersten Blick vermutet.
Bleiben wir beim Beispiel eines Studiums. Welche Argumente sprechen für und welche gegen die Aufnahme eines Studiums? Für ein Studium sprechen die intellektuelle Bereicherung sowie lebenslang vielfältigere Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeit. Aber worin bestehen die Kosten? Rechnen wir die üblichen finanziellen Kosten eines Studiums zusammen, so zeigt uns die Summe nicht, worauf wir dafür verzichten.
Definition „Opportunitätskosten“:
Opportunitätskosten, auch Verzichts- oder Alternativkosten genannt, sind „Was aufgegeben werden muss, um etwas anderes zu erlangen.“
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 64.
Im Studium zählt neben den monetären Aspekten insbesondere die aufgebrachte Zeit, die z. B. für eine gewerbliche Tätigkeit genutzt werden könnte. So setzen sich die Opportunitätskosten aus dem zusammen, was aufgegeben werden muss, um etwas zu erlangen.
Annahme Nr. 3: Rational entscheidende Menschen denken in Grenzbegriffen.
Rationale Menschen kennzeichnet, dass sie systematisch und zielstrebig alles geben, um ihre Ziele zu erreichen. Dabei sind sich rationale Menschen bewusst, dass es meist kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern gewöhnlich etwas dazwischen. Mit Rationalität (von lateinisch rationalitas ‚Denkvermögen‘, abgeleitet von Ratio ‚Vernunft‘) wird ein vernunftgeleitetes und an Zwecken ausgerichtetes Denken und Handeln bezeichnet. Der Begriff beinhaltet die absichtliche Auswahl von und die Entscheidung für Gründe, die als vernünftig gelten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Definition „rationaler Mensch“:
Mankiw und Taylor definieren die Begrifflichkeit „rationaler Mensch“ als „Menschen, die systematisch und zielstrebig alles geben, um ihre Ziele zu erreichen.“
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 6.
So besteht die Entscheidung meist nicht zwischen den Extremen, wie beispielsweise vor einem Prüfungstermin die Prüfung komplett abzusagen oder nicht. Die Wahl liegt vielmehr darin, eine weitere Stunde für das Lernen aufzuwenden und in die Bücher zu schauen oder in den sozialen Netzwerken zu surfen.
Viele Entscheidungen des Lebens zielen darauf ab, bestehende Pläne in kleinen Schritten abzuwandeln. Es geht also um marginale Veränderungen, denen eine inkrementelle Anpassung existierender Pläne oder Handlungen zugrunde liegt. Demnach fällen Menschen Entscheidungen, indem sie Kosten und Nutzen marginaler Veränderungen abwägen.
Definition „marginale Veränderungen“:
Die marginale Veränderung umfasst die: „Abwandlungen eines bestehenden Aktionsplans durch kleine Schritte“.
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 7.
Zentral von Bedeutung ist der Begriff der Marginalität etwa für die Bestimmung des Grenznutzens. Eine Fokussierung auf die Betrachtung kleiner Änderungen gegenüber dem Status löste die marginalistische Revolution innerhalb der Wirtschaftswissenschaften aus.
Wie nehmen Individuen und Organisationen eine Abwägung von Kosten und Nutzen nach dem Marginalprinzip vor? Hier stehen zwei Fragestellungen im Mittelpunkt:
Was kostet die nächste Einheit? Grenzkosten (GK).
Was bringt die nächste Einheit? Grenzerlös (GE).
Solange der Grenzerlös größer ist als die Grenzkosten, lohnt sich die nächste Einheit (GE > GK). Für rationelle Entscheidungen sind daher die Grenzkosten (Kosten der nächsten Einheit) und nicht die insgesamt angefallenen Kosten (Durchschnittskosten) entscheidend. Beispiel für eine individuelle Entscheidungsfindung:
Ob ich weiter für die BWL-Klausur lerne, hängt vom erwarteten Grenzertrag der nächsten zusätzlichen Lernstunde ab, nicht vom Ertrag der bisher schon gelernten Stunden insgesamt.
Übungsaufgabe 1: Grenzkosten und Grenzerlöse
IT- Unternehmer Steve hat 1.000 Tablet-PCs produziert. Die Produktionskosten belaufen sich auf insgesamt 250.000 Euro, die Höhe der Durchschnittskosten liegt also bei 250 Euro pro Stück. Steve hat bereits 900 Geräte verkauft, 100 Geräte stehen noch im Lager und es steht die Produktion des Nachfolgemodells an.
Ein Elektronikmarkt macht Steve nun ein Angebot von 20.000 Euro für die 100 Tablet-PCs.
Sollte Steve das Angebot annehmen? Erläutern Sie ihre Empfehlung am Beispiel einer Abwägung von Kosten und Erlösen nach dem Marginalprinzip.
Annahme Nr. 4: Die Menschen reagieren auf Anreize.
Unter der Prämisse eines rationalen Handelns reagieren Menschen auf Anreize, d. h. sie treffen ihre Entscheidungen (vgl. Annahme Nr. 3) durch einen Vergleich von Grenznutzen und Grenzkosten. Zur Bedeutung von Anreizen fasst Mankiw kühn die gesamte Volkswirtschaftslehre mit folgendem Zitat zusammen: „Die Menschen reagieren auf Anreize. Alles andere sind nur Erläuterungen“ (Mankiw und Taylor 2012, S. 8.).
Definition „Anreiz“:
„Ein Anreiz (wie z.B. die Aussicht auf eine Belohnung oder eine Bestrafung) ist etwas, das eine Person zum Handeln veranlasst. Da rationale Menschen ihre Entscheidungen durch einen Vergleich von Grenznutzen und Grenzkosten treffen, reagieren Sie auf Anreize“.
Quelle: Mankiw und Taylor 2012, S. 8.
Letztlich sind Anreize etwas, das eine Person zu einem bestimmten Handeln bewegt. Für die Analyse der Fragestellung „Wie funktionieren Märkte?“ sind Anreize entscheidend. Steigt beispielsweise der Preis eines Apfels, konsumieren die Leute mehr Birnen und weniger Äpfel, weil die Kosten eines Apfels höher sind. Gleichzeitig werden die Apfelbauern die Apfelernte ausbauen, weil der Stückgewinn aus dem Verkauf eines Apfels höher ist. Preise sind dabei offensichtlich Anreize, aber nicht alle Anreize sind monetärer Natur. Oftmals sind Anreizwirkungen schwer abzuschätzen (Mankiw und Taylor 2012, S. 8 ff.).
Zusammenfassung
Die ersten vier Annahmen beschreiben die Prinzipien der Volkswirtschaft auf der individuellen Ebene. Nach der ersten Annahme treffen Menschen nach Abwägung ihrer zur Verfügung stehenden Möglichkeiten eine Entscheidung. Dabei wird ihnen ein rationelles Verhalten unterstellt, indem sie Kosten und Nutzen miteinander abwägen. Die zweite Annahme beziffert die Kosten eines Gutes dadurch, was für den Erwerb eines alternativen Gutes aufgegeben wurde (Opportunitätskosten).
Der dritten Annahme zum rationellen Menschen liegt eine systematische und zielstrebige Verfolgung ihrer Ziele zugrunde. Die Wahl zu ihren Entscheidungen beruht auf einem Abwägen von Kosten und Nutzen marginaler Veränderungen. Praktisch bedeutet dieses, die Anpassung bestehender Aktionspläne durch ein inkrementelles Vorgehen in kleinen Schritten.
Vierte und letzte individuelle Verhaltensannahme ist die Reaktion des Menschen auf Anreize. Menschen reagieren auf Anreize, indem Sie ihre Entscheidungen mit einem Vergleich von Grenznutzen und Grenzkosten treffen. Preise sind oftmals Anreize, aber nicht alle müssen finanzieller Natur sein.
Wiederholungsfragen
Nennen Sie drei Beispiele abzuwägender Alternativen und Zielkonflikte aus Ihrem Leben.
Gibt es einen Widerspruch zwischen der Effizienz und der Gerechtigkeit?
Was kennzeichnet rationale Menschen?
Welches sind die Opportunitätskosten eines Kinobesuchs?
Wie setzt sich der Preis eines Gutes aus Opportunitätskosten zusammen?
Sie wollen eine weitere Einheit produzieren. Sollten hierfür nach dem Marginalprinzip die Grenzerlöse höher sein als die Grenzkosten?
Was sind marginale Veränderungen?
Warum sollten Wirtschaftspolitiker über Anreize nachdenken?
Welche Bedeutung haben die Grenzerlöse bei der Abwägung von Kosten und Nutzen nach dem Marginalprinzip?
Erläutern Sie die Bedeutung und den Zusammenhang von Grenzkosten und Durchschnittskosten nach dem Marginalprinzip?
Literatur
Gosepath, Stefan (2012): Eine einheitliche Konzeption von Rationalität. In Karafyllis, Schmidt (Hrsg.). Zugänge zur Rationalität der Zukunft. Metzler S. 29-52.
Mankiw, N. Gregory und Taylor, Mark P. (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart.
1.4 Gruppenspezifische Entscheidungsprozesse
Konzentrierten sich die ersten vier Annahmen zu den individuellen Entscheidungsprozessen auf die Perspektive des Einzelnen, steht bei den folgenden drei Annahmen das Zusammenwirken der Menschen untereinander in gruppenspezifischen Entscheidungsprozessen im Fokus. Wir beginnen mit der fünften Annahme von Mankiw und Taylor (2012) zum Handel.
Annahme Nr. 5: Durch Handel kann es jedem besser gehen.
Grundsätzlich stehen alle nationalen Volkswirtschaften auf dem Weltmarkt in gegenseitiger Konkurrenz. Die Konkurrenz der Volkswirtschaften ist aber nicht mit einem sportlichen Wettkampf zu vergleichen. Vielmehr führt der Handel der konkurrierenden Volkswirtschaften dazu, dass es beiden Seiten besser gehen kann.
Der Handel erlaubt es, sich auf Tätigkeiten zu spezialisieren, welche die Handelspartner am besten beherrschen. Die Vorteile des Handelns lassen sich gut am Beispiel einer Familie darstellen:
Sucht beispielsweise ein Familienmitglied eine neue Stelle, so konkurriert es mit den Mitgliedern anderer Familien, die ebenfalls eine neue Stelle suchen. Die Familien stehen in einer Volkswirtschaft untereinander in einem Wettstreit. Keinen Vorteil hat die Familie, wenn sie sich vom Wettbewerb mit den anderen Familien abgekapselt. Dann müsste die Familie ihre eigene Nahrung anbauen, ihre Kleidung herstellen und selbst ein Haus bauen.
Das Beispiel macht deutlich, dass die Familie offensichtlich vom Austausch, also dem Handel, mit anderen Familien profitiert. Den gleichen Vorteil vom Handeln haben die Volkswirtschaften. Sie spezialisieren sich und haben dadurch eine größere Bandbreite an Waren und Dienstleistungen. So sind andere Volkswirtschaften ebenso Konkurrenten wie auch Partner im Handel.
Der Handel zwischen zwei Ländern führt meist dazu, dass es jedem Land besser geht (Pareto-Superiorität durch Tausch). Volkswirtschaftliche Optimierungen sind superior, wenn im Ergebnis Menschen besser gestellt werden, ohne dabei einen anderen schlechter zu stellen. Die sog. Pareto-Superiorität geht auf den Ökonom Vilfredo Pareto (1848–1923) zurück. Angestrebt wird dabei ein Pareto-Optimum, dies





























