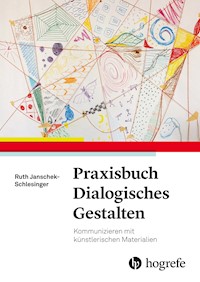
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der zwischenmenschlichen Kommunikation gibt es viele Themen, die verbal kaum angesprochen oder besprochen werden können. Mithilfe gestalterischer Mittel können schwer auszudrückende Probleme, aber auch deren mögliche Lösungen sichtbar werden - und genau das ist Sinn und Zweck des dialogischen Gestaltens. Dialogisches Gestalten ist eine analoge, nonverbale Kommunikationsform mit gestalterischen Mitteln zwischen zwei und mehreren Personen. Die künstlerischen Materialien dienen hierbei als Kommunikationsträger, d.h. als Transporteure im zwischenmenschlichen Austausch. Im ersten Teil des Werkes wird kurz und verständlich der Begriff des dialogischen Gestaltens erläutert und wie diese Form der kunsttherapeutischen Arbeit professionell umgesetzt werden kann. Der zweite Teil widmet sich zahlreichen anschaulichen Übungen, mit Blick auf den Gestaltungsprozess, die Verhaltensweisen der Akteure und den abschließenden verbalen Austausch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Praxisbuch Dialogisches Gestalten
Ruth Janschek-Schlesinger
Ruth Janschek-Schlesinger
Praxisbuch Dialogisches Gestalten
Kommunizieren mit künstlerischen Materialien
Dr. phil. Ruth Janschek-Schlesinger
Institut und Atelier für Kunsttherapie
Hauptstraße 38b
D-01328 Dresden
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri, Lisa Maria Pilhofer
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: © Ruth Janschek-Schlesinger, Dresden
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Illustration/Fotos (Innenteil): © Ruth Janschek-Schlesinger, Dresden
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s. r. o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
1. Auflage 2020
© 2020 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96014-2)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76014-8)
ISBN 978-3-456-86014-5
http://doi.org/10.1024/86014-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Übungsübersicht
Übung 1: Vorstellung mit Dialogischem Gestalten 36
Übung 2: Dialogisches Portrait 38
Übung 3: Märchenfiguren 42
Übung 4: Gestaltung eines Märchen-Bilderbogens 43
Übung 5: Strichmännchen 45
Übung 6: Formenspiel 47
Übung 7: Farbskala 48
Übung 8: Vormachen – Nachmachen 50
Übung 9: Fensterbild 53
Übung 10: Der gemeinsame Weg 55
Übung 11: Einstiegsübung: Namensgestaltung, Symbolgestaltung 57
Übung 12: Einstiegsübung: Tongestaltung 60
Übung 13: Einstiegsübung: Momentaufnahme 62
Übung 14: Struktur gibt der Gruppe Halt 64
Übung 15: Collagengestaltung in der Gruppe 69
Übung 16: Märchen im Dialog 73
Übung 17: Ballonfahrt 77
Übung 18: Klecksbild 79
Übung 19: Innere und äußere Landschaft 80
Übung 20: Ich – du – wir: Wir gestalten eine Stadt oder ein Dorf 82
Übung 21: Ressourcenbaum 85
Übung 22: Schutzraum 88
Übung 23: Spontanes Malen in der Gruppe 90
Übung 24: Linienführung in der Gruppe 92
Übung 25: Segmentübung 94
Übung 26: Gruppenfigur 97
Übung 27: Bewegter indirekter Dialog 98
Übung 28: Farben gehen auf Wanderschaft 101
Übung 29: Gruppenfigur 103
Übung 30: Kritzel-Dialog 106
Übung 31: Panoramabild 108
Danksagung
Für das sorgfältige und umsichtige Lektorat des Buchmanuskriptes möchte ich mich ganz herzlich bei Andre Glöckner (Dresden) bedanken. Für die Realisierung dieses Buchprojektes, das diesem Projekt entgegengebrachte Vertrauen und für die vorzügliche und entgegenkommende Zusammenarbeit mit dem Lektorat und der Buchgestaltung gilt mein besonderer Dank dem Hogrefe Verlag.
Vorwort
Als Kunsttherapeutin, psychologische Beraterin, Coach und Supervisorin darf ich seit mehr als dreißig Jahren Menschen aller Altersgruppen in meinem therapeutischen Arbeitskontext begegnen und sie begleiten. Mir war und ist es immer ein besonderes Anliegen, den einzelnen Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen, um ihm und seinen Themen näherzukommen. Dabei steht für mich im Mittelpunkt, wie sie oder er sich auszudrücken vermag – nonverbal und verbal. Es ist naheliegend, dass die Kunsttherapeutin hierfür noch eine weitere Ebene hinzunimmt, nämlich die der Gestaltung.
Diese Triade – verbale Ebene, nonverbale Ebene, Gestaltung – erweist sich in meiner Arbeit mit Menschen als Begleiter auf dem Weg zum Verständnis für den anderen.
Einleitung
Zu Beginn möchte ich Ihnen das Thema dieses Buches „Dialog mit Gestaltung – Dialogisches Gestalten“ als eine Art Navigationshilfe aus zwei Perspektiven vor Augen führen: die des Begleiters, der eine Gruppe für einen bestimmten Zeitraum begleitet, und jene der beteiligten Personen1.
Die Perspektive des Begleiters
Wann immer wir als Therapeuten, Supervisoren, Pädagogen etc. mit mehr als einer Person beruflich in Kontakt treten, ist der Beginn unserer Begegnung sehr entscheidend. Oftmals ergibt sich daraus die weitere Arbeitsbeziehung. Am Beginn stehen üblicherweise die Vorstellung der beteiligten Personen, ihre Erwartungen und Ziele. Ob die Überleitung zum eigentlichen Arbeitsprozess gelingt, hängt oft davon ab, inwieweit die angesprochenen Personen mitzugestalten bereit sind. Oftmals steht hier der Begleiter auf verlorenem Posten. Manch Beteiligter ist noch zurückhaltend oder nicht motiviert, und nicht selten machen sich Widerstände breit. Um in einer solchen Situation zu konstruktiven Ergebnissen zu gelangen, holt der Begleiter jeden einzelnen Beteiligten im Gespräch ab, um sie oder ihn in den gemeinsamen Prozess einzubinden und damit für den weiteren Fortgang zu motivieren. Verbal-kommunikatives Geschick ist hier gefragt, reicht aber nicht immer aus.
Aktion und Interaktion aus zwei Perspektiven
Hier kann eine analoge Form der Kommunikation sehr hilfreich sein, zum Beispiel das Dialogische Gestalten. Die Beteiligten treten dabei in Aktion und Interaktion, stehen dabei aber nicht selbst im Mittelpunkt. Der Begleiter bezieht seine Perspektive aus der Rolle des stillen Beobachters. Das anschließende Feedback und die Reflexion über das Geschehene öffnen in kommunikativer Weise die Türen. Für solche Situationen finden sich in dieser Ausgabe Einstiegsübungen als Beispiel.
Die Perspektive des Beteiligten
Aus Perspektive der Beteiligten einer Gruppe sind das Ankommen und der Einstieg in den Gruppenprozess von großer Bedeutung. Nicht allen fällt es leicht, sich gleich zu Beginn verbal einzubringen, sich der eigenen Person gemäß vorzustellen. Andere wiederum nehmen sogleich den Raum für sich ein. Mithilfe des Dialogischen Gestaltens und einer klaren Struktur vermag jeder, seinen Raum zu finden und auch zu nutzen.
Veränderte Sicht führt zu tieferem Verständnis
Dieses Buch möchte mit seinen Beispielen anregen, die analoge Kommunikationsform des Dialogischen Gestaltens in der professionellen Begegnung mit Gruppen so einzusetzen, dass sich ein konstruktives, gegenseitiges Verstehen entwickelt. Diese analoge Ebene der Kommunikation kann neue Perspektiven eröffnen. Sie kann zu einem hilfreichen Instrumentarium für den Begleiter werden und eine neue Sicht und ein tieferes Verständnis für die Beteiligten bewirken.
„Methodenkoffer“ mit Übungen
Die Übungen aus diesem Buch, in Einzelschritten beschrieben, sollen dem Begleiter als strukturelle Unterstützung im Prozessverlauf dienen. Bewusst wurde auf eine Bildanalyse und Auswertung der entstandenen Gestaltungen verzichtet; muss dies doch dem kunsttherapeutischen Rahmen vorbehalten bleiben. Zudem ist das Buch für einen breiteren Anwendungsrahmen gedacht. Es will professionell arbeitende Begleiter der verschiedensten Gebiete ermutigen, das Dialogische Gestalten in ihren Methodenkoffer aufzunehmen.
Gliederung des Buches
Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil führt kurz und prägnant die Begriffe Dialog, Gestaltung, Dialogische Gestaltung, Zielstellung, Auftrag und die Rolle des Begleiters ein. Ein Leitfaden vermittelt näheres Verständnis zur Gliederung der Übungen. Der zweite Teil beschreibt die einzelnen Übungen anhand von Praxisbeispielen.
Die praktischen Beispiele samt der entstandenen Bilder sind der Lohn meiner langen, fruchtbaren Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Möge das Buch Sie, liebe Leser, anregen und motivieren, in Ihrer Arbeit mit Gruppen von dieser analogen Kommunikationsform zu profitieren.
1 Dialog
„Man kann nicht nicht kommunizieren“, so lautet eines der fünf Axiome von Paul Watzlawick (1978, S. 50). Eine einzelne Kommunikation sei als Mitteilung zu verstehen, während ein wechselseitiger Ablauf von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen als Interaktion bezeichnet werde. Watzlawick zufolge sind das Material jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte, sondern „Verhalten jeder Art“. „Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann“ (Watzlawick, 1978, S. 51).
Diese Aussage soll die Grundlage der Annahme bilden für das Dialogische Gestalten: Alles ist im Dialog. Die verbale Kommunikation tritt dabei zunächst in den Hintergrund – anders als bei Watzlawick, für den im unmittelbaren Mitteilungsprozess auch die verbale Kommunikation eine Rolle spielt. Beim Dialogischen Gestalten wird diese durch den Gestaltungsakt selbst ersetzt. Entscheidend ist die verbale Kommunikation hier in der Feedback-Runde und in der Reflexion im Anschluss an den jeweiligen Gestaltungsprozess.
Gisela Schmeer (2006, S. 7) weist auf die Bedeutung der gestalterischen Ebene hin. : „… die Einführung und Förderung eines nicht nur verbalen, sondern auch bildlichen Austauschs in der Gruppe öffnet den Blick für neue Erkenntnisse und ungewöhnliche Zusammenhänge und ist hilfreich bei allen Varianten von Selbsterfahrungs-, Therapie-, Supervisions-, Team-, Institutions-, und Organisationsgruppen, die sich zusammenfinden, um anstehende Fragen zu klären“. So kann diese Form der analogen Kommunikation ein zusätzliches Fenster öffnen hin zum gegenseitigen besseren Verständnis und Wegweiser für neue Perspektiven in der zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltung sein. Anders als bei Schmeer, wo es im Wesentlichen um Gruppen von Erwachsenen geht, beziehen die nachfolgenden Ausführungen Kinder und Jugendliche und statt ausschließlich Gruppen auch zwei Personen ein.
Der Dialog
Der Dialog versteht sich sinngemäß als Zwiegespräch und wurde früh in seiner Bedeutung als Unterredung und Austausch zwischen zwei Personen verstanden. Das Wort leitet sich ab vom altgriechischen Substantiv „diálogos“ (Unterredung, Gespräch) beziehungsweise dem entsprechenden Verb: sich unterreden (Gemoll, 1965). Der Dialog ist also im ursprünglichen Sinne nicht nur auf zwei Personen bezogen. Er steht für Rede und Gegenrede, Unterredung oder für ein Gespräch von zwei oder mehreren Personen. Der Dialog umfasst nicht nur das verbal Ausgesprochene, sondern auch das gegenseitige Zuhören, die Entwicklung eigener Gedanken und Emotionen und entsprechende verbale und nonverbale Reaktion darauf. William Isaacs (2011) sieht vier Fähigkeiten als wesentlich für einen Dialog an:
Zuhören als das Auf-sich-wirken-Lassen des Gehörten, aus einem inneren Schweigen herausRespektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, Abwertung oder Kritik gegenüber den DialogpartnernSuspendieren als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken, Emotionen und Meinungen, ohne in eine Fixierung zu verfallenArtikulieren als das Finden der eigenen, authentischen Sprache und des Aussprechens der eigenen WahrheitBezieht man diese vier Fähigkeiten auf das Dialogische Gestalten, so ergibt das folgenden Ablauf:
visuelles ZuhörenAkzeptieren und Respektieren des individuellen gestalterischen AusdrucksSuspendieren als gestalterische Impulse in Verbindung mit entsprechenden Emotionengestalterisches Artikulieren als das Finden des eigenen authentischen gestalterischen AusdrucksIm Wesentlichen bestimmen zwei Faktoren, wie intensiv das visuelle Zuhören verläuft: Zunächst bedarf es gerade am Beginn eines Prozesses oft viel Zeit, bis sich die Beteiligten auf die visuelle Ebene einlassen können. Die Art und Weise des Einstiegs in einen Prozess können für den weiteren Verlauf von großer Bedeutung sein. Im nächsten Schritt folgt die Entscheidung, welche Form des Dialogischen Gestaltens eingesetzt wird.
2 Die Bedeutung des Gestaltens
Die Freude am Gestalten ist uns von Natur aus angelegt, Kinder bedienen sich meist ungezwungen dieser Ausdrucksform. Mit dem Erwachsenwerden ging vielen von uns der Zugang zu dieser natürlichen Selbstverständlichkeit verloren. Überlagert vom Alltagsgeschehen, sind Kreativität und Fantasie jedoch nicht gänzlich verschwunden. Gestalterisch-künstlerische Ausdrucksmittel vermögen diese scheinbar verschollenen Fähigkeiten wieder zu wecken und als analoge2 Kommunikationsform zu nutzen. Im Gestaltungsprozess lassen sich Verhaltensweisen erproben, beobachten und entdecken. Was die verbale Mitteilung verbirgt, wird hier oft sichtbar und deutlich. Im Umgang mit einzelnen künstlerischen Materialien lernen die Gestaltenden sich selbst und die anderen neu kennen – um sich bewusster zu erleben und auch eigene Wertvorstellungen zu entwickeln sowie die eigene Persönlichkeit und die der anderen so anzunehmen und zu sehen, wie sie ist. Gerade auf dem so komplexen Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehung und dem gegenseitigen Verständnis kann das Gestalten Fenster öffnen. Ein hilfreicher Weg.





























