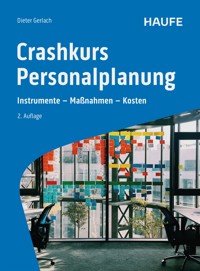49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
In unserer gegenwärtigen von Krisen geprägten Zeit steht das Personalressort vor enormen Herausforderungen und muss sich entsprechend zukunftsfähig aufstellen. Dieter Gerlach beschreibt, wie strategisches Personalmanagement erfolgreich in den Arbeitsalltag integriert und in die Personalpraxis und -prozesse umgesetzt wird. Dabei verdeutlicht sein Buch, warum gerade im Personalbereich strategisches Vorgehen so wichtig ist und bietet umfassende Konzepte und Modelle sowie Anwendungsbereiche und Instrumente des strategischen Personalmanagements. Es beleuchtet zudem die Rolle des strategischen Personalcontrollings und der strategischen Personalplanung und erläutert, welche Kompetenzen Mitarbeiter:innen und Führungskräfte in Zukunft benötigen. Inhalte: - Grundlagen, Konzepte, Modelle und Struktur des strategischen Personalmanagements - Rechtliche Rahmenbedingungen - Strategisches Personalcontrolling: Definition, Kennzahlen, People Analytics, Informationssysteme - Strategische Personalplanung: Grundlagen, Prozess, Kostenplanung - Anwendungsbereiche: Personalführung, -entwicklung, -gewinnung, -freisetzung, Diversity - Instrumente: SWOT-Analyse, Balanced Scorecard, Szenariotechnik, Mitarbeitendenportfolio - IT-Unterstützung bei der Personalarbeit Die digitale und kostenfreie Ergänzung zu Ihrem Buch auf myBook+: - Zugriff auf ergänzende Materialien und Inhalte - Persönliche Fachbibliothek mit Ihren Büchern Jetzt nutzen auf mybookplus.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumVorwort1 Was ist eine Strategie?2 Grundlagen des strategischen Personalmanagements2.1 Was bedeutet eigentlich »strategisches Personalmanagement«?2.2 Ziele einer Personalstrategie2.3 Wie entsteht eine Personalstrategie?2.3.1 Entwicklung einer Personalstrategie in sechs Schritten2.3.2 Ein weiterer Prozess der Entwicklung einer Personalstrategie2.3.3 Mit einem strukturierten und integrierten Entwicklungsprozesses zur Personalstrategie2.3.4 Mit einem nachhaltigen Strategieprozess und OKR zur Personalstrategie3 Konzepte und Modelle des strategischen Personalmanagements3.1 Modelle des strategischen Personalmanagements 3.2 Konzepte des strategischen Personalmanagements3.2.1 ESG (Environmental, Social, Governance) 3.2.2 Eine Personalstrategie für den Mittelstand3.2.3 Change-Management4 Die Struktur des strategischen Personalmanagements5 Aktuelle Situation und zu erwartende Trends5.1 Zukünftige Themen5.2 Fünf Top-HR-Trends5.3 Change-Management und digitale Transformation5.4 Ein detaillierterer Blick auf Digitalisierung6 HR als strategischer Partner6.1 Wichtige HR-Funktionen heute und in der Zukunft6.2 HR als People Company6.3 Wie kann sich HR weiterentwickeln?6.4 Drei Beispiele aus der Praxis7 Rechtliche Rahmenbedingungen7.1 Betriebsrätemodernisierungsgesetz 7.2 Aktuelle Urteile7.3 Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)7.4 Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)7.5 Das Betriebsverfassungsgesetz/betriebliche Lösungen (Betriebsvereinbarungen)8 Strategisches Personalcontrolling8.1 Bedeutung8.2 Definition »Personalcontrolling«8.3 Personalkosten8.4 Kennzahlenorientiertes Personalcontrolling8.5 Wertschöpfungsansätze8.6 Personalinformationssysteme8.7 People Analytics8.8 Human-Capital-Management8.9 Controlling der Personalarbeit8.10 Effizienz der Personalarbeit9 Strategische Personalplanung9.1 Definition und Grundlagen der Personalplanung9.2 Bedeutung9.3 Prozess der Personalplanung 9.4 Die strategische Personalplanung im Detail9.4.1 Inhalte und Ziele strategischer Personalplanung 9.4.2 Personalkostenplanung9.4.2.1 Grundlagen9.4.2.2 Instrumente der Personalkostenplanung9.5 Unternehmensbeispiel10 Anwendungsbereiche des strategischen Personalmanagements10.1 Personalführung10.1.1 Wie definiert man Personalführung?10.1.2 Prinzipien guter Personalführung10.1.3 Führungsstile10.1.4 Führungsinstrumente 10.1.5 Wie viel Hierarchie ist notwendig?10.2 Personalentwicklung10.2.1 Aufgaben der Personalentwicklung10.2.2 Die Personalentwicklungsplanung10.3 Personalgewinnung10.3.1 Recruiting10.3.2 Fehler beim Recruiting 10.3.3 Die Erfolgsfaktoren im Recruiting10.4 Mitarbeitendenbindung10.5 Personaleinsatz10.6 Personalfreisetzung10.6.1 Maßnahmen bei bestehenden Arbeitsverhältnissen10.6.2 Strukturierter Prozess10.6.3 Maßnahmen zum Personalabbau10.6.3.1 Maßnahmen zur vorübergehenden Kapazitätsreduzierung10.6.3.2 Maßnahmen zur dauerhaften Verringerung der Kapazitäten10.7 Betriebliches Gesundheitsmanagement10.8 Diversity10.9 Employer Branding 10.10 Vergütungsmanagement11 Instrumente des strategischen Personalmanagements11.1 SWOT-Analyse 11.2 Balanced Scorecard11.3 Szenariotechnik11.4 Kompetenzmodelle11.5 Personalrisikomanagement11.6 Mitarbeitendenbefragung11.7 Mitarbeitendenportfolio11.8 Nachfolgeplanung11.9 Innovationsmanagement 11.9.1 Definition und Handlungsfelder11.9.2 Schlüsselaspekte des Innovationsmanagements11.9.2.1 Fähigkeiten11.9.2.2 Strukturen11.9.2.3 Strategie11.9.2.4 Kultur12 Welche Mitarbeitenden und welche Skills benötigen wir in der Zukunft? 12.1 Führungskräfte12.2 Personalmitarbeitende 13 Unternehmenskultur14 IT-Unterstützung bei der Personalarbeit14.1 IT-Lösungen14.2 Softwareauswahl14.3 Digitalisierung14.4 Künstliche Intelligenz14.5 Blockchain14.6 Cloud Computing 14.7 DSGVO/Datenschutz14.8 IT-Sicherheit15 Die Zukunft des strategischen Personalmanagements16 Die Zukunft der Personalarbeit und des PersonalbereichsLiteraturverzeichnisIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buchs zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 78-3-648-17248-3
Bestell-Nr. 14173-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-17249-0
Bestell-Nr. 14173-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-17250-6
Bestell-Nr. 14173-0150
Dieter Gerlach
Praxishandbuch Strategisches Personalmanagement
November 2023
© 2023 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © iStock, piranka
Produktmanagement: Dr. Bernhard Landkammer
Lektorat: Ursula Thum, Text + Design Jutta Cram, Augsburg
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Es ist unbestritten, dass das Thema »Strategisches Personalmanagement« heute und in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen wird. In der heutigen krisenbehafteten Zeit steht das Personalressort vor enormen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen (Verteuerung der Energiepreise, Unterbrechung der Lieferketten, Verunsicherung bei den Menschen und bei den Unternehmen) ist ein kluges Vorgehen aller für das Personal Verantwortlichen unumgänglich.
Dazu kommen weitere Baustellen, die nicht vernachlässigt werden sollten, wie z. B. die demografische Situation und die damit verbundene Verknappung am Arbeitsmarkt, New Work, künstliche Intelligenz und gesundheitspolitische Herausforderungen (die Corona-Pandemie und nicht abzusehende Long-Covid-Folgen).
Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, wie strategisches Personalmanagement in den Arbeitsalltag integriert und in die Personalpraxis bzw. -prozesse umgesetzt wird. In diesem Buch soll genau das versucht werden. Darüber hinaus wird erläutert, warum speziell im Personalgeschäft strategisches Vorgehen bedeutsam ist. Darüber hinaus sollen Konzepte und Modelle ebenso wie Anwendungsbereiche und Instrumente des strategischen Personalmanagements gezeigt werden.
Außerdem wird in diesem Buch darauf eingegangen, welche Bedeutung und welche Rolle das strategische Personalcontrolling und die strategische Personalplanung hierbei spielen. In einem weiteren Schwerpunkt wird die Bedeutung der IT-Unterstützung aufgezeigt und welche Skills die Beschäftigten und Führungskräfte in der Zukunft benötigen.
Zum Abschluss soll ein Blick in die Zukunft des strategischen Personalmanagements und insbesondere der Personalarbeit geworfen werden.
Ich würde mich freuen, wenn Sie beim Lesen neue Erkenntnisse gewinnen und sie im Idealfall in Ihrer beruflichen Praxis umsetzen können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
Dieter Gerlach, im Oktober 2023
1 Was ist eine Strategie?
»Wenn Sie keine Strategie haben, sind Sie Teil der Strategie eines anderen.«
Alvin Toffler, US-amerikanischer Futurologe
Strategie, DefinitionDas Wort »Strategie« stammt aus dem Altgriechischen. Man versteht darunter die Kunst der Heeresführung. Erst später wurde der Begriff auf die Gebiete der Verwaltung, der Führung und der Rhetorik erweitert. Im nächsten Schritt wurde daraus eine Managementfähigkeit, um z. B. eine Regierung zu führen. Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff »Strategie« von Carl von Clausewitz aufgegriffen. Aus seiner Sicht war die Militärstrategie Bestandteil der Politik. Es ging um knappe Ressourcen, Wettbewerbsvorteile und andere Herausforderungen, die bereits der heutigen Wirtschaft ähnelten.
In der Weiterentwicklung des Konzepts der Strategie (Wikipedia, Strategie [Wirtschaft]) gibt es folgende Ansätze:
Strategie, Harvard-KonzeptDas Harvard-Konzept der Strategieentwicklung
Hierunter versteht man die Festsetzung der langfristigen Unternehmensziele sowie deren Politik und Handlungsmaßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele. Hier die einzelnen Schritte:
Ermittlung des »strategischen Profils«
Analyse relevanter Umweltausschnitte
Strategische Prognosen
Analyse der Unternehmensstärken und -schwächen
Ressourcenanalyse
Entwicklung der strategischen Handlungsalternativen
Konsistenztest
Strategische Wahl
Strategie, Fünf-Phasen-ModellDas Fünf-Phasen-Modell
Basierend auf dem Harvard-Modell entwickelten Bircher und Hinterhuber ein Fünf-Phasen-Modell innerhalb des Ansatzes des Portfoliomanagements in der Unternehmensstrategie. Die Phasen sind:
Analyse der gegenwärtigen Situation und der Aussicht
Strategieformulierung
Erstellung der strategischen Planung und der Politik
Umbau der Organisation nach der Strategie
Umsetzung der Strategie
Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Modelle, wie z. B. die Modelle nach Porter, nach Drucker und nach Kirsch.
Strategie, ArtenBei den Arten der Strategien wird differenziert nach:
klassische Strategie (Plan und Umsetzung sind vorhanden)
unternehmerische Strategie (kein exakter Plan, nur eine Idee vorhanden, die als Strategie geplant wird)
ideologische Strategie (eine Vision, die von vielen geteilt wird, Synchronisation durch gleiche Denkmuster, schwierig zu ändern)
Schirm-Strategie (zentrale Führungsfunktion gibt lediglich einen Strauß von Regeln, Richtlinien und Maßnahmen vor, innerhalb derer sich die dezentralen Einheiten bewegen)
Prozess-Strategie (es wird zentral lediglich der Prozess der Strategiefindung vorgegeben)
unverbundene Strategie (es gibt so viel Spielraum, dass jede Einheit eine eigene Strategie verfolgen kann)
Konsens-Strategie (eine Strategie durch wechselseitiges Anpassen)
aufgezwungene Strategie (durch die Umwelt erzwungen)
Strategie, UnternehmensstrategieUnternehmensstrategieDie Unternehmensstrategie beinhaltet die langfristigen Ziele, die Vision und den daraus entwickelten Plan und bezieht sich immer auf das ganze Unternehmen.
Unternehmensstrategie, InhalteInhalte einer Unternehmensstrategie sind beispielsweise:
Vision, Mission und langfristige Ziele
Kernkompetenzen
Geschäftsfelder, Umfeldbedingungen der Geschäftsfelder, Wettbewerbsvorteile
Gestaltung der Wertschöpfungskette
strategische Stoßrichtung
Entwicklung der Unternehmensstrategie (Olesch, Personalmagazin 11/2018)
Strategie, InstrumenteUnterstützende Instrumente, um eine Strategie zu entwickeln, sind z. B.
ein Leitbild (wenn vorhanden) oder eine Mission,
eine Marktanalyse,
eine Bestandsaufnahme des Unternehmens durch eine SWOT-Analyse und
darauf aufbauend die Definition der strategischen Herausforderungen, der strategischen Ziele und der dafür benötigten Maßnahmen.
2 Grundlagen des strategischen Personalmanagements
strategisches Personalmanagement, GrundlagenIn einer Untersuchung der Zeitschrift »Personalwirtschaft« vom April 2022 (HR Transformation Report 2022 – NTT Data) wurde festgestellt, dass lediglich 38 Prozent der befragten Firmen über eine strategisch ausgerichtete Personalabteilung verfügen. 43 Prozent der Studienteilnehmer sagen, dass ihr Unternehmen keine HR-Strategie hat. Der wichtige Servicegedanke ist nur bei einem knappen Viertel der Unternehmen erkennbar. Außerdem fehlen immer noch Ansätze zu agiler Arbeit und zur Digitalisierung der Prozesse.
Sowohl bei der Unternehmensführung als auch bei den Verantwortlichen im Personalressort gibt es oft kein einheitliches Bild einer strategisch ausgerichteten Personalabteilung. Es ist sowohl die Rede von »strategischem Personalmanagement« als auch von »HR-Strategie« oder von einer »People-Strategie«.
2.1 Was bedeutet eigentlich »strategisches Personalmanagement«?
strategisches Personalmanagement, DefinitionGrundsätzlich wird im strategischen Personalmanagement von zwei verschiedenen, aber miteinander verbundenen Strategien gesprochen:
Personalstrategie
Personalfunktionsstrategie
strategisches Personalmanagement, PersonalstrategiePersonalstrategieDie Personalstrategie umfasst alle Aktivitäten, die den Ausbau, die Pflege und die Nutzung mitarbeiterbezogener Kompetenzen betrifft und der nachhaltigen Umsetzung der Unternehmensstrategie dient. Die Personalstrategie ist somit Teil der Unternehmensstrategie und hilft, die ökonomischen Ziele zu erreichen.
strategisches Personalmanagement, Personalfunktionsstrategiestrategisches PersonalfunktionsstrategieDie Personalfunktionsstrategie dagegen kümmert sich um die Frage, wie sich die Personalabteilung aufstellen muss, um die Personalstrategie umzusetzen. Sie ist die Strategie für den Personalbereich mit den dazugehörigen Fragen:
Was sind die Erfolgsmaßstäbe?
Welche Ziele gibt es?
Wie müssen die Strukturen des Bereichs aufgestellt werden?
strategisches Personalmanagement, MerkmaleStrategisches Personalmanagement ist im Gegensatz zur operativen Personalarbeit gekennzeichnet durch die Merkmale strategischen Handelns:
Langfristigkeit
Ganzheitlichkeit
Potenzialorientierung
SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken)
Integration
Umweltbezogenheit
Orientierung an den obersten Zielen und Strategien des Unternehmens.
strategisches Personalmanagement, EbenenMan spricht von drei Ebenen des strategischen Personalmanagements (Wirtschaftslexikon 24, 2018):
Erste Ebene: strategische Gestaltung einzelner Teilfunktionen des Personalmanagements
Zweite Ebene: die gesamte Personalfunktion mit allen Abstimmungserfordernissen und Verbindungen
Dritte Ebene: die Einbindung des Personalmanagements in die strategische Unternehmensführung
Entscheidend ist, dass eine Unternehmensstrategie ohne Personal nicht darstellbar ist. Deswegen verwundert es manchmal, dass das Personalressort an der Entwicklung der Unternehmensstrategie nicht beteiligt ist. Sowohl diese Einbindung ist sehr wichtig als auch die Mitwirkung der Geschäftsleitung und der Führungskräfte am Prozess der Personalstrategie. Durch die jeweilige Beteiligung wird ausgeschlossen, dass die Unternehmensstrategie unabhängig von den vorhandenen Ressourcen und Skills erstellt wird und andererseits die Personalstrategie im Einklang mit der Unternehmensstrategie steht.
Einflussfaktoren auf die Personalstrategie und deren Ziele, eigene Darstellung
Positionierung des Personalmanagements (Hochschule Pforzheim, Pforzheimer 3-Säulen-Modell zum Personalmanagement/Human Resources Management, o. J.)
strategisches Personalmanagement, AufgabenDurch die Breite der Aufgabenstellung sind sowohl die Aufgaben als auch die Themen der Personalstrategie sehr vielfältig. Im Folgenden deswegen nur einige ausgewählte Beispiele:
Aufgaben:
Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
Orientierungshilfe für Personalentscheidungen
Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung
Stärkung der Flexibilität
Personalentwicklung
Recruiting
Performance- und Vergütungsmanagement, u. a. auch Personalkostenoptimierung, Motivation der Mitarbeitenden etc.
strategisches Personalmanagement, ThemenDie Themen (abhängig von der Unternehmensstrategie, der Unternehmenskultur, der Größe des Unternehmens und der Größe der Personalabteilung etc.) sind zum Teil identisch mit den Aufgaben:
Umsetzung von Zielen aus der Unternehmensstrategie
Schwerpunkte aus dem Personalmanagement
Herausforderungen in der Branche
Daraus entstehen Themen wie Recruiting, Personalentwicklung, Mitarbeiterbindung, Digitalisierung, Ausbildung und andere.
strategisches Personalmanagement, KernfragenDie sich daraus ergebenden Kernfragen sind beispielsweise:
Welche Qualifikationen werden zukünftig benötigt?
Wie kann das Unternehmen am Markt attraktiv werden (Employer Branding)?
Auf welche Aufgabenfelder muss sich HR fokussieren?
Auf welche Weise kann die Unternehmenskultur verbessert und gleichzeitig das Werteverständnis verstärkt werden?
Wichtig ist, dass in diesem Zusammenhang folgende Dimensionen einfließen: Kultur, Organisation, Mitarbeitende und Prozesse.
2.2 Ziele einer Personalstrategie
Personalstrategie, ZieleDie Basis für die Ziele einer Personalstrategie richtet sich nach drei Faktoren:
Ziele des Unternehmens
Ausrichtung der Personalabteilung
Situation am Markt
Visionen, Strategien, Ziele und Leitlinien im Personalmanagement (in Anlehnung an Kolb, 2010, S. 60)
Die Voraussetzungen für die Ziele der Personalstrategie hängen nicht nur von der Unternehmensstrategie und den Unternehmenszielen ab, sondern auch vom Reifegrad der Personalarbeit. Hier entscheidet sich, mit welchen Instrumenten und Methoden die jeweiligen Ziele erreicht werden können. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Größe der Personalabteilung.
Die Situation am Markt ist für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Daraus resultieren die Bedingungen, die die Grundlage für die Aufgaben und damit auch für die Ziele des Personalmanagements bilden. Zudem spielt die Situation am Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Weitergehende Informationen dazu sind im Kapitel 6 zu finden.
Rahmenbedingungen für das strategische Personalmanagement (in Anlehnung an Oertig o. J., S. 2 ff.)
2.3 Wie entsteht eine Personalstrategie?
2.3.1 Entwicklung einer Personalstrategie in sechs Schritten
Personalstrategie, EntwicklungPersonalstrategie, SchritteUm eine sinnvolle Personalstrategie zu entwickeln, ist es erforderlich, vorab zu überlegen, welche Schritte in welcher Reihenfolge einzuhalten sind. Diese Schritte könnten sein (HR Pepper Management, Personalmagazin 06/2018, S. 41):
Analyse durchführen
Veränderungsbedarf ermitteln
Handlungsoptionen entwickeln und bewerten
Maßnahmen ableiten
Strategie kommunizieren
Maßnahmen integrieren und umsetzen
Die Schritte im Einzelnen:
1. Analyse durchführen
Personalstrategie, AnalyseDie Erstellung einer Personalstrategie ist ein komplexes Thema, das es erforderlich macht, zu Beginn des Prozesses eine ausführliche Analyse der Ist-Situation vorzunehmen. Diese gliedert sich in eine externe und eine interne Analyse.
Bei der externen Analyse geht es um gesellschaftliche und technologische Trends sowie die wirtschaftliche Entwicklung, z. B. die des Arbeitsmarktes hinsichtlich der Verfügbarkeit von Fachkräften.
Bei der internen Analyse ist der Fokus auf die Unternehmensstrategie, die demografische Situation, die Schlüsselfunktionen und die Kompetenzstrukturen gelegt. Bezüglich der Personalarbeit muss eine Analyse entsprechend den Handlungsfeldern erfolgen. Diese sind je nach Unternehmen unterschiedlich. Im Wesentlichen handelt es sich um
Personalplanung,
Recruiting,
Employer Branding,
Talent-Management,
Ausbildung,
Führung und
Vergütung.
2. Veränderungsbedarf ermitteln
Personalstrategie, VeränderungsbedarfAus den Erkenntnissen der Analyse wird der strategische Veränderungsbedarf ermittelt. Um daraus die richtigen Schritte abzuleiten, ist eine Zusammenarbeit mit den Führungskräften und den Fachbereichen erforderlich. Es muss herausgearbeitet werden, welche Kapazitäten mit welchen Qualifikationen für die zukünftigen Herausforderungen erforderlich sind. Hier ist unbedingt die Mitwirkung des Personalressorts notwendig – auf deren Kenntnisse der Personalplanung und der Kompetenzentwicklung kann nicht verzichtet werden.
HR hat die Rolle, den Fachbereichen zu verdeutlichen, welche Herausforderungen durch die gesellschaftspolitischen Entwicklungen auf sie zukommen und welche Skills und welche Anzahl der Mitarbeitenden in Zukunft benötigt werden. Hierbei ist es ebenso wichtig, die Unternehmenskultur nicht zu vernachlässigen und sie gegebenenfalls anzupassen.
3. Handlungsoptionen entwickeln und bewerten
Personalstrategie, HandlungsoptionenWenn der Änderungsbedarf festgestellt wurde, besteht der nächste Schritt darin, Handlungsoptionen zu entwickeln. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden, um die veränderten Skills, die künftig benötigte Kapazität sowie die veränderte Organisationskultur umzusetzen. In dieser Phase sollten in einem gemeinsamen Vorgehen zwischen dem Personalressort, den Fachbereichen und den betroffenen Mitarbeitenden Lösungen entwickelt werden. Im zweiten Schritt ist aus diesen eine erste Auswahl zu treffen. Hierbei sind sowohl Wirksamkeit, Zufriedenheit der Betroffenen und Aufwand zu berücksichtigen. Mit einer Festlegung von KPIs kann der Erfolg der jeweiligen Maßnahme nachvollzogen werden.
4. Maßnahmen ableiten
Personalstrategie, MaßnahmenNun müssen für die strategisch wirksamen Optionen konkrete Maßnahmen definiert und geplant werden. Das bedeutet:
Instrumente gestalten
Projekte aufsetzen
Programme entwerfen
KPIs entwickeln
5. Strategie kommunizieren
Personalstrategie, KommunikationJetzt muss die Personalstrategie formuliert werden. Was aus den Prozessen heraus beschlossen wurde, wird nun in die bestehenden Prozesse, Instrumente und Produkte integriert. Wichtig ist hier die Methode des Storytellings, um die Strategiethemen verständlich zu kommunizieren. Dazu gehört zu erläutern, wie die Strategie umgesetzt werden soll, aber auch, warum sie überhaupt notwendig ist. Im Zuge der Kommunikationsstrategie müssen Roadshows organisiert und Dialogformate konzipiert werden.
6. Maßnahmen integrieren und umsetzen
Personalstrategie, UmsetzungIm letzten Schritt geht es um die Integration der neuen Strategie und die Entwicklung eines Umsetzungsplans. Um dies zu gewährleisten, muss die Personalstrategie unbedingt in der Personalplanung berücksichtigt werden. Damit die Unternehmensleitung regelmäßig über die Arbeitsergebnisse informiert wird, sollte eine Erfolgskontrolle installiert werden.
2.3.2 Ein weiterer Prozess der Entwicklung einer Personalstrategie
In einem Workbook zur Personalstrategie 2022 der Firma Cegid (Talentsoft) ist der Prozess der Entwicklung einer Personalstrategie in folgende Schritte unterteilt:
1. Verständnis der Geschäftsstrategie
Personalstrategie, Verständnis der GeschäftsstrategieZunächst geht es darum, die Geschäftsstrategie zu verstehen. Dazu gehört, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) zu kennen sowie um die Geschäftsziele zu wissen und die daraus folgenden Auswirkungen auf das Personalgeschäft.
2. Festlegung der HR-Strategie
Personalstrategie, HR-StrategieAnalyse der aktuellen Situation
Zur Analyse der aktuellen Situation gehören die Überprüfung der Unternehmenskultur, Überlegungen zur Organisationsstruktur, Feststellung des Verbesserungsbedarfs der Personalarbeit sowie das Erkennen der Lücken in der HR-Technologie.
Festlegung der HR-Ziele
Durch die Kenntnis der Geschäftsstrategie ist es jetzt möglich, HR-Ziele zu benennen, die durch die Verknüpfung mit der Geschäftsstrategie helfen, die Ziele des Unternehmens zu unterstützen. Die Ziele sollten realistisch und mit Meilensteinen versehen sein, um den Erfolg messen zu können.
Priorisierung von Investitionen in HR-Technologie
In Ableitung der obigen HR-Ziele werden die erforderlichen HR- Technologien festgelegt. Dabei muss die Auswahl und die Art der Software kritisch geprüft werden.
2.3.3 Mit einem strukturierten und integrierten Entwicklungsprozesses zur Personalstrategie
Personalstrategie, FaktorenIn einem Whitepaper der Firma Horvath & Partners findet sich ebenfalls ein Weg, um eine erfolgreiche HR-Strategie zu entwickeln. Sie sollte durch einen strukturierten und integrierten Entwicklungsprozess erfolgen, in dem folgende Faktoren identifiziert, analysiert und festgelegt werden:
Trends und Herausforderungen: Unternehmensstrategie, SWOT-Analyse, Herausforderungen für den HR-Bereich
Strategische Erfolgsfaktoren: Festlegung der künftigen Soll-Stände im Abgleich mit den jetzigen Ist-Zuständen
Strategische Leitlinien: Durch die Bildung eines Lenkungsausschusses mit Geschäftsführung und HR-Verantwortlichen wird gewährleistet, dass Leitlinien für die Bereiche Kerngeschäft HR, Märkte und Standorte der HR-Organisation, Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden und externen Partnern sowie die Struktur von HR berücksichtigt werden.
Strategische Eckpfeiler: Durch eine Kombination der ersten Phasen und des Wissens der Beteiligten sowie der Leitlinien werden erste Eckpfeiler formuliert und Prioritäten festgelegt.
Strategische Ziele: Personalstrategie, Balanced ScorecardBalanced ScorecardAuf der Basis der gewonnenen Kenntnisse und einer Balanced Scorecard wird eine Strategielandkarte entwickelt. So werden die Verbindungen zwischen Potenzialen, Prozessen, Kunden und Finanzen aufgezeigt. Wichtig sind die Wirkungszusammenhänge der Zieldimensionen, das Erstellen eines Steckbriefs für jedes Ziel und die Benennung eines Verantwortlichen.
KPIs, strategische Maßnahmen und eine Roadmap: Personalstrategie, KPIsNach Abschluss der Phasen wird der Verantwortliche strategische Maßnahmen erarbeiten, KPIs heranziehen und eine Roadmap erstellen.
2.3.4 Mit einem nachhaltigen Strategieprozess und OKR zur Personalstrategie
Personalstrategie, Objectives and Key Results (OKR)Objectives and Key Results (OKR)In einem Whitepaper stellt Haufe Talent einen nachhaltigen Strategieprozess mit Objectives and Key Results (OKR) dar. OKR ist ein Management-Modell, das auf Zielen und Schlüsselergebnissen beruht. Der Prozess bezieht sich dabei auf die Entwicklung einer Geschäftsstrategie, kann aber genauso für eine Personalstrategie genutzt werden.
Als allgemeine Voraussetzung kann gelten: Wir leben mittlerweile in einer VUCA-Welt (VUCA ist ein Akronym und steht für Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität). Leitplanken verändern sich rasch und wir müssen uns auf immer wieder neue Rahmenbedingungen einstellen, die eine hohe Flexibilität erfordern. Umso schwerer ist es, mittel- oder langfristige Strategien zu implementieren. Hier die wichtigsten Punkte:
Objectives and Key Results (OKR), ProzessProzess in Gang setzen: Nachdem das oberste Management aus seiner Vision eine mittelfristige Strategie abgeleitet hat, müssen gemeinsam mit dem mittleren Management die konkreten Ziele für das kommende Geschäftsjahr geplant werden.
Objectives and Key Results (OKR), RollenRollen definieren:
Leadership/Sponsor und OKR-Master – Schlüsselrollen und für den gesamten Prozess verantwortlich
OKR-Coach – direkte Ansprechperson für die einzelnen Teams
OKR-Teams – kleinste Einheiten, verantwortlich für die Definition ihrer Ziele und Schlüsselergebnisse
Objectives and Key Results (OKR), GuidelinesGuidelines entwickeln: Ein entscheidender Punkt ist, dass der Prozess nicht top-down erfolgt. Er sollte top-down für die Vision sein, aber auch bottom-up und sideways, um das mittlere Management und die Mitarbeitenden konstruktiv am Prozess zu beteiligen.
Hier einige Hinweise zu den Kernproblemen der erfolgreichen Strategieumsetzung sowie häufige Fehler in Personalstrategien:
Kernprobleme
Personalstrategie, Kernproblemeungenaue Vorgaben durch die Unternehmensstrategie
nicht zielgerichteter Strategieprozess auf HR-Ebene
fehlende Akzeptanz durch Führungskräfte und Mitarbeitende
ungenügende Implementierung
Fehler
Personalstrategie, FehlerKonzentration auf nur einige der vorhandenen Handlungsfelder und Vernachlässigung der anderen. Ein Beispiel wäre das Ziel »Abbau von Bürokratie«: Manche Maßnahmen bzw. Prozesse werden berücksichtigt, aber andere nicht.
Prozesse nicht ganzheitlich berücksichtigen, z. B. Schulung von Qualitäts- und Kundenserviceorientierung mit Seminaren für Mitarbeitende ohne gleichzeitige organisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der entsprechenden Prozesse
keine konkreten Formulierungen der zu erreichenden Ziele und ausweichende Aussagen
Wichtig
Sowohl die Themen als auch die Ziele sollten im Einklang mit der Unternehmenskultur, der Führungsphilosophie, der Werte und dem Mitarbeiterverständnis stehen.
Wie stelle ich die erfolgreiche Entwicklung einer HR-Strategie sicher?
Personalstrategie, Erfolgsfaktorenklare Vorgaben aus der Unternehmensstrategie
Verfolgen eines definierten HR-Strategieprozesses
Einbeziehung der Geschäftsleitung und der Mitarbeitenden in den Strategieprozess
Blick über den eigenen Tellerrand
festgelegte Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation
eindeutig formulierte Ziele und KPIs
abgestimmte Umsetzungsplanung
konsequentes Umsetzungsmonitoring und regelmäßige Strategiereviews
3 Konzepte und Modelle des strategischen Personalmanagements
»Strategy without tactics is the slowest route to victory, tactics without strategy is the noise before defeat.«
Sunzi, chinesischer General, Militärstratege und Philosoph
strategisches Personalmanagement, Konzeptestrategisches Personalmanagement, ModelleNach den einführenden Worten aus dem letzten Kapitel sollen im nächsten Schritt Modelle und Konzeptionen des strategischen Personalmanagements vorgestellt werden. Dabei ist es wichtig, vorab Überlegungen anzustellen, in welche Richtung sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln soll. Um eine Grundlage dafür zu schaffen, das strategische Personalmanagement in einen nachvollziehbaren Zusammenhang zu stellen, werden zunächst einige der bekanntesten Modelle vorgestellt.
3.1 Modelle des strategischen Personalmanagements
Das Drei-Säulen-Modell
Drei-Säulen-ModellIm Drei-Säulen-Modell werden Zusammenhänge und Abhängigkeiten verdeutlicht (Kolb, 2010, S. 25 ff.). Dazu gehören:
wichtige externe Einflussfaktoren
Auswirkungen auf die jeweilige Unternehmensstrategie und die Möglichkeiten, darauf zu reagieren
Spielräume der Personalpolitik und des strategischen Personalmanagements in Abhängigkeit von der herrschenden Unternehmensstrategie
Handlungsoptionen für die Steuerung des Personalmanagements, die sich auf alle Bereiche der Personalarbeit auswirken
Das Drei-Säulen-Modell (in Anlehnung an Kolb, 2010, S. 25, siehe Batz, 2021, S. 38)
Das Harvard-Modell des strategischen Personalmanagements
Harvard-ModellDas Harvard-Modell orientiert sich an den beiden Punkten Interessengruppen und situative Faktoren. Im Zusammenhang mit den Interessengruppen geht es um Anteilseigner, den Gesetzgeber sowie die Arbeitnehmervertretung und die Gewerkschaften. Inwieweit kann es hier zu veränderten Situationen kommen? Beispielsweise durch den Einstieg eines neuen Großaktionärs, durch die Veränderung der gesetzlichen Grundlagen oder durch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Die situativen Faktoren beziehen sich auf Änderungen der Unternehmenspolitik, den sich wandelnden Arbeitsmarkt (intern/extern) sowie neue Technologien.
Das Harvard-Modell des strategischen Personalmanagements (in Anlehnung an Kolb, 2010, S. 62, bezugnehmend auf Batz, 2021, S. 39)
Das Fünf-S-Modell des strategischen Personalmanagements
Fünf-S-ModellDas 5-S-Modell (Batz, 2021, S. 40 ff.) bezieht sich auf das Fünf-E-Modell von Ruth Stock-Homburg (2013, S. 3 f.), das aus den Faktoren effiziente Führung, Entlohnung und Erfolg, Einstellung von Mitarbeitern sowie Einsatz und Entwicklung des Personals besteht. Diese operativen Felder hat Batz in seinem Ansatz auf eine entsprechend strategische Ebene gehoben. Im Einzelnen sind das:
strategisch-effiziente Personalführung
strategisches Vergütungsmanagement und strategischer Erfolg
strategisches Recruiting und Retainment
strategischer Personaleinsatz
strategische Personalentwicklung
Die jeweiligen Felder werden in Kapitel 10 näher betrachtet.
Das Fünf-S-Modell (nach Batz, 2021, S. 41)
Darüber hinaus sind noch das St. Gallener Management-Modell, die Balanced Scorecard und das HR-Business-Partner-Modell bekannt. Die Balanced Scorecard wird im Kapitel 11.2 und das HR-Business-Partner-Modell in Kapitel 6 behandelt.
Das St. Gallener Management-Modell stellt einen umfassenden Orientierungsrahmen dar, der alle relevanten Einflüsse erfasst und sie in einen Zusammenhang stellt. Das Modell betrachtet sowohl die externen Faktoren wie Wirtschaft, Umwelt, Technik und Gesellschaft als auch Stakeholder und Anspruchsgruppen eines Unternehmens. Außerdem beinhaltet es die zentralen internen Prozesse, die Strukturen, Strategien, Werte und Normen sowie die Ressourcen.
3.2 Konzepte des strategischen Personalmanagements
Bei den Konzeptionen des strategischen Personalmanagements geht es sowohl um die Ausrichtung als auch um den Inhalt der jeweiligen Strategie. Es geht um Nachhaltigkeit, ESG (Environmental, Social, Governance), eine Konzeption für den Mittelstand oder auch das Problem einer Strategie für die Vollbeschäftigung.
3.2.1 ESG (Environmental, Social, Governance)
Environmental, Social, Governance (ESG)Immer stärker taucht der Begriff »ESG« in den Wirtschaftsteilen der Presse auf. Es wird berichtet, dass ESG ein zunehmend zentrales Thema in den Unternehmen ist. Es geht um die Nachhaltigkeitsagenda der EU (DGFP//Wissenswert – ESG und das Personalmanagement, Juni 2021), die darauf fokussiert ist, Unternehmen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele auszurichten. Dies ist der zweite Schritt, nachdem zunächst das Konzept der Sustainable Finance im Mittelpunkt stand. Hier ging es um die Finanzströme, deren Ausrichtung auf das Erreichen von politisch gesetzten Umwelt- und Sozialzielen beruhte. Unterstützt wurde Sustainable Finance durch regulatorische Vorgaben. Inzwischen spielen neben den ökologischen Themen sowohl Arbeitnehmerbelange sowie relevante Sozial- und Governanceaspekte als auch eine aussagekräftige Berichterstattung eine immer wesentlichere Rolle.
Was bedeutet das für das strategische Personalmanagement?
Welchen Beitrag können die verantwortlichen Personalmanager zum Erreichen der ESG-Ziele leisten? Die Ausgangslage stellt sich zurzeit sehr unterschiedlich dar. Hier einige Beispiele:
Grundsätzliches
Kriterien definieren für eine mit ESG abgestimmte Berichterstattung.
GAP-Analyse hinsichtlich der für die jeweilige Branche erforderlichen Ziel-Standards
ESG-Initiativen des Personalmanagements bezüglich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens
Verankerung in der Unternehmensorganisation
Aussagekräftige Berichterstattung
Umsetzungsthemen
Environmental, Social, Governance (ESG), UmsetzungsthemenEnvironmental, Social, Governance (ESG), Vergütungs- und BetriebsrentensystemNachhaltigkeit in Vergütungs- und Betriebsrentensystemen, z. B. gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit unabhängig vom Geschlecht, Koppelung variabler Vergütung an Nachhaltigkeitsziele, damit verbunden die klarere Benennung von Nachhaltigkeitszielen (Steigerung der Diversität, Maßnahmen des Arbeitsschutzes, nachhaltigkeitsbezogene Schulungen etc.). Bei Nichteinhaltung von z. B. Gleichbehandlung in der Bezahlung oder Nichtgewährung von Mindestlöhnen droht ein erheblicher Reputationsschaden.
Bei der betrieblichen Altersversorgung geht es auch um die Anlage der Gelder in nachhaltigen Branchen und um die Vermeidung von Anlagen in kritischen Branchen (Rüstung, Produktion mit Kinderarbeit und umweltschädliche Branchen wie Kohle).
Environmental, Social, Governance (ESG), ArbeitsschutzEnvironmental, Social, Governance (ESG), ArbeitssicherheitArbeitsschutz und Arbeitssicherheit: Neben dem Erkennen und der Vermeidung von Gefahren für Leib und Leben geht es auch um den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung. Dazu gehören das Arbeitszeitrecht und das Einhalten von Höchstarbeitszeiten sowie Ruhe- und Pausenregelungen. In Deutschland ist durch das Arbeitsschutzrecht und die Regelungen der gesetzlichen Unfallversicherungen bereits ein hoher Standard gesetzt.
Environmental, Social, Governance (ESG), UnternehmenspolitikNachhaltige Unternehmenspolitik beinhaltet nicht nur das bloße Verbot von Diskriminierung, sondern wirkt positiv auf die Förderung und gleichberechtigte Teilhabe von Minderheiten. Über die Bestimmungen des AGG hinaus bestehen in Deutschland bereits weitreichende Regelungen zum Schutz und zur Förderung schwerbehinderter Menschen und diesen gleichstellten Personen.
Eine Benachteiligung bestimmter Gruppen kann durchaus zu einer Verknappung qualifizierter Mitarbeitender führen. Auch in der Außenwirkung kann ein solches Verhalten zu einer Verschlechterung der Reputation eines Unternehmens führen.
Die Berichterstattung sollte darüber hinaus detaillierte Informationen zum Thema Diversity beinhalten.
Environmental, Social, Governance (ESG), PersonalentwicklungEnvironmental, Social, Governance (ESG), Aus- und WeiterbildungEnvironmental, Social, Governance (ESG), QualifizierungIn den Bereichen Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung sowie der Qualifizierung ist eine nachhaltige Unternehmensentwicklung von besonderer Bedeutung. Es sollte für jedes Unternehmen ein wichtiges Anliegen sein, die eigenen Talente immer wieder zu fördern. Für die Mitarbeitenden ist es wesentlich, sich innerhalb des Unternehmens und der bestehenden Arbeitsumgebung weiterzuentwickeln, um so dauerhaft in Beschäftigung sein zu können.
In der Ausbildung und der Qualifizierung beziehen sich alle Maßnahmen auf die eigenen Mitarbeitenden. Alle Initiativen sind auf die Erhaltung und Erweiterung der Fähigkeiten und Kenntnisse ausgerichtet.
Auch in der entsprechenden Berichterstattung sollte über die Art und Anzahl der Programme, die zur Beseitigung von Defiziten führen, ausführlich Stellung genommen werden.
Environmental, Social, Governance (ESG), DatenschutzBeim Datenschutz geht es aus Nachhaltigkeitssicht um die Einhaltung der weitreichenden gesetzlichen Regelungen. Hier ist ebenfalls eine ausführliche Berichterstattung erforderlich. Dazu gehört nicht nur die Beschreibung der vorhandenen Systeme, sondern auch Angaben zur Anzahl der Mitarbeitenden, die mit sensiblen Daten arbeiten. Darüber hinaus soll es eine Aussage dazu geben, wie viele Schulungen hierzu durchgeführt werden. Nicht zu vergessen ist die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten sowie eines IT-Sicherheitsbeauftragten.
Environmental, Social, Governance (ESG), Work-Life-BalanceEin weiterer Punkt ist die Work-Life-Balance. Hierbei zeichnet sich die nachhaltige Unternehmensführung durch Maßnahmen aus, die das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben ermöglichen sollen.
Beispiele dafür sind Elternzeit, Sabbaticals, flexible Arbeitszeitmodelle oder das Arbeiten im Homeoffice. In den Unternehmensberichten dazu werden Informationen über die Förderung der gleichberechtigten Übernahme von Betreuungsaufgaben und Aussagen über die Anzahl von Rückkehrern und deren Eingliederung erwartet.
Environmental, Social, Governance (ESG), AnweisungenUnternehmen sollten ihre Nachhaltigkeitsbemühungen durch entsprechende Anweisungen auf allen Ebenen verankern. Dieses geschieht im Normalfall durch die Implementierung von Ethikrichtlinien oder einen Verhaltenskodex. Im Nachhaltigkeitsberichtswesen sollte beides veröffentlicht werden.
Environmental, Social, Governance (ESG), Nachverfolgung der WirksamkeitWeiterhin sind die Firmen angehalten, die Wirksamkeit ihrer Bemühungen nachzuverfolgen. Das geschieht durch interne oder externe Überwachungs- und Auditierungssysteme. Die Wirksamkeit der Maßnahmen kann durch Audits, Zertifizierungen, Messsysteme oder Beschwerdemechanismen verfolgt werden. Das gilt auch für den betrieblichen Gesundheitsschutz, in dessen Rahmen regelmäßige oder anlassbezogene Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden müssen.
Auch hier werden im Berichtswesen Informationen erwartet.
Environmental, Social, Governance (ESG), kollektive ArbeitsbedingungenEinen besonderen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die Geltung kollektiver Arbeitsbedingungen (Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen). Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass die Mitarbeitenden, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen einbezogen werden.
Dazu ist ebenfalls im Berichtswesen detailliert Stellung zu beziehen.
Prof. Dr. Rupert Felder (Heidelberger Druckmaschinen) hat im Personalmagazin 07/2021 im Kontext von Green HR zwölf Ansatzpunkte genannt, die für mehr Nachhaltigkeit stehen:
Vergütung
Environmental, Social, Governance (ESG), VergütungEnvironmental, Social, Governance (ESG), Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)Dazu gibt es drei Ansätze:
Der erste ist der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK). In der jetzt aktualisierten Fassung wird die Vergütung der Vorstände durch eine Nachhaltigkeitskomponente ergänzt. Grundlage ist die Europäische Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II). Es geht hierbei um die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Unternehmen. Neu ist die Ausrichtung der Vergütung in diesem Sinne. Viele Firmen haben das in den Long-Term Incentives als ein weiteres Ziel aufgenommen.
Environmental, Social, Governance (ESG), Recurring RevenueRecurring RevenueDer zweite Ansatz ist die Incentivierung von »Recurring Revenue«. Dabei geht es nicht um den einmaligen Provisionsertrag, sondern um die regelmäßig wiederkehrenden Erlöse aus einer langfristig angelegten Nutzung.
Environmental, Social, Governance (ESG), MitarbeitendenbeteiligungDie dritte Idee ist die Mitarbeitendenbeteiligung. Dadurch werden die Beschäftigten zu Anteilseignern und sind an einer langfristig erfolgreichen Entwicklung interessiert. Des Weiteren lassen sich auch in den Zielvereinbarungen Umweltziele einbauen.
Fürsorge
Environmental, Social, Governance (ESG), FürsorgeDurch die Coronapandemie hat der Begriff »Fürsorge« eine neue Qualität gewonnen. Vor allem ist deutlich geworden, dass eine Pandemie den betrieblichen Ablauf erheblich beeinträchtigen kann. Natürlich sind die Regeln der Berufsgenossenschaften, die Gesetze des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit erforderlich. Noch relevanter ist hierbei die Prävention. Das betrifft nicht nur eine Pandemie (Desinfektion, Masken und Tests), sondern auch die Bereiche der Notfallbetreuung, Grippeschutzimpfungen, Sehtests, Krebsvorsorge und anderes.
Daneben sind auch freiwillige Aktionen für den Umweltschutz und die Beschäftigungssicherheit Faktoren für die Nachhaltigkeit.
Bildung und Qualifizierung
Environmental, Social, Governance (ESG), BildungEnvironmental, Social, Governance (ESG), QualifizierungEin wesentlicher Hebel für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist die Qualifizierung. Es geht um den Erhalt der Arbeitsfähigkeit. »Predictive HR«, also das Vorausschauende, wird zu einer festen Größe. Das gilt nicht nur für die qualitative, sondern auch für die quantitative Personalplanung.
Remote Work
Environmental, Social, Governance (ESG), Remote WorkUm den Transformationsprozess zu schaffen, müssen alle Mitarbeitenden diesen annehmen und mitgestalten und so das Zielbild unterstützen. Das gilt nicht nur für den Arbeitsinhalt, sondern auch für die Arbeitserbringung. Nur so kann es zu betrieblichen Vereinbarungen zu Remote Work und Präsenzarbeit kommen. Auch der Gesetzgeber schafft Regelungen für das Homeoffice.
Die Veränderung der Arbeitswelt führt auf Arbeitgeberseite zu einer veränderten Herangehensweise. »Fluid Companies« akzeptieren, dass Spezialisten nicht dauerhaft im Betrieb sind, und sorgen dafür, dass die Prozesse der Bindung und Trennung professionell gestaltet werden. Dies ist in der Personalplanung entsprechend zu berücksichtigen.
Gesundheitsmanagement
Environmental, Social, Governance (ESG), GesundheitsmanagementHier geht es nicht nur um die medizinische Verfassung, sondern um das Wohlbefinden jedes Einzelnen. Es geht um die körperliche und geistige Übereinstimmung zwischen den Anforderungen und dem, was die einzelne Person leisten kann. Inzwischen führen Unternehmen in Mitarbeiterbefragungen auch den »Health Check« durch, um das Wohlbefinden zu erfassen.
Bei Unternehmen, die bereits ein professionelles Gesundheitsmanagement eingeführt haben, gibt es Instrumente, die das Wohlbefinden steigern können wie z. B.:
bewegte Pausen
Durchführung einer Obstwoche
Schrittzählaktion
Installation eines »Rückenmobils«
gemeinsame Spielregeln für Konflikte
Rotation der Tätigkeiten
Achtsamkeitskurse für den Umgang mit Belastungen
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Führungskräfteschulung »Gesundes Führen«
Die Steuergesetzgebung fördert die Aktivitäten der Firmen (§ 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz). 600 Euro Aufwendungen pro Mitarbeitenden sind im Jahr lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.
Stakeholder-Management
Environmental, Social, Governance (ESG), Stakeholder-ManagementEs ist wichtig, die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten zu kennen, die zur Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie beitragen können. Betriebsrat und Belegschaft sind zwei wesentliche Stakeholder des Veränderungsmanagements. Regelungen dazu können als Betriebsvereinbarung formuliert werden. Nach den Mitbestimmungsregelungen ist der Betriebsrat zentraler Verhandlungspartner. Deswegen könnten beispielsweise folgende Regelungen aufgestellt werden:
Erstellen von Führungsgrundsätzen und Verhaltensrichtlinien
Reiseregelung mit Verbot von Flugreisen bis zu einer bestimmten Distanz
Vergütungsanreize für Nachhaltigkeit
Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes
Recruitingvorgaben zur Vermeidung von Diskriminierung
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes
Nachhaltigkeit als Beruf
Environmental, Social, Governance (ESG), neue BerufsbilderDurch die Implementierung der Nachhaltigkeit entstehen neue Berufsbilder. Man spricht vom Nachhaltigkeitsmanager oder vom Sustainability-Beauftragten. Auch an den Hochschulen gibt es inzwischen ein Feld von »Grünen Studiengängen«. Man bezeichnet »Green Jobs« als Arbeitsplätze im Umweltschutz oder wenn Nachhaltigkeit im Fokus steht. Daneben werden »Good Jobs« schwerpunktmäßig im sozialen Bereich gesehen. »Good Companies« entstehen durch nachhaltige oder soziale Ziele.
Nachhaltigkeitskultur
Environmental, Social, Governance (ESG), NachhaltigkeitskulturIm Mittelpunkt der Nachhaltigkeitskultur steht die Einschätzung und Positionierung des »Faktors Mensch«. Die Personalabteilung sollte dazu beitragen, Nachhaltigkeitsaspekte in die Führungsgrundsätze einzubauen. Man muss deutlich machen, dass Führung heute keine Frage von Macht und Status ist, sondern Orientierung bietet, Verständnis schafft und Sicherheit gibt. Das bedeutet:
Netzwerke statt hierarchischer Strukturen
Kollaboration statt Kontrolle
agile Projektarbeit statt hierarchischer Projektstruktur
Die Vorgesetztenrolle wird bestimmt durch das Organisieren von Strukturen, Budgets, Räumen und Aufträgen. Führung bedeutet anzuleiten und zu koordinieren.
Es ist die Aufgabe der Personalarbeit, das neue Zielbild bewusst zu machen und für Klarheit in den Rahmenbedingungen und den Instrumenten zu sorgen.
Betrieblicher Umweltschutz
Environmental, Social, Governance (ESG), betrieblicher UmweltschutzJedes Unternehmen benötigt einen CO2-Fußabdruck. Die Frage ist, wie man diesen sichtbar machen kann. Hier ein paar Beispiele:
Zertifizierung ganzer Unternehmen oder einzelner Bereiche
Labels und Selbstverpflichtungen wie der Beitritt zum »Global Compact« (UN-Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmungsführung)
nachhaltiger Einkauf (vom Material für die Produktion bis zum Büromobiliar).
Diese und weitere Ideen führen zu einem Umweltbewusstsein, das allerdings auch bei jedem Einzelnen beginnen kann. Ein paar Beispiele: mit dem Rad zur Arbeit fahren, Teilnahme an Spendenläufen oder Ähnliches.
Das Umweltbewusstsein muss künftig zur Arbeitgebermarke gehören und nicht bloß zu einem »Greenwashing« verkommen.
Berufsausbildung
Environmental, Social, Governance (ESG), BerufsausbildungDie Berufsausbildung ist eines der Schlüsselthemen, um in der Zukunft eine nachhaltige Personalpolitik betreiben zu können. Hierbei müssen in den Bereichen des Unternehmens, in denen ausgebildet wird, die künftigen Bedarfe (qualitativ und quantitativ) sowie künftige Berufsbilder analysiert werden.
Schon die Ausbildung an sich ist durch ihre Dauer über mehrere Jahre ein nachhaltiger Prozess. In ihrem Rahmen lassen sich viele Aspekte von Nachhaltigkeit behandeln. Hinweise auf eine entsprechende Haltung und Handlungsweise, Bausteine wie ein Gesundheits- oder Ernährungstag bis hin zu sozialen und ökologischen Projekten zeigen die richtige Vorgehensweise eines Unternehmens auf.
Recruiting
Environmental, Social, Governance (ESG), RecruitingÄhnlich wie in der Berufsausbildung muss auch im Recruiting frühzeitig ein nachhaltiger Prozess in Gang gesetzt werden. Die Arbeitgebermarke sollte daher nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch vorbildlich sein. Das kann dadurch bewirkt werden, dass
Produkte für den Markt attraktiv sind und eine positive Umweltbilanz besitzen,
Produktionsprozesse einen großen Ressourcenverbrauch vermeiden und
das Arbeitgeberverhalten sowohl in der Lohnpolitik als auch bei den Arbeitsbedingungen sozial ist.
Bei dieser Ausgangslage ist es wichtig, dass die Bewerber mit ihrer inneren Haltung zu den Zielsetzungen und Werten des Unternehmens passen.
Travel-Management
Environmental, Social, Governance (ESG), Travel-ManagementDie Coronapandemie hat verdeutlicht, dass Dienstreisen nicht immer unbedingt notwendig sind. Videokonferenzen statt Präsenzveranstaltungen, Homeoffice statt Großraumbüro oder gar Reisen – das waren die Konsequenzen. Das wird sich wieder ändern, aber auf das Ausgangsniveau vor der Pandemie werden wir nicht mehr zurückkehren. Andererseits hat die Pandemie verdeutlicht, was für einen Stellenwert persönliche Beziehungen haben können. Für Unternehmen wird es wichtig, sich auf alternative Mobilität einzulassen. Das kann sowohl E-Autos beinhalten als auch vor allem Dienstfahrräder oder Jobtickets für den Nahverkehr. Ansonsten sollten die Reiserichtlinien dahin gehend überarbeitet werden, dass Reisen nur mit bestimmten Verkehrsmitteln erlaubt sind und dass ggf. alternative Kommunikation überlegt werden sollte.
In einem weiteren Schritt soll hier verdeutlicht werden, welche Ansätze HR hat, um ESG-konform wirtschaften zu können (Personalwirtschaft 06/2022, S. 22 ff.). Folgende Bereiche sollten hier berücksichtigt werden:
Environmental, Social, Governance (ESG), RecruitingRecruiting
Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten gewinnen
transparente Kommunikation
Erwähnung im Vorstellungsgespräch
Karriereevents ökologisch gestalten
Environmental, Social, Governance (ESG), VergütungEnvironmental, Social, Governance (ESG), BenefitsVergütung und Benefits
Boni an Nachhaltigkeitszielen ausrichten
Benefits nachhaltig gestalten (Jobtickets, Fahrräder)
bAV sicherstellen, damit Mitarbeitende im Ruhestand gut leben können
Environmental, Social, Governance (ESG), ArbeitssicherheitEnvironmental, Social, Governance (ESG), betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)BGM und Arbeitssicherheit
Angebote zur Gesundheitsförderung
Arbeitssicherheit
gesunde und ökologisch nachhaltige Kantine
Environmental, Social, Governance (ESG), PurposeEnvironmental, Social, Governance (ESG), WertePurpose und Werte
Nachhaltigkeit verankern
konsequent anwenden und vorleben
Kommunikation
Environmental, Social, Governance (ESG), FührungFührung
Leader motivieren, Vorbild zu sein
Selbstverständnis neu definieren
Environmental, Social, Governance (ESG), WeiterbildungWeiterbildung
Fortbildungen für neue Produktionsweisen
Wissensvermittlung zum Thema Nachhaltigkeit
Environmental, Social, Governance (ESG), MitarbeitendenbindungMitarbeitendenbindung
Mitspracherecht
den Menschen ins Zentrum stellen
Personalmangel vorbeugen
Environmental, Social, Governance (ESG), Employer BrandingEmployer Branding
öffentlichkeitswirksam kommunizieren
nicht übertreiben
Environmental, Social, Governance (ESG), ArbeitsortArbeitsort
Homeoffice anbieten
nachhaltig produzierte Büroelemente bereitstellen
Digitalisierung von Dokumenten fördern
Energieverbrauch optimieren
Environmental, Social, Governance (ESG), Webcrawler für HR-TrendsDas UnternehmenFestohat einen sogenannten Webcrawler entwickelt, der den HR-Bereich beim Scouting, der Evaluierung und der Pilotierung von HR-Trends sowie bei Innovationen unterstützt (Personalmagazin 03/2021). Dabei wurden zwei Ziele verfolgt:
Schaffung einer Innovationsplattform zur Erkennung von HR-Trends mithilfe des Webcrawlers
automatisiertes Skill-Matching von Mitarbeitenden auf der Basis ihres Skill-Profils zu Innovationsprojekten
Die Firma hat sich bezüglich der relevanten Megatrends auf die Prognosen eines Zukunftsinstituts (St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Science) gestützt. Die Megatrends umfassen alle Ebenen der Gesellschaft und verändern die Entwicklung langsam, dafür aber grundlegend und langfristig. Das HR-Produktportfolio bringt die personalpolitische Bedeutung in den Innovationsprozess ein. Dadurch und durch die Einschaltung von HR-Experten wird es ermöglicht, relevante Trends von bloßen Modethemen zu unterscheiden. Der Webcrawler unterstützt bei der Suche nach interessanten Beiträgen und Artikeln. Grundlage dafür sind Keywords und die Indexierung relevanter Quellen im Web.
Sobald Innovationsprojekte ausgewählt wurden, wird für jedes Projekt ein Skillprofil angelegt. Dadurch wird es möglich, entsprechende externe oder interne Mitarbeitende zu finden.
Folgende Erfolgsfaktoren haben sich ergeben:
Wir benötigen ein Bewusstsein für Innovationen im HR-Bereich, um die Zukunft von HR heute schon mitzugestalten.
Wir brauchen ein gemeinsames HR- und Innovationsverständnis, damit Kommunikation und Zusammenarbeit gelingen.
Es wurden mehrere technologische Ansätze untersucht, um Chancen und Limitationen abschätzen zu können.
Von Beginn an wurde die Kundenperspektive als Erfolgsfaktor betrachtet.
Es wurde ein ansprechendes User-Interface im Fokus behalten, sodass das Tool auch genutzt wird.
Environmental, Social, Governance (ESG), HauptthemenEnvironmental, Social, Governance (ESG), UmsetzungsgradAbschließend sollen dazu die wesentlichen Ergebnisse aus zwei Studien aufgezeigt werden. Im Global Risk Report 2021 des Wirtschaftsforums von Marsh McLennan wird ausgeführt, dass lediglich ein Drittel der Führungskräfte ESG-Ziele in die Scorecards integriert haben. Die gestiegene Priorität von Nachhaltigkeit wird von den Unternehmen wahrgenommen. Drei Viertel von ihnen geben an, dass ESG bereits eine Kernpriorität ihres unternehmerischen Handelns darstellt. Als Treiber werden in erster Linie die Kundschaft und die Shareholder genannt. Die Mitarbeitenden gaben zu 49 Prozent an, dass sie einen Arbeitgeber bevorzugen, der sich aktiv um das soziale und finanzielle Wohlbefinden der Belegschaft kümmert. Durch diesen Handlungsdruck kommt es auch zur Integration dieser Themen in die HR-Strategie.
Eine weitere Studie (Hochschule Niederrhein 2021, Personalmagazin 11/2021) hat erfasst, welche die am häufigsten genannten Green-HRM-Maßnahmen sind. Dazu zählen flexible Arbeitszeiten/Homeoffice mit 69 Prozent. Weitere Punkte sind die Kommunikation der »grünen« Arbeitgebermarke, ÖPNV-Tickets, Umwelttage und -projekte sowie Betriebsräder, Schulungen/Workshops und ein Fuhrpark mit E-Autos. Nur eine Minderheit der befragten Unternehmen (25 %) reagiert mit einer zielgerichteten Rückmeldung auf die Anfrage eines Bewerbers zu Green HRM.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die Mehrzahl der Unternehmen inhaltlich mit ESG-Themen befasst hat, aber nur eine Minderheit diese bereits umgesetzt hat.
Ein nachhaltiges Personalprozessmodell (nach Meißner, 2021)
3.2.2 Eine Personalstrategie für den Mittelstand
Personalstrategie, MittelstandNeben einer inhaltlich begründeten Personalstrategie ist es wichtig, sich auch mit dem Empfängerkreis auseinanderzusetzen, im Folgenden mit dem Mittelstand.
Der Schwerpunkt einer mittelstandsorientierten Strategie sind die jeweils spezifischen Stärken und die unterschiedliche Ausgangslage. Daher ist es wichtig, sich zu Beginn der Erstellung einer Strategie mit den Erwartungen und Anforderungen an die Arbeitsstrukturen und Personalressourcen auseinanderzusetzen.
Was ist erforderlich und notwendig? Mit welchen Lösungsansätzen wird der Mittelständler im globalen Wettbewerb gestärkt?
Personalstrategie, HerausforderungenDie zukünftigen Herausforderungen sind:
Arbeitsprozesse global und nachhaltig gestalten und an die vernetzten Wirtschaftsstrukturen anpassen
Fachkräfte gewinnen und binden
geeignete Nachwuchskräfte selbst ausbilden und adäquat qualifizieren
die interne und externe Kommunikation international ausrichten
Beschäftigte qualifizieren, um die internationalen Aufgaben bewältigen zu können
Personalstrategie, HandlungsfelderUm diese Herausforderungen auf die betriebliche Personalpolitik zu begrenzen, wurde in einem Projekt (vom RKW-Kompetenzzentrum und dem BfWuE – 2014 gefördert; Leis et al., 2014) eine mehrstufige Herangehensweise gewählt. Nach Feststellung des Status quo und der Ermittlung der Handlungsfelder wurden in Telefoninterviews mit Experten (Multiplikatoren, Betriebsräten und Personalverantwortlichen) die Identifikation der Handlungsfelder verstärkt. Weiterhin wurden in einem Expertenarbeitskreis die Ergebnisse reflektiert und Lösungsansätze aufbereitet. Im Folgenden die Ergebnisse:
Die Personalplanung muss strategisch ausgerichtet werden und den permanenten Veränderungsprozess im Unternehmen begleiten.
Vorhandenes Wissen muss ständig aktualisiert werden, um dem Qualifizierungsdruck gerecht zu werden.
Abstimmungsprozesse und Tätigkeiten werden komplexer.
Kunden fordern immer individuellere Lösungen bei gleichzeitigem Preisdruck.
Daraus folgt, dass die Standardisierung abnimmt, der Projektdruck steigt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leidet, eine geringere Anerkennung der Leistung stattfindet sowie Druck und psychische Belastung zunehmen.
Wie kann man dem begegnen?
Personalstrategie, mitarbeiterorientiertemitarbeiterorientierte PersonalstrategieEin Ansatz, der hier beschrieben werden soll, ist die Implementierung einer mitarbeiterorientierten Personalstrategie. Diese und eine entsprechende Qualifizierungsplanung und Personalentwicklung sind die wesentlichen Bausteine, um die genannten Herausforderungen für den Mittelstand zu meistern.
Personalstrategie, Schwerpunktemitarbeiterorientierte Personalstrategie, SchwerpunkteIm Hinblick auf die Personalstrategie wurden die folgenden Schwerpunkte herausgearbeitet:
humanzentrierte Unternehmensphilosophie: Personal als wichtigste Ressource bzw. Investition
nachhaltige Personalplanung, Fachkräftesicherung, Aufbau stabiler Arbeitsstrukturen und sicherer Arbeitsplätze
Gestaltung attraktiver Arbeitsbedingungen (Work-Life-Balance, Gesundheitsmanagement, altersgerechtes Arbeiten, Mitarbeitermotivation und faire Bezahlung
Personalstrategie, QualifizierungPersonalstrategie, PersonalentwicklungFür die Qualifizierung und Personalentwicklung wurden folgende Punkte herausgearbeitet:
Beratung bei Weiterbildung
Einrichtung einer Kommunikationsplattform für fachlichen Austausch
praktische Lösungen (z. B. Checklisten, Analyseinstrumente)
Praxishilfen für die betrieblichen Parteien (Arbeitgeber und Betriebsrat)
Good-Practice-Beispiele als sinnvolle Ergänzung
Abschließend eine Zusammenfassung von Gründen für bzw. Hindernissen bei einer mitarbeiterorientierten Personalstrategie:
Gründe
mitarbeiterorientierte Personalstrategie, GründeWenn sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren, werden sie zu Innovationstreibern.
KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) – Mitarbeiter bringen eigene Ideen und Verbesserungen in das Unternehmen.
Mitarbeiter sind motivierter. Das führt dazu, dass sich die Produktivität des Unternehmens erhöht.
Die Mitarbeiterorientierung spricht sich herum. Die Arbeitgeberattraktivität in den üblichen Portalen wird positiver bewertet.
Die Mitarbeitenden fühlen sich ernst genommen und respektiert hinsichtlich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. Die MA-Zufriedenheit wird gesteigert.
Fachkräftemangel: Das Potenzial hochqualifizierter Frauen, von Älteren sowie von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund darf nicht unterschätzt und muss deswegen genutzt werden. Es bedarf allerdings unterschiedlicher Vorgehensweisen.
Eine persönliche Ansprache und ein gut funktionierendes Beziehungsmanagement helfen in diesem Zusammenhang. Gut sind kurze Entscheidungswege und individuelle Vorgehensweisen.
Eine strategische und systematische Personalbedarfsplanung und Personalentwicklungsplanung erleichtern vieles. Was sind die Kompetenzen meiner Belegschaft und können sie in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden? Welche Tätigkeitsfelder mit welchen Kompetenzen werden in der Zukunft benötigt? Es hilft, kontinuierlich Mitarbeitergespräche zu führen.
Insourcing zur Optimierung von Prozessen erleichtert das Outsourcing administrativer Tätigkeiten.
Hindernisse
mitarbeiterorientierte Personalstrategie, HindernisseDurch Kundenanforderungen nach spezielleren und individuelleren Lösungen bei gleichbleibenden Kosten geraten Unternehmen unter Druck, den sie öfter nach unten weitergeben.
Die Einführung von Standardisierungen zum Ausgleich von Preisabsenkungen wird von den Mitarbeitenden häufig als Abwertung ihrer Arbeit wahrgenommen. Gleichzeitig steigt die Austauschbarkeit von Spezialisten.
Andererseits führen die Globalisierung und die damit einhergehende Arbeitsteilung zu komplexeren und hochwertigeren Tätigkeiten. Die Abstimmungen werden schwieriger, die Mitarbeitenden internationaler und der Druck größer:
Unterschiedliche Kulturen prallen aufeinander, interkulturelle Kompetenzen fehlen. Der Mittelstand hat wenig Erfahrung mit ausländischen Märkten.
Der Ausgleich von Berufs- und Privatleben ist bei gleichzeitiger hoher Flexibilität des Personaleinsatzes schwierig. Außerdem fehlen oftmals Unterstützungsangebote der Unternehmen.
Die Wahrnehmung der Mitarbeitenden ändert sich. Sie empfinden mangelnde Anerkennung ihrer Kompetenzen und Leistungen, die Motivation sinkt, die Stimmung im Betrieb droht zu kippen.