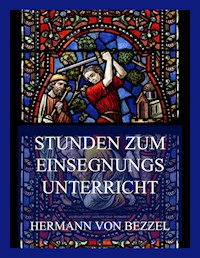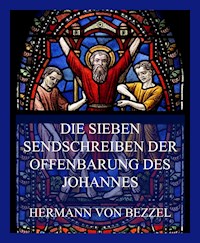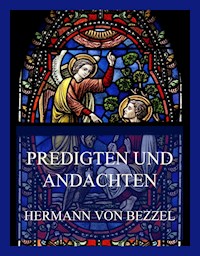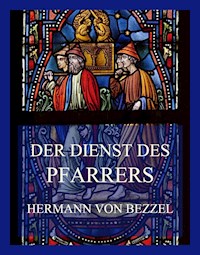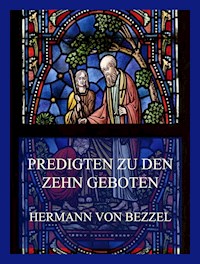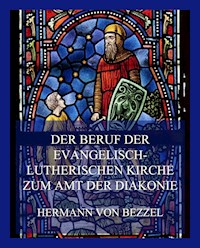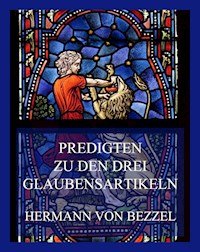
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der 1917 in München verstorbene Hermann von Bezzel war lutherischer Theologe, Rektor der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und Oberkonsistorialpräsident der bayerischen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. In diesem Werk finden sich seine Katechismuspredigten, die er unter dem Thema "Die drei Glaubensartikel" zusammengefasst hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Predigten zu den drei Glaubensartikeln
HERMANN VON BEZZEL
Predigten zu den drei Glaubensartikeln, H. von Bezzel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662202
Cover Design : Cropped, 27310 Oudenaarde Sint-Walburgakerk 87 by Paul M.R. Maeyaert - 2011 - PMRMaeyaert, Belgium - CC BY-SA.
https://www.europeana.eu/en/item/2058612/PMRMaeyaert_eaa59c4c3340ca0a0e5d1bfdf2aaafc1522cc823
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Der 1. Glaubensartikel1
1. 1
2. 8
3. 15
4. 24
5. 31
6. 39
7. 48
Der 2. Glaubensartikel55
1. 55
2. 62
3. 71
4. 78
5. 86
6. 94
7. 103
8. 110
9. 118
10. 126
11. 135
12. 145
13. 152
14. 160
Der 3. Glaubensartikel167
1. 167
2. 174
3. 182
4. 191
5. 200
6. 208
7. 218
8. 229
9. 238
Der 1. Glaubensartikel
1
Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! Luk. 17, 5.
Nach den Betrachtungen, die das ganze schwere Jahr hindurch mit Texten aus der Hl. Schrift die Not des Krieges und den Trost Gottes uns nahebringen wollten, erscheint es ratsam zu sein, in den Betrachtungen über den Katechismus, die wir vor länger als Jahresfrist begonnen hatten, fortzufahren. Dabei brauchen wir dem Verdacht nicht zu begegnen, als ob der Mangel an Teilnahme für das Geschick unseres Volkes uns von den Kriegsandachten in die Katechismuswahrheiten zurücktriebe. Wir glauben mitten im Kriege ein Friedenswerk zu treiben, wenn wir für die kommenden Tage uns wieder rüsten, in denen Gott das vom Kriegsungestüm unterbrochene Tagewerk uns wieder gönnt.
Wir gedenken auch fernerhin, wenn wir uns in die Tiefen der Katechismuswahrheiten mit ihrer vielerprobten Treue flüchten, unseres teuren Volkes, hier im Lande, draußen in der Ferne. Und Gott segne die schlichten Betrachtungen der Wahrheit, die wie ein gesegnetes Hausbrot die Seele sättigen und nähren will! Er lasse uns nicht mit hochmütigen Gedanken über die Katechismuswahrheiten unserer Kindheit hinweggleiten, als seien sie nur gut genug für Unmündige und Ungebildete, aber viel zu gering für die Gebildeten und Aufgeklärten! Er helfe uns dazu, daß, je mehr wir des Katechismus einfache Schüler werden, wir desto mehr an Erkenntnis und Weisheit gewinnen, und lehre uns die große, herrliche alte Nüchternheit des evangelischen Bekenntnisses, wie es Luther uns erschloß!
Die erste Rede des Katechismus in den zehn Geboten haben wir getan und vernommen. Laßt uns heute mit dem einfachen Worte beginnen, das ein Kind spielend ausspricht und dessen Wirklichkeit den Mann alt werden läßt, ohne daß er sie erschöpft, laßt uns reden von der Arbeit des Glaubens.
Die erste Tätigkeit in dem erwachenden Menschen, ehe er recht reden und das, was ihn bewegt, nach außen kundgeben kann, ist, daß er fühlt. Das kleinste Kind fühlt, daß die Mutterhände linder sind als jedes andern Menschen noch so weiche und gütige Hand. Das kleinste Kind merkt, daß das Lächeln der Mutter einen ganz andern Sinn hat wie das eines andern ihm noch so freundlich nahenden Menschen. Denn es ist das Lächeln des Wesens, dem es sein Leben dankt; es ist die Freude des Menschen, der nach heißer Angst und schweren Stunden ihrer aller vergißt um der Freude willen, daß ein Mensch zur Welt geboren ward. (Joh. 16 21.) Das Kind merkt den Unwillen der Mutter, wenn es sich gleich noch nicht Rechenschaft darüber geben kann, wie diese Änderung auf dem Antlitz der Mutter sich abschattet und aus dem Wesen der Mutter redet. Es merkt es; denn es fühlt. Wenn aber das Kind etwas heranwächst und das unmittelbare Fühlen sich zum vermittelnden Bewußtsein hebt, dann ahnt das Kind. Es ahnt im Antlitz der Mutter eine Welt von Seligkeit und Frieden. Es ahnt aus den Tränen der Mutter eine ihm bisher verschlossene Welt des Leides und des Unguten. Es ahnt, wenn die Mutter ihm naht, daß nun Sonne und Segen zu ihm kommen, und wenn die Mutter scheidet, daß eine Freude weniger ihm nahe ist. Es ist das, wenn ich so sagen darf, ein Fühlen, welches ans Denken hingrenzt. Das Kind ahnt ein Glück, ohne zu wissen, was Glück ist. Wenn aber das Kind die Unmittelbarkeit der frühesten Jugend abstreift und sich die Mittelbarkeit des sich Rechenschaft gebenden Menschen aneignet, dann heißt es: das Kind denkt. In diesem Alter des Kindes werden die meisten Erziehungsfehler von unvorsichtigen und schwachen Eltern begangen. Die Reden, die die Eltern unter sich tauschen, die Urteile, die sie miteinander wechseln, prägen sich dem Kinde ein, das Kind beginnt zu denken. Es setzt sich im Unterschied zu andern, es vergleicht sich mit andern. Wird es unmäßig gelobt, so wird es hochmütig; wenn es nie Lob empfängt, wird es kleinmütig. Wenn der Tadel nicht im Verhältnis steht zu der Tat, so wird es trotzig; wenn das Lob nicht dem entspricht, dem es gelten soll, so wird es stolz und übermütig. Wenn es merkt, daß die Wahrheit ihm schadet, wird es verschlossen; wenn es sich bewußt wird, daß Zärtlichkeit ihm nützt, wird es schmeichlerisch; gewinnt es den Eindruck, daß diese und jene Rede es interessant macht, so wird es eitel. Wie viele Eltern haben, indem sie ihr Kind über Gebühr lobten, aus dem Gottesgedanken eine Karikatur gemacht, die später wie ein trüber, schwerer Nebel auf dem Haus und dem Herzen der Eltern lastete. Das Kind, das frühzeitig angeleitet wurde, seine Gaben zu zeigen, mit seinen Künsten zu prunken, wird im spätem Leben tapfer Rollen spielen und wird nie mehr sein selbst sein. Der Mensch denkt und je mehr er denkt, desto stürmischer pochen an das bisher gewahrte und befestigte Herz die Zweifel. Sobald das Kind denkt, beginnt es zu zerstören. Ihr wißt es alle, die ihr Kinder kennt, wie eine der ersten Tätigkeiten des Selbstbewußtseins der Zerstörungstrieb ist; wie das Kind um hinter die Dinge zu kommen alles vernichtet und so selbständig werden will. Dann kommen die Zweifel. Bisher hat das Kind gebetet, weil die Mutter es lehrte, vielleicht ihm, wenn es eine rechte Mutter war, nie den Abendgruß bot, ehe es gebetet hatte. Bisher hat das Kind gelernt mit jemand reden, den es nie gesehen hatte, von dem es nur sehr viel hörte. Und nun beginnt es auch dieses Gut zu zerstören: Wo ist der, den ich nie gesehen habe? Wer ist der, den mein Auge nie erblickt? Wie ist der, von dem ich so viel hörte? Aus dem scheinbar geistreichen oder, wie man töricht sagt, unschuldigen Fragen schaut langsam der Zweifel heraus: Sollte Gott gesagt haben? (1. Mos. 3 1.) Wer ist der Gott, des Stimme ich hören soll? (2. Mos. 5 2.) Und wenn das Denken mit dem Zweifel sich verbindet, dann kommt es zu einem der unseligsten Worte, das doch so oft gebraucht wird: ich meine. Und während noch vor wenigen Jahren das Kind ahnte, meint jetzt die heranwachsende Jugend und legt sich das Bild zurecht, woran der Mann sich müde glaubte, um nie fertig zu werden. Wenn das alles überwunden ist, wenn aus dem Zustand des Ahnens und der Willigkeit des Denkens und der Unrast des Meinens eine Umkehr stattgefunden hat, dann taucht allmählich die Kraft auf, die zwar noch nicht die größte, aber der größten eine ist: ich glaube. Ich glaube, daß dies so ist, nicht: ich weiß es; denn das, was ich nicht sehe, kann ich nicht wissen. Aber ich will es glauben.
Ist das das Höchste? – Wenn wir sprechen: ich glaube, daß ein Gott ist, so treten wir freilich aus der Welt der Ungewißheit auf den festen Grund der Geschichte, aus der Welt des tastenden Ahnens und des Fühlens in eine Welt, die wir weder beweisen noch bestreiten können. Wir glauben, daß ein Gott sei, aber das Herz ist bei diesem Glauben ganz unbeteiligt. Es ist eine kühle, uninteressierte Verstandestätigkeit, welche unter vielen Möglichkeiten eine der Wahrscheinlichkeit nahe erwählt. Und nun, mein Christ, höre das Wort, das alles übersteigt, was bisher mit bescheidenen Strichen dir vorgezeichnet wurde, das Wort, das so kraftvoll in diese Welt der Unklarheiten hereinragt! Höre das Wort, in dem die höchste Kraft des Mannes mit der unmittelbaren Abhängigkeit des Kindes sich verbindet: Ich glaube an! Ich glaube zunächst an den Menschen, dann an mich, dann an etwas, das über mir und allen Menschen steht.
An Menschen glauben ist schwerer als an Gott glauben. Ich glaube an Menschen, nicht: ich glaube den Menschen, ich traue ihnen, weil ich sie treu erfunden habe. Das letztere ist kein Glauben, das ist Fühlen, das ist Wissen, ein innerliches Überzeugtsein auf Grund ganz bestimmter Proben und Erlebnisse. Aber an Menschen glauben, wenn so viel Täuschung erlebt ist, an Menschen glauben, wenn man so viel Schweres in und unter den Menschen erfahren muß, das ist eine Kraft des Willens, die nicht auf Erfahrung gründet, was sie glaubt, sondern es auf Erfahrung erst anlegt. Ich glaube an Menschen, das setzt eine solche Fülle von Willenskraft in Bewegung, daß man sich sagt: und wenn alle Berechnungen, die ich mit diesem Menschen anstelle, fehlschlagen und alle Erfahrungen, die ich mit ihm machen muß, mich täuschen, so will ich doch glauben, daß im tiefsten Grunde er es recht meint. Nicht: ich glaube ihm, sondern: ich glaube an ihn, obwohl ich ihm nicht glaube.
Ich glaube an mich. Die meisten unter uns werden sagen: das ist ein leichtes Ding, an sich zu glauben. Als ob nicht der Mensch sich selbst das größte Rätsel wäre und das Menschenherz ein trotziges und verzagtes Ding (Jer. 17 9), ein Abgrund, aus dem Gedanken heraufsteigen, die nur Einer wissen muß und keiner wissen darf. Als ob das Menschenherz nicht ein unruhvoll bewegtes Meer wäre, in dessen tiefstem Grund Geheimnisse wohnen, die dem nur kund sind, der das Meer in seinem Wesen beschloß. Je älter ein Mensch wird, desto mehr wundert er sich über sich selbst: das hätte ich nie von mir gedacht und nie von mir erwartet. Die meisten Menschen kommen deshalb so leicht durchs Leben, weil sie nie Zeit haben, sich mit ihrem Innern zu beschäftigen. Sie kennen sich nicht und lernen sich erst kennen, wenn es zu spät ist, nämlich in der Stunde, da alle Schleier zerreißen und die Rollen ausgespielt sind, die Seele allein mit sich ist und an sich denken muß. Die meisten Menschen tändeln durch das Leben, weil das Leben ihnen nur eine Summe von Abwechselungen und nicht eine Summe von Pflichten ist. Wer aber den Mut hat, sich mit sich selbst in rechter Weise zu beschäftigen, der ist gezwungen an sich zu glauben, soll er nicht an sich verzweifeln, so gewiß er geneigt ist, sich mit Geduld zu tragen. Du kannst einen jeden Menschen leichter tragen als dich, wenn du es ernst nimmst. Wenn du freilich in dich verliebt bist, kannst du dich leicht tragen; dann stören dich die Sandkörner im Wesen deines Nächsten ebensosehr, als dich deine Bergeslasten von Unarten unangefochten lassen; dann ärgerst du dich des Splitters in deines Bruders Auge deswegen, weil du des Balkens in deinem Auge nicht gewahr wirst. (Matth. 7 3.) Je mehr der Mensch sich mit sich selbst in rechter Weise beschäftigt, desto mehr Geduld muß er mit sich tragen: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? (Röm. 7 24.) Jeden Morgen die gleiche Last und jeden Abend das gleiche Schuldbewußtsein, und Jahr um Jahr nicht mit sich fertig werden und immer wieder unter sich leiden und unter sich dulden! Da müßte der Mensch an sich verzweifeln! Doch – er lernt an sich glauben. Denn hinter dieser schweren Last hat einer Stellung genommen, der der Menschheit ganzen Jammer auf sich gezogen und an sich getragen hat, und spricht: Werde nicht müde; denn ich bin mit dir; fürchte dich nicht; denn ich habe dich erlöst! (Jes. 43 1.)
Dann tritt die Kraft ein, welche in zwei schlichten Buchstaben, in einem armen Wort, die höchste Willensfülle und die höchste Lebenskraft und die Ewigkeitsgröße in sich schließt: ich glaube an. Ich glaube an Gott! Das spricht sich aus so leichthin und so schnell und ist doch das Werk einer täglichen Willenshingabe, eines alle Ohnmacht des Lebens eingestehenden Ernstes und einer über alle Ohnmacht reichenden Hoffnung auf die Allmacht. Das ist das Ergebnis eines auf allen Linien des Lebens gleichmäßig eingetretenen Waltens Gottes: was mir Gewinn war, ist mir Schaden geworden (Phil. 3 7), und woran mein Herz hing, das hat mich getäuscht. Ich suchte Weisheit und sie hat mich betrogen. Ich begehrte Frieden und er mied mich. Ich verlangte Ruhe und als ich hinkam, war sie eben weggegangen. Ich baute und der nächste Sturmhauch riß es ein. Ich riß ein und der nächste Tag baute wieder auf. Ich begrub meine Toten und der Hauch des Heiligen ließ sie lebendig werden. Ich suchte mir Erfahrungen zu sammeln, da kam das unerfahrene Widerfahrnis und alles, was ich gesammelt hatte, ward zerstreut. Ich hing mein Herz an die Erscheinung der Dinge und wurde gewahr, daß die Erscheinung trügt, und hinter die Dinge kam ich nicht. Und wenn ich mich ihnen näherte, warfen sie die Schleier über sich und ich blieb allein. So geht es durch das Leben des Menschen als eine vollkommene Zerstörung aller Werte. Ich sahe an alles, was unter der Sonne geschieht, und siehe da, es war lauter Eitelkeit. (Pred. Sal. 1 14.) Da tastet die Hand, die so oft nach einem Schatten gehascht hat, und müde am Körper herabsank, ein letztes Mal und findet eine ihr begegnende Hand, die zitternde eine starke, die tastende eine gewisse, die schwache und welke eine lebensfrische und lebenskräftige. Und die zitternde legt sich in die starke und durch die Seele geht es wie ein ungeahntes Glück: ich glaube an Gott!
Es ist alles zerfallen und der irre, müde, an Enttäuschung kranke Geist irrt durch die Trümmer. Und auf diesem Irrweg, der als einzige Lust die Träne hat, begegnet der schweifenden, eilenden und zweifelnden und der Verzweiflung sich nahenden Seele Einer, der über Trümmern sein Reich gebaut und über aller irdischen Vergänglichkeit seine ewige Gewalt erhöht hat, und spricht: Ich bin es! Alle andern Dinge und alle andern Wirklichkeiten, die ein Ich heißen, versinken in den Zustand des Nichtseins. Du aber bleibest, wie du bist. (Ps. 102 28.) – Und wenn diese Begegnung das ganze Herz erwärmt, daß das kalte, starre, entkräftete und arme Menschenleben noch einmal zu hoffen wagt, und das Wunder geschieht, daß am dürren Strauch der Frühling noch eine Knospe erweckt, so heißt das: ich glaube. Und wenn der Mensch an sich selbst verzweifelt, weil das Erträgnis seines Denkens ist: ich weiß, daß ich nichts weiß! und das Ergebnis seines Forschens: das ist alles eitel Mühe (Jes. 41 29) und Jammer! und die Summe seiner Arbeit: Erde zur Erde (1. Mos. 3 19), Asche zur Asche, Staub zum Staube! dann tritt ihm Einer entgegen und spricht: Ich lebe und du sollst auch leben! (Jos. 14 19.) Und indem sich in die fast leblose, verstorbene Daseinsgestalt Lebenskraft eindrängt, heißt es: der Mensch glaubt.
Ja, mein Christ, es müssen alle diese Stadien, in der oder jener Folge, wohl auch in wirrem Durcheinander erlebt sein, bis endlich der Mensch auf dem Einen ruht, was ihm nicht Ruhe, aber Frieden gibt: ich glaube an Gott. So reichst du mir deine Hand in Wort und Sakrament, und ich reiche dir meine Hand im Glauben, dann kann uns niemand scheiden.
So ist es: dann kann uns niemand scheiden! Denn der Glaube des ärmsten Kindes, das mit Tränen im Auge, wenn es ins Waisenhaus kommt und die Türen des Vaterhauses sich hinter ihm schließen, spricht: Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf! (Ps. 27 10) ist eine Heldentat, vor der all die kriegerischen Taten, so hoch wir sie auch werten, verblassen. Dies Kind hat den Mut gewonnen, der Wirklichkeit ins Angesicht zu schlagen und zu sprechen: Aber der Herr nimmt mich auf!
Und wenn ein armes Weib, vielfach betrogen von dem Manne seiner Jugend und seiner Liebe, noch für ihn betet und für ihn hofft, obgleich all sein Hoffen zuschanden ward, weil es den kennt, der die Herzen der Menschen kennt und wendet, so ist das ein Sieg, vor dem die Siege, die größten Siege jetzt, zerwehen. Ich sage nicht, daß jeder willensstarke Mensch glaubt, aber darauf bestehe ich, daß jeder gläubige Mensch willensstark ist.
Ich glaube! Es kommen Stunden, wo alles entfällt, und wo es uns eine Wohltat wäre, wenn uns jemand beweisen könnte, daß das, was wir glauben, nichts ist. Denn dann hätten wir keine Verantwortung mehr und keine Rechenschaft und mit dem Tod wäre es vorüber. Es kommen Stunden, in denen alle Glaubens- nicht -sätze, nicht -lehren – davon redet der Christ nicht – sondern alle Glaubensgrößen versinken. In diesen Stunden schenkt Gott – und das ist eine besondere Zartheit von ihm – manchmal auch das Gefühl seiner Nähe, ein Gefühl, auf das man nicht Häuser bauen, aber auf das hin man wieder ein wenig aufatmen kann. Er schenkt manchmal einen Vorschmack künftiger Herrlichkeit, mit dem ich niemand trösten wollte, aber wer ihn erfahren hat, der bewahre ihn als eine Freundlichkeit Gottes und genieße seiner! – Und es kommen andere Stunden, wo man etwas ahnt davon, daß nach dieser Zeit etwas Höheres kommt, so wie es wohl der Dichter beim Anblick der Wolkenberge meint: „Liegt wohl zwischen jenen mein ersehntes Ruhetal?“ Wenn jetzt die Blätter fallen und alles in uns gegen den Herbst protestiert, weil wir merken, daß wir nicht für den Herbst, sondern fürs Leben geschaffen sind, so zeigt das eine Ahnung, die Gott uns gönnt. – Und wenn du aus den Lebensbildern teurer Menschen die Größe des Glaubenslebens ein wenig kennst, so vergleichst du, wie reich jene waren, wie arm du bist, und warum ein Lazarus so froh und der reiche Mann so leidvoll war. Und du machst dir Gedanken. So hat Gott mancherlei Weisen, aber es sind doch alles nur Vorstufen. Das, was er, nicht seinen Lieblingen – denn Gott hat keine Lieblinge – sondern denen schenkt, die ihn lieb haben, obwohl sie ihn nicht schauen, das ist der Glaube.
Wie entsteht nun der Glaube? Kein Mensch kann ihn sich selbst geben und kein Mensch kann ihn dem andern leihen. Der Glaube ist ein freies Geschenk der Gnade, das zu geben sie sich gleichwohl verpflichtet hat. Du kannst dir den Glauben nicht geben, und wenn du mit vieler Mühe in die Erde hinabführest, und mit viel Anstrengung in den Himmel stiegest. (Röm. 10 6. 7.) Und wenn du alles wüßtest, und alles erkenntest und alles enträtseln würdest, das wäre dennoch kein Glaube. Und wenn du Glauben hast und möchtest einen Menschen, den du liebst mehr wie dich selbst, gläubig wissen und gläubig machen, ihm deinen Glauben nur auf einen Tag leihen, du kannst es nicht.
Der Glaube ist die große Freundlichkeit der Gottessonne, mit der sie alles, was zur Sonne will, hervorlockt. Blick empor, damit ich hinabsehe; blick hinan, damit ich dich erblicke! Es geschieht der erste Schritt des Glaubens nie von unten nach oben, sondern immer von oben nach unten: Es bricht mir das Herz über dir, daß ich mich deiner erbarmen muß. (Jes. 31 20.) So weckt Gott im Menschen die wunderbare Gewalt des Verlangens: Herr, daß ich glauben könnte! Und das Gebet: Stärke meinen Glauben! (Lk. 17 5) und das andere: Hilf meinem Unglauben! (Mr. 9 24.) Und auf einmal steht der Mensch in einer ganz andern Welt als der, der er angehört. Er steht in der Welt des Unsichtbaren und bewegt sich in ihr weit sicherer, als er sich je in der Welt der Sichtbarkeit bewegen konnte und wollte. Er findet da, wo andere Grundlosigkeit fürchten, einen Grund, der seinen Anker ewig hält; denn er glaubt.
Ist jemand unter euch, der bloß darum geglaubt hat, weil es mit zur anständigen Erziehung gehört, weil es von Vater und Mutter uns ererbt ist, weil das Kirchengehen noch nicht direkt unfein ist? Ist jemand unter euch, der sich überhaupt noch gar nicht besonnen hat, was man und wie man glaubt, der werfe den ganzen Wust – aber versteht mich recht! – von Kirchenlehren und Kirchensatzungen und Offenbarung weg und habe den Mut, einmal in den Abgrund hinabzublicken, in den er versinkt, wenn ihm Gott nicht hilft! Der werfe weg, was er erlernt hat, und beginne von vorne, vor allem zu beten: Hilf mir, daß ich glaube!
Niemand gibt mir den Glauben als der, der den Weg zu mir gefunden hat, damit ich ihn zu ihm finde, als der, der sich aufmachte, ehe der Sohn zum Vater ging, damit der Sohn des Vaters nicht verfehle.
So ist der Glaube ein freies Geschenk Gottes, das er jedem gibt, der ihn bittet, und das er keinem aufdrängt, der es nicht will. Wer aber weiß, daß der Glaube die freieste Tat des Lebens ist, zu der mich niemand zwingt, mit der Gott mich beglückt, der läßt nicht mehr vom Glauben, spricht nicht mehr: ich glaube, sondern ich weiß. Denn das ist die Probe darauf, ob du wirklich glaubst, daß du sagen kannst: Und wenn die ganze Welt spricht: nein! Dein Wort soll mir gewisser sein und läßt mir gar nicht grauen! – Das ist des Glaubens Kraft, daß er dem Hohn der Hölle: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? (Hiob 29), dem Spott der Welt: Wo ist nun dein Gott? (Ps. 42 11.), dem Zweifel des Herzens: der Herr hat mich vergessen! (Jes. 49 14) kühn und getrost entgegensetzt: Dennoch bleib ich stets an dir! (Ps. 73 23). Amen.
2
Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweifeln an dem, das man nicht siehet. Hebr. 11, 1.
In der letzten Katechismusstunde versuchten wir uns über die Worte: fühlen, ahnen, denken, meinen klar zu werden, um schließlich den Begriff, den die Hl. Schrift in das Wort Glaube gelegt hat, ein wenig uns zu Gewissen zu führen. Wir sagten zuletzt, daß der Glaube von dem Herrn, unserm Gotte, einem jeden gegeben wird, der ihn verlangt, und daß, wo eine Seele in der Zeit mit der Ewigkeit anknüpfen will, Gott immer wieder entgegenkommt. Denn der Glaube ist nicht, wie immer gesagt wird, in erster Linie die Hand, die ich Gott darbiete, sondern der erste Schritt geht von Gott aus, indem er mir seine Hand darreicht und zu mir spricht: Laß deinen Augen meine Wege Wohlgefallen! (Spr. 23 26.) – Kein Wort hat der Kirche und der einzelnen Seele so viel Arbeit gemacht wie das Wort Glaube; keine Tat hat der Kirche und der einzelnen Seele in ihr aber auch solchen Segen gegeben wie das Glaubenswerk. Wer die Bücher alle begreifen könnte, die über das Wort Glaube geschrieben worden sind, und wer die innere Tat recht auskünden könnte, die darin besteht, daß ein Mensch sich ganz auf Gott verläßt! –
Auf dem Marktplatz der alten Saalestadt Halle steht das Standbild August Hermann Frankes, des frommen Glaubenshelden. Mit einigen geschenkten Gulden hat er als mit einem guten Kapital, mit dem man etwas Bedeutendes anfangen müsse, Anstalten ins Leben gerufen, deren Segen jetzt nach zweihundert Jahren noch ungeschmälert und unverkürzt durch die Welt und Kirche reicht. Auf diesem Denkmal steht: Er hat Gott getraut! Nichts mehr und nichts weniger. In diesen Worten aber liegt die größte Lebensweisheit, die von sich nichts und alles von Gott erwartet, die von sich nichts zu rühmen hat, um alles Gott zu verdanken.
Was ist denn eigentlich der Glaube? Ehe wir den Glauben, den man glaubt, recht auf uns wirken lassen, müssen wir eins werden über den Glauben, mit dem man glaubt.
Das wißt ihr alle, daß ein lebendiger Gott ist, daß er die Welt erschaffen und bis auf diesen Tag erhalten hat, daß er in der Fülle der Zeit seinen eingebornen Sohn in die Welt gesandt hat (Gal. 4 4), und daß sein Sohn lebte, litt und starb und auferstand und als der Erhöhte die heilige Kirche gegründet hat, welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen (Matth. 16 18). Das glaubt alles der Teufel in der Hölle auch und glaubt noch mehr. Der Glaube, der alle diese Wirklichkeiten für Wahrheit hält, ist noch lange nicht der Glaube, der mit einer einzigen Wirklichkeit die Seele rettet. Der Glaube, der die ganze Summe dessen, was in den drei Artikeln und über sie hinaus uns zu glauben dargeboten wird, erfassen und halten läßt, kann ein toter, unlebendiger und kraftloser Glaube sein. Du tust gut daran, daß du glaubst, es sei ein einiger Gott. Das glauben die Teufel auch und zittern dabei. (Jak. 2 19.) Es genügt nicht, daß wir diese Glaubenstatsachen hinnehmen, annehmen, aufnehmen. Wenn wir sie nicht herein in unser Leben nehmen, ist es nichts. Und wenn ein anderer sagen würde: „Ich glaube und habe mir fest vorgenommen, mir gar keine Gedanken darüber zu machen; ich glaube, weil es mich meine Kirche so lehrte; ich nehme es einfach an.“ Das ist auch kein Glaube. Das ist vielleicht etwas von dem Glauben der Unverständigen und Unmündigen, der diese ganze große Summe herein in sein Leben stellt, ohne eigentlich mit ihr zu wuchern und von ihr zu leben, aber der Glaube, der in deiner Todesstunde dich rettet, ist es nicht.
Zum rechten Glauben gehört erstlich eine genaue Kenntnis von der Art und Kraft der großen Stütze, die uns Gott der Herr durch Seine Person und durch Jesum Christum, seinen Sohn gegönnt hat. Das ist noch nicht das Höchste, aber doch etwas. Du mußt zuerst über deinen Herrn und über sein Wesen, über sein Werk und seine Tat Kenntnis haben. Der Glaube kommt aus dem Hören, kommt aus der Predigt. (Röm. 10 17.) Wenn du nie etwas von den großen Taten Gottes hörst, so verdämmert der Glaube und erlischt wie eine Lampe, der das Öl gebricht. Wenn du dem, was dir aus der Kindheit noch als Erinnerung geblieben ist, nichts Neues mehr nachgießest, so wird das Öl aufgezehrt und deine Lampe erlischt mitten in der Finsternis. Daß man sich mit göttlichen Dingen beschäftigt, gehört zum Glauben, ist nicht das Höchste, wohl aber das Erste. Der erste Schritt deines Glaubenslebens muß sein: Komm, daß du hörst! (Pred. 4 17.) Von hier aus gewinnt der Sonntagskirchgang und der alltägliche Bibelernst, mit dem man die Hl. Schrift aufschlägt und liest, eine ganz andere Beleuchtung. Ich muß etwas von den großen Tatsachen Gottes wissen und kann nie genug von ihnen hören. „Wie sollen sie glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“ (Röm. 10 14.) Unser ganzes Amt wäre höchst überflüssig, im günstigsten Fall noch eine Art geistlicher Dekoration in die Prosa eures Lebens gebend, vielleicht einen Weihespruch am Anfang oder ein Abschiedswort am Ausgang spendend oder eine sinnvolle, dichterische Rede am Traualtar bietend, weiter aber nichts. Wenn wir aber nichts weiter sind, sind wir ganz unnötig; das können andere besser als wir. Nein, dazu hat der treue Herr unser Amt eingesetzt, daß die Gemeinde erbaut werde, daß sie höre, was er zu ihrem Heile getan hat. Dazu sind wir da, daß wir, was wir erarbeitet und erbetet, erlebt, erlitten und erfahren haben, der Gemeinde darbieten, ob sie es annehmen und im Herzen bewegen wolle. Wir müssen hören! Wem es nicht mehr erlaubt ist, ins Gotteshaus zu gehen, der nehme seine Bibel, bitte den Hl. Geist um Erleuchtung und lese, und wenn er es nur aus Gewohnheit tun würde und aus Pflicht! Ihr habt doch sonst soviel Zeit für alle mögliche Lektüre! Ihr habt soviel Zeit für das Lesen der Tagesblätter und für die Blätter der Ewigkeit so wenig! Dann würdet ihr Bibelleute, ich sage noch nicht Bibelchristen, werden, bibelfeste Menschen, die sich in Gottes Wort zurechtfinden und auskennen. Wenn so die heiligen Taten Gottes, die Geschichte Gottes mit der Menschheit und die Geschichte der Menschheit für Gott von uns gelesen, vernommen, erwogen wird, so werden wir wenigstens reich, nicht an Erkenntnis, aber an Kenntnis. Es gibt keine Erkenntnis ohne Kenntnis. Es kann niemand zahlen, der nicht Geld hat, und kann niemand speisen, der nicht zu essen hat. Nehmt an, hört, hört oft und gern und werdet im Worte Gottes heimisch!
Das ist das erste, das, was unsere Väter die Kenntnis der Dinge genannt haben. Es ist mit dem geistlichen wie mit dem gewöhnlichen Leben: Wer nicht lernt, der hat nicht, wer nicht übt, der kann nicht, und wer nicht sammelt, dem gebricht es bald.
Zu dieser Kenntnis, die zunächst den Verstand und den Geist beschäftigt, und die, wie schon gesagt, auch die Dämonen besitzen können, tritt ein herzliches Verlangen, daß es so sein möchte. „Der tat der Herr“, heißt es von der Purpurkrämerin Lydia, „das Herz auf.“ (Apg. 16 14.) Wenn du bei deinem Bibellesen, beim Anhören einer Betrachtung nur einen Augenblick den Wunsch in deiner Seele einkehren lässest: „Ach, daß es so wäre!“ so ist’s bereits Frühling in deiner Seele geworden. Aber dieses Verlangen kann erst eintreten, wenn du die Dinge kennst, von denen du wünschest, sie möchten so sein. Und je weniger sich ein Mensch mit der Bibel befaßt, desto bescheidener wird der Umkreis seiner Wünsche, die mit einem ruhigen Sterben enden. Wer freilich so maßvoll in seinem Begehren ist, daß er sagt: Habe ich zu essen und zu trinken und zu spielen, dann bin ich zufrieden! der braucht keine Hl. Schrift und keinen Glauben. Wenn aber deine Wünsche über das Grab hinüberreichen und dein Verlangen gegen das Vergehen deines Lebens protestiert und du täglich deiner Seele sagst: Es kann nicht sein, daß diese Erde meine Heimat und mein Vaterland ist! Und wenn immer wieder, so oft die Sterbeglocken läuten und dein ganzes Wesen von der Vergänglichkeit hingenommen wird, du sagst: Ich will nicht sterben, denn ich soll nicht sterben! dann erwacht in deiner Seele ein dir zunächst unerklärliches Verlangen, eine Sehnsucht, über deren Ursprung und Ziel du dir nicht Rechenschaft geben kannst. Und dieses Verlangen hat dir der ins Herz gegeben, der den Menschen die Ewigkeit ins Herz gesenkt hat.
Die Ewigkeit im Herzen – und wir werden nicht zur Ruhe kommen, bis die Ewigkeit ganz unser wird. Wenn mein Verlangen über mich hinauseilt und meiner Seelen Sehnen nicht auf der Erde bleibt, dann kommt heimlich in die Seele der Wunsch nach Wirklichkeit: Ach, wenn das wahr wäre, was er sagt: Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe! (Joh. 11 25.) Wenn es wahr wäre: Ich gebe ihnen das ewige Leben! (Joh. 10 28.) Ach, es ist ja nicht so! Aber wenn es so wäre! Das ist das, was unsere Alten so treuherzig den Beifall genannt haben, Beifall, der im Gefühl anhebt und im Willen endet, nicht in der Gefühligkeit, aber in der ganz geheimen Kraft, die mir zuruft: dein Gott betrügt dich nicht und sein Wort kann dich nicht täuschen. Wenn irgendwo in deiner Seele der Wunsch wach wird: Ach, daß ich sehen möge! (Lk. 18 41.) Daß nicht von Ahnungen, frommen Meinungen und schönen Gedanken die Rede wäre, sondern von Tatsachen, wie selig wäre ich dann! Wenn dies Gefühl sich regt, daß deine Seele trotz allem „Nein“ des Lebens sagt: es ist doch so! dann ist der zweite Schritt auf dem Glaubensweg getan. Was jener Heide zum Missionar sagte: Wenn deine Botschaft von dem Gottessohn, der Mensch geworden ist, wahr ist, kannst du nicht so ruhig dabei bleiben, und wenn du ruhig bei ihr bleibst, ist sie nicht wahr! Das ist das, was die Kirche Beifall nennt. Daß wir so kaltsinnig bei der schweren Arbeit, die Gott geleistet hat, bleiben, ist ein Hindernis des Glaubens. Der alte Kirchenvater sagt einmal. Gott kann retten die Räuber, die Schächer, die Mörder und die Verräter; Gott kann selig machen die Spötter, die Trotzigen und die Feinde; aber nie kann Gott einen Lauen erretten. Und ihr wißt, daß der wahrhaftige Herr sagt: Ach, daß du kalt wärst, mein Feind, der gegen mich trotzt, der mich verhöhnt, verachtet, verlacht! Weil du es aber nicht bist, sondern lau, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. (Offg. 3 15. 16.) Wenn wir Gottes Wort hören und es wacht nicht in uns der heimliche Gedanke auf: ach, daß das mir gelten dürfte! dann ist unser Glaube sehr krank. Dann ist es höchste Zeit, daß wir Gott ernstlich bitten, er wolle durch seinen Geist unsern Geist erneuern. Diese Freude – noch nicht am Besitz, sondern an dem Wunsch des Besitzes, die Freude an der Möglichkeit, so reich zu sein, und von dieser Freude ausgehend das Verlangen nach der Wirklichkeit des Reichtums, das ist das Zweite. Meine Seele gibt Gott recht, wenn er sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. (Joh. 15 5.) Meine Seele spricht dir, Herr, Beifall zu, wenn sie hört: Ich bin der Herr, dein Arzt! (2. Mos. 15 26.) Mein Innenleben sagt zu ihm aus Glauben, der über Vernunft, aber nicht wider Vernunft geht: Ja, daß du es wärest!
Und der dritte Schritt ist, wenn der erste die Tat des Schülers und der zweite die Tat des Jüngers gewesen ist, die Tat des Helden, des Helden, der, äußerlich schwach und arm, unscheinbar und gering, innerlich alles überwindet. Denn es ist die Tat des Willens, das was Luther das „verwegene Vertrauen“ heißt, das sich aller Dinge entschlägt und uns sprechen läßt: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben! (Mr. 9 24.) Wie ein Schüler, wie ein Kind lernt deine Seele, was sie glauben soll, lernt die biblische Geschichte, welche von den meisten verachtet wird und doch so kräftig die Seele nährt. Als ein Jünger und mit der Freude es zu sein, fühlt deine Seele und wünscht den Frühling, den Gott ihr verheißt. Und männlich stark, herrenhaft und kühn, fest und entschieden ruft deine Seele: Das alles soll mir gewiß sein! Nicht, weil ich es wünsche, sondern weil du es mir gibst. Das ist des Glaubens letzter Schritt und erster Sieg: ich glaube.
Ihr seht, all die Kräfte, die Gott in den Menschen gelegt hat: die heilige Einbildungskraft, die nicht Träumen folgt, sondern Wahrheiten sich erschließt, und die Geistesgaben alle, welche da lernen und bewahren, schließen und vergleichen, überlegen und erwägen und ausdenken, und all die zarten Schwingungen unseres Innenlebens, daß wir auf jede lautere Empfindung eine Freundlichkeit, auf jede unrechte Empfindung den Tadel Gottes spüren, und endlich die Willenskraft, die durch alle Hindernisse hindurchbricht: ich lasse dich nicht (1. Mos. 32 27) und folge dir! – Alle diese Kräfte werden von dem einen Wörtlein in Anspruch genommen: Ich glaube. Der Glaube hört nicht auf, bis er nicht bloß in Schauen verwandelt wird, sondern vielmehr vom Schauen aufgenommen wird; denn auch Schauen ist noch ein Stück vom Glauben.
So fassen wir zusammen: Ich will lernen, was er gesagt und getan hat; und das ist deine eigene Sache, dazu brauchst du keinen Heiligen Geist, dazu genügt der natürliche Verstand. Und dann will ich bitten: versiegle dein Wort in meinem Herzen und laß in meiner Seele den Wunsch laut werden, daß es sich also verhält! Dann gib mir, so schwer es ist, den Schrecken über mich selbst und die Angst des Abgrundes und den Blick in die Tiefe ohne dich und dann die Freude, daß ich in dir leben darf. Und dann will ich trauen, so wie wir es vorhin gehört haben. Der Glaube ist eine innerliche Beweisführung (Hebr. 12 1) von Dingen, die man nicht sieht. Durch den Glauben sprach Abraham mit dem unsichtbaren Gott, als sähe er ihn. Durch den Glauben hat Abraham seinen einzigen, heiß ersehnten und spät geschenkten Sohn geopfert (Hebr. 11 17), und durch den Glauben hat er ihn aus dem Tod wieder genommen. (Hebr. 11.) Durch den Glauben hat Moses ein besseres Vaterland gesucht, obwohl er es nicht kannte. (Hebr. 11 28.) Durch den Glauben hat man den Mut, in Dinge, die man nie erfahren und nie erschaut hat, hineinzugehen wie in ein bekanntes und vertrautes Land. Dinge, die du siehst, brauchst du nicht zu beweisen. Aber das ist Glaube, daß man ungeschaute Dinge erlebt und sich nicht einredet, das wäre Willenszwang, sondern sich innerlich überzeugt, es sei so. Glauben lebt immer von Unsichtbarem und in Unsichtbarem, aber er lebt. Wir reden jetzt von Gott – niemand hat Gott je gesehen. (Joh. 1 18.) Wir beten zu Gott – niemand hat Gott mit Händen gegriffen. Unser ganzes Christentum geht in ungeschaute, unergriffene, unbekannte Fernen, aber dem Glauben sind diese Fernen Nähe und diese Begriffe Tatsachen. Der Glaube ist eben ein innerlicher Beweis von Dingen, die man nicht sieht, aber ein so fester Beweis, daß er jeden Widerspruch stillt. So ist man innerlich im Glauben von den Dingen, die man glaubt, so überzeugt, daß alle Gegnerschaft schon an unsern Schuhen niederfällt, sie erreicht gar nicht unsern Fuß. So fest gibt Gott denen, die ihn darum bitten, den Glauben, daß die vielen Schrecken, die auch durch ihre Seele ziehen, ausklingen: Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! (Hiob 19 25.) Ich weiß es.
Wenn wir einen geliebten Menschen nach seinem irdischen Teil in die Erde senken, ist es eine Glaubensstärke ohnegleichen zu sagen: er ist nicht verloren, er lebt fort, nicht bloß in unserer Gedankenwelt – das ist nicht viel, denn da stirbt er eben mit uns – sondern er lebt, trotzdem der ganze Augenschein mir sagt: er ist tot. Der Augenschein täuscht, das Nichtgeschehen ist wahr. Der Augenschein trügt, mein Christus und in ihm alles, was kein Ohr erlauscht und kein irdischer Blick ersah (1. Kor. 2 9), das ist untrüglich klar und wahr. – Daß ich mit einem Unsichtbaren rede, ist ja Narrheit, weshalb ein Philosoph des neunzehnten Jahrhunderts sagte, Beten sei eine Kinderei, und der Mensch, der beim Beten überrascht wird, werde rot, weil er Kindisches tue; Beten sei Reden in leere Fernen. – O nein, Beten ist ein Reden mit dem, der uns so nahe ist, näher als die Luft, die uns umgibt. Beten ist nicht ein frommer Selbstbetrug, dem das Kind sich hingeben kann, dessen aber der Mann sich schämen müßte, sondern Beten ist die größte Willenstat, mit der ich ins Unsichtbare hinein meine Seele und meine Kraft stelle und spreche: Sei du mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not. (Jer. 17 17.)
Aber Glaube ist nicht nur ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht, sondern auch eine Überzeugung von Dingen, die man hofft; oder, wie es wörtlich heißt, ein heimlicher Besitz von Dingen, die man hofft. (Hebr. 12 1.) Was du hoffst, hast du noch nicht, es gehört der Zukunft an. Aber der Glaube hofft so stark, daß das Gehoffte schon Besitz ist. Er hat es, es steht vor der Türe, heimlich tritt es ein. Du hoffst, daß in deiner Todesstunde er sich deiner annehme und zu deiner Seele spricht: Fürchte dich nicht! Und diese Hoffnung hält dich so fest, daß der Gedanke an den Tod zwar nicht seinen Schauer verliert, aber immer wieder in eine Klarheit und von der einen Klarheit in die andere gerückt wird. Neben dem Weh sieht der, der es überwindet.
So, Geliebte, wollen wir heute auseinandergehen mit drei Bitten. Die erste sei: Rede, Herr, dein Knecht höret! (1. Sam. 3 10.) Laß mich hören Freud und Wonne (Ps. 51 10), so viel ich auch dein Wort verachtet habe! Gib mir noch Gelegenheit zu lernen, weil ich auf Erden bin! Und die zweite Bitte: Erwecke in meiner Seele den Wunsch, der über die Erde hinausreicht! Und die dritte Bitte: Gib mir den Mut, alles, was du für mich getan hast und an mir tust, herein in den Gehorsam zu nehmen!
Ich trau es dir;
Ach stärk den Glauben mir;
Ich laß mich für und für
Nur deinen Händen.
Beim Sturm der Welt
Sei Anker, der mich hält,
Und birg mich in dein Zelt,
Wenn alles zaget;
In Not und Pein
Nimm mich, o Liebe, ein,
So harr ich kindlich dein,
Bis daß es taget. Amen.
3
Ich glaube an Gott den Vater, Allmächtigen.
So bekennen wir im ersten Glaubensartikel, und wer es recht versteht, weiß, daß in diesem einen Worte die ganze Fülle alles dessen enthalten ist, was die drei Glaubensartikel in herrlicher Weitschaft verkünden. Denn es ist nicht an dem, wie man manchmal liest und wie auch geistreiche Theologen behauptet haben, daß wir im ersten Glaubensartikel uns mit den Juden und Mohammedanern, im zweiten mit allen Christen und erst im dritten mit allen Evangelischen zusammenschließen. Diese Scheidung ist mehr geistreich als wahr. Wer die Worte recht versteht: ich glaube an den allmächtigen Vater – denn so soll es eigentlich heißen – weiß, daß Gott, sobald er Vater geheißen wird, der Vater unsers Herrn Jesu Christi ist, weiß auch, daß, sobald der Vater und der Herr Jesus genannt werden, sie mit dem Hl. Geist sich zusammenschließen, und weiß endlich, daß das Werk der Schöpfung zugleich das Werk der Erlösung und Weltvollendung ist. Denn Gott beginnt kein Werk ohne es zu heiligen und heiligt keines ohne es zu vollenden. Wer den Vater nicht hat, der hat auch den Sohn nicht (Joh. 5 23), und wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht, und wer den Vater und den Sohn nicht hat, der ist vom Hl. Geist verlassen. Denn niemand kann Jesum einen Herrn nennen ohne durch den Hl. Geist, (1. Kor. 12 3.)
Indem ich dies vorausschicke, möchte ich der Gemeinde zum Verständnis sagen, daß die alte Kirche bis zum 5. Jahrhundert gebetet hat: ich glaube an einen Gott, an den einzigen und wahren Gott, der vor allen Göttern der Heiden den wesentlichen Vorzug hat, daß jene erdichtet sind und er ist wahr, wirklich. Darum ist er der Einzige, der den Namen Gott verdient.
Vielleicht fragst du, woher eigentlich der Name Gott stammt? Es ist wunderbar, daß man bis auf diese Stunde noch nicht weiß, woher unser Volk den Namen, der über alle Namen ist (Phil. 2 9), geholt hat. Obwohl man weiß, woher das Wort Mensch kommt: der Denkende, der Sinnende, der Meinende. Im Großen Katechismus Luthers steht: Gott heißt er, weil er alles Guten Inbegriff und Urquell ist. Und so hat es auch unser Johann Heermann gemeint, wenn er singt: O Gott, du frommer Gott! Und doch ist diese Erklärung, so sinnig sie ist und so gern ich sie den Kindern gegeben habe: Gott, das höchste Gut, der Inbegriff alles Guten, Schönen, Reichen, Reinen, nicht richtig. Andere haben gesagt, Gott kommt her von dem Worte, das im Altgotischen soviel heißt als: sich verbergen, der, dem es gefällt, im Dunkel zu wohnen, der in den Geheimnissen sein Zelt aufgeschlagen hat. Und auch diese Erklärung, so nahe sie vielleicht sprachlich das richtige trifft, ist nicht tröstlich. Gewiß du bist ein verborgener Gott, aber du bist auch unser Heiland. (Jes. 45 15.) Und je verborgener er ist, desto mehr ringt die Seele darnach, daß er sich offenbare: Rede, damit ich dich sehe und laß dich vernehmen, damit ich dein gewahre! Nach der lateinischen Bezeichnung ist Gott der, der da setzet und es bleibt, der da stellt und es steht, der da ordnet und niemand kann es umstoßen, der da eilt und niemand kann ihn aufhalten. Und noch eine andere Erklärung seines Namens, die mir noch lieber ist, besagt, daß er Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. (1. Joh. 1 5.) Vielleicht kommt das Wort Gott aber von dem alten Zeitwort got, der Angerufene, der allein das Gebet der Menschen erfährt und erhört. Schon das müßte uns in die Demut treiben, daß wir den Allergeliebtesten, den wir notwendiger haben als die Luft, die uns umgibt, nicht recht nennen können, daß wir immer wieder genötigt sind, an seine Offenbarung uns zu halten.
Darum sage ich zum ersten: Gott ist Person.
Vielleicht denkt jemand bei sich, das sei ein leeres Wort. O mein Christ, gerade die moderne Auffassung, welche die Person Jesu Christi zwar nicht leugnet aber verflacht und der Göttlichkeit beraubt, steht in Gefahr, nicht mehr persönlich denken zu können. „Gott ist alles, was mich umgibt. Gott ist die Luft, die ich atme,“ sagt der Moderne... „Gott ist die Rose, die mir entgegenblüht; Gott ist die Welle, die an mir vorbeizieht; Gott ist der Sonnenstrahl, der mein Antlitz labt; Gott ist die finstere Nacht, die mir den Schlaf gönnt; Gott ist der Frühling, der neues Leben bringt; Gott ist des Herbstes Ernst, der mir die Ernte schenkt.“ Das allgemeine Wort von einem Gott, der alles ist, nur nichts faßbar, hat etwas sehr Poetisches. Aber so gewiß die Sünde nicht poetisch, sondern der Schrecken des Lebens ist, so gewiß brauche ich nicht Poesie über Gott – die kann empfindsamen Gemütern überlassen werden. Ich brauche einen, mit dem ich rede: Du! und der mir antwortet: Ich! Was hilft es dir, wenn ich sage: Siehe in diesem Raume ist die Barmherzigkeit anwesend, und du kannst sie nicht fassen? Was tröstet es den Armen, wenn ich ihm die Bildnisse barmherziger Männer und Frauen zeige und spreche: Es umgibt dich die Geschichte der Barmherzigkeit! und niemand tritt aus dem Rahmen heraus, um ihm die Tränen zu trocknen und die edlen Bilder geben ihm kein Brot? Die Leute wissen nicht, welchen Raub sie an der Seele nicht bloß des Menschen, sondern der Menschlichkeit begehen, wenn sie Gott in Begriffe, Gefühle, Gedanken auflösen. Von jener Dienerin eines großen Malers wird erzählt, daß sie, um sein bestes Werk von Staub zu reinigen, Scheidewasser nahm. Der Staub ging allerdings von dem Gemälde weg, aber die Farbe auch und das Bild löste sich in ein buntes Gemenge auf. So machen es die, welche, um den Begriff Gott recht rein zu erhalten, mit dem ätzenden Wasser ihres Verstandes das göttliche Bild auflösen. Was bleibt dir dann? – Mein Christ, du weißt, daß er gesagt hat: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten! (Ps. 50 15.) Und weiter: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir! (1. Mos. 26 24.) Und darum sage ich euch und mir die frohe Botschaft: der Gott, der alles erfüllt, ist eine Persönlichkeit; eine Persönlichkeit, mit der ich reden darf wie ein Kind mit seinem Vater, die ich aufhalten darf: Halt stille, ich will den Saum deines Kleides berühren! Ich brauche einen, der ein Ohr hat für meine Schmerzen und ein Verständnis für ihre Not. Was hilft es mich, wenn ich weiß, die ganze Luft ist von Gott erfüllt, wie die Sonne die Luft erzittern läßt von ihren Strahlen am Sommerhochtag, und die Strahlen enteilen und verstehen mich nicht, und die Sonne sinkt und erhört mich nicht, und das Licht weicht und tröstet mich nicht! Ich brauche einen, zu dem ich sagen kann: du bist unser Vater und unser Erlöser, von altersher ist das dein Name. Abraham weiß von uns nicht und Israel kennt uns nicht, aber du bist unser Vater! (Jes. 63 16.)
Gott ist Person, das ist die größte Kraft. Denn die Person ist Herr über Raum und Zeit. In dem Moment, in dem du nur für die Minute da wärest, in der du dich eben befindest, wärest du keine Person mehr, sondern eine Null. Aber du hast ja das Recht, über die Vergangenheit zu gebieten. In einer Minute kannst du dich in die Vergangenheit zurückversetzen, alle vergangenen Dinge wieder deiner Erinnerung vergegenwärtigen. Die Vergangenheit zwingt dich: du wirst älter, vielleicht auch klüger. Aber du zwingst sie viel, viel mehr. Sie muß dir dienen: deine Eltern, Geschwister, längst Verblichene treten in dein enges Zimmer; du bist voll von Erinnerungen. Die Persönlichkeit aber, welche die Vergangenheit in die Gegenwart zwingt, läßt uns auch über die Zukunft gebieten. Wer kann es dir wehren, dir auszumalen, wie es einmal sein wird, wenn du das gelernt und jenes erreicht, das gemieden und jenes gerettet hast? Du malst dir die Zukunft aus; sie muß dir dienen. Und weil du über die Zeit Herr bist, bist du Person.
Doch du gebietest auch über den Raum. Das wäre keine Person, die nur das Plätzlein ausfüllt, auf dem eben der müde Leib ausruht. Das ist eine Null, ein Lebewesen, aber keine Person. Das Tier füllt auch den Platz aus, der ihm gegeben, es lebt, ist aber keine Person. Der Mensch kann in jeder Minute über den Raum gebieten. Wer wehrt mir, daß ich, während ich an meinem Schreibtisch sitze, im Geist in Amerika weile? Ja, wie will ich denn beten, wenn ich nicht weit über Raum und räumliche Dinge hinüber zu Gott mich erhebe?
Manche Menschen freilich sind nur des Raumes mächtig, den sie inne haben. Das sind die armen Leute, die an die Scholle gebunden sind, und die, weil sie nicht in die Höhe kommen, auch nicht in die Tiefe gründen. Da sie aber doch eine Ausdehnung nehmen müssen, so verflachen sie. Und der oberflächliche Mensch ist eben der, der von dem Raum abhängig ist, auf dem er weilt, von dem Genuß seiner Wohnung, von der Speise, die er zu sich nimmt, von dem Schauspiel, das an ihm vorüberzieht, von den Torheiten, über denen er den Himmel verliert und die Hölle verdient.
Aber bist du Herr über Raum und Zeit, so rächen sich beide an dir; sie rächen sich für deine Herrschaft. Wenn du schwerkrank darniederliegst und kannst kein Glied mehr rühren und andere müssen dich tragen, heben, betten wie ein hilfloses Kind: das ist die Rache, die der Raum an den Menschen nimmt. Und wenn du von dem Schmerz des Augenblicks ganz hingenommen bist, und wenn die Zeit der Rüstigkeit zu Ende geht und du spürst es, daß es nimmer so ist, wie in früherer Zeit, und die Kirchhofblumen immer eindringlicher für dich blühen und zu dir reden vom Ende, merkst du, das ist die Rache der Zeit.
Gott ist Person, weil er über Raum und Zeit ebenso gebietet wie ich. Aber er ist die Person, weil Zeit und Raum nicht über ihn gebieten. Das ist mein Trost, daß ich sagen kann: du kennst die Zeit, in der ich lebe, mit ihrer Angst und ihren ungelösten Fragen, mit ihren Rätseln, die niemand deutet, mit ihren Zeichen, die niemand versteht. Du bist aber Herr der Zeit; an dir stürmt sie vorüber und du bleibst ewig jung und frisch. An deinen Füßen ziehen die Wogen des Geschichtsmeeres vorüber, aber sie können dich nicht berühren. Du bist über aller Zeiten Wandel erhaben. Wie unsere Väter auf dich hofften und nicht zuschanden wurden, so werden, wenn von unserem Staube kein Atom mehr da ist, andere Geschlechter kommen und sagen: Mein Gott, mein Vater!
Das ist das Große, was das Herz schwellen läßt: ich bin nicht wie ein Tropfen im Weltmeer, auf dem die Sonne einen Augenblick fällt, und der Tropfen taucht ins Meer hinab und es ist vorbei; sondern der Herr aller Zeiten hat meine Zeit in seinen Händen: Meine Zeit steht in deinen Händen; du hast mich erlöst, du treuer Gott. (Ps. 31 16, 6.) – Und das ist das Große, daß Gott auch den Raum beherrscht und durchwaltet, in dem mein armes Leben sich vollzieht. Siehe, spricht er, ich will mit dir sein und dich behüten, wo du hinziehst. (1. Mos. 28 15.) Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, und bliebe am äußersten Meere, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten! (Ps. 139 8–10.) Mit einem Wort: Gott ist nicht nur Person – das bin ich auch – sondern Gott ist die Persönlichkeit.
Und das ist das Wundersame, daß diese alles umfassende, alles überragende, alles überwaltende Persönlichkeit für mich da ist, für mich allein. Denn wenn ich bete, dann gehe nicht ich bloß in mein Kämmerlein, sondern ich nötige Gott mit meinem Kämmerlein vorlieb zu nehmen. Wenn ich bete, tritt eine Selbstsucht in mein Leben, die erlaubt, ja geboten, ja nicht nur geboten, sondern auch notwendig ist. Denn ein Gebet, das nicht Gott gleichsam zwingt, ein Anliegen, das nicht so dringend vorgebracht wird, als gäbe es außerdem überhaupt kein anderes Anliegen mehr, ist von keinem Wert.
So danke ich es ihm jetzt im Staub und, wenn er Gnade gibt, einst in der Verklärung, daß er der Einzige ist, der ewig spricht: Ich! Und daß er zugleich der Einzige ist, der mich zeitlich sprechen läßt: Du! Denn alle Menschen, auch die geliebtesten, zu denen ich Du gesagt und denen ich mein Herz erschlossen habe, die gehen alle dahin. Wie viele stehen an Gräbern, sprechend: Ich hätte dir noch so viel zu sagen und du hörst mich nimmer. Aber er ist der Einzige, der von meinen ersten Lebenstagen an, wo ich ihn schauernd ahnte, bis zu meinem letzten, wo ich in Schrecken zittere und doch in Hoffnung scheide, mich zu sich sagen läßt: Du! Der Philosoph Fichte hat den Geburtstag seines ältesten Sohnes an dem Tag begangen, wo er „ich“ sagen konnte. Kleine Kinder reden ja lange von sich in der dritten Person und lernen weit eher „du“ als „ich“ sagen. Ein feiner und lehrreicher Gedanke; denn Erwachsene sagen immer erst ich, dann erst du. Wenn das Kind anfängt zu denken, sagt es du; wenn es anfängt in Sünden zu geraten, sagt es ich.
Aber das ist göttliche Harmonie, daß mein Ich in seiner Sünde und Unbedeutendheit und sein Du in seiner Reinheit und Allmacht sich so zusammenschließen, und daß er, der Allgenugsame, sprechen mag: Gib mir, mein Kind, dein Herz! (Spr. 23 26.) Er weiß, was er verlangt: ein törichtes, trotziges, verkehrtes und verzagtes, ein kindisches, stürmisches, leeres und loses Herz. Er sagt nicht: dein reines, edles, reiches, geadeltes Herz, er sagt schranken- und bedingungslos: Gib mir, mein Kind, dein Herz! Und schüchtern, er, die einzige Urpersönlichkeit, schüchtern fährt er weiter: und laß deinen Augen meine Wege wohlgefallen! Deinen Augen meine Wege! Ja, wenn er sagen würde: Laß meinen Augen deine Wege wohlgefallen, das verstünde ich. Ihr sollt heilig sein; denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott! (3. Mos. 19 2.) So sagt er aber nicht. Sondern die einzige ewige Persönlichkeit neigt sich so zu dir, o armer Mensch, daß sie spricht: Laß deinen Augen, den blöden, kurzsichtigen, stumpfen und blinden, laß deinen Augen meine Wege wohlgefallen!
So nehmt es in euer Herz: Er ist Persönlichkeit! In der Stunde, in der mir jemand beweisen würde, daß Gott nicht Person ist, würde mich die Verzweiflung umarmen. In der Stunde, in der euch der Gott eurer Väter dadurch geraubt wird, daß man euch seine Person entzieht, wäre es besser, ihr wäret nie geboren. (Matth. 26 24.) Aber in der Stunde, in der es durch meine Seele mit tausendfachen Harmonien zieht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthaus geführt hat! (2. Mos. 20 2). In der Stunde jauchzt alles in mir: Gott hat mich nicht verlassen. Vater und Mutter verlassen mich, Arbeit und Mühe scheiden von mir, Ehre und Erfolg weichen und wanken; was mir lieb war, das wird mir zum Überdruß, was mir wert schien, verliert den Glanz. Aber du bist es, der mein Leben mit Glanz erfüllt, du bist der Herr!
Und zum Zweiten: die Urpersönlichkeit Gottes ist selig. Natürlich, sagt ihr, daß Gott selig ist, wissen wir. Er wohnt in ewigem Reichtum, er ist aller Dinge Fülle. Aber er ist noch mehr. Die Seligkeit Gottes ist seine Allgenugsamkeit. Das ist das Geheimnis: Er braucht dich nicht, aber er will dich. Manche Schwärmer lehren: Gott wäre ohne mich weniger. Wenn er mich nicht hätte, wenn meine Seele nicht heimkäme, würde er arm sein; also braucht er mich, nicht ich ihn. Das ist satanischer Hochmut und nicht christliche Demut. Gott braucht niemand von uns, niemand und nie, aber er will uns gebrauchen. Der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht erhöhen (1. Kön. 8 27), bereichern, wie sollte ich das können? Und doch spricht er: Kommet zu mir! (Matth. 11 28.) Die Seligkeit Gottes ist die Folge seiner Persönlichkeit. Er hat alles und ist alles und vermag alles und braucht mich nicht und bedarf meiner nicht und keines Menschen, aber er will mich. Man hat gefragt: Warum hat er die Welt geschaffen? und hat die Antwort gegeben: weil er sie braucht. Schiller sagt einmal:
Freudlos war der große Weltenmeister,
Darum schuf er Welten, schuf er Geister,
Zeugen seiner Herrlichkeit.
Das war vor hundert Jahren der Glaube und der hebt wieder an: daß Gott den Menschen geschaffen hätte um seiner selbst willen, damit er ihm die Öde der Erde vertreibe und die Eintönigkeit des Lebens versüße. Wozu brauche ich denn zu beten, wenn ich weiß: er kann ohne mich nicht sein? Was brauche ich dann heilig zu leben, wenn ich weiß: er muß mich ja doch haben? Niemand betrüge mich mit vergeblichen Worten! Ihr merkt es, welch ein Gift in solchen Sätzen liegt. Nein, er braucht mich nicht. Während auf Erden der Streit ist, ist bei ihm lauter Licht. Während hier die Gegensätze bis aufs Blut sich befehden, ist bei ihm eitel Friede. Während auf Erden sich alles in Widerspruch bewegt und das Eine vom Tode des Andern lebt, und das Andere am Leben des Einen stirbt, ist er in vollem Genügen.
Menschliches Wesen, was ist’s gewesen?
In einer Stunde geht es zugrunde.
Alles vergehet, Gott aber stehet,
Ohn alles Wanken; seine Gedanken,
Sein Wort und Wille hat ewigen Grund.
Er braucht dich nicht. „Mich hat deines Dienstes nicht gelüstet; mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gesättigt. Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. (Jes. 43 23. 24.)
Er ist der Allgenugsame, der Allselige. Und nun nimmt diese allgenugsame Größe, der, von dem, zu dem, in dem alle Dinge sind (Röm. 11 36), der von niemand erkannt worden ist und in dessen Art niemand sah, dem niemand etwas zuvor gab (Röm. 11 35), dieser allgenugsame Gott nimmt mich in seinen Dienst. Was ist der Mensch, daß du sein gedenkest, und des Menschen Sohn, daß du dich seiner so annimmst? (Ps. 8 5.) Hier beginnt die tiefe Dankbarkeit. Wenn du mich nicht mehr brauchen wolltest, – und obgleich täglich die Menschen mich mit Liebe überschütteten und mit Dank mich umrauschten, es wäre doch ein leeres, elendes, nutzloses Leben. Aber wenn du mich brauchst, werden die ärmsten Stunden königlich reich, die niedrigsten Dienste majestätische Vorrechte und königliche Gerechtsame; und die arme Bettlerin und der Straßenkehrer, die der hochmütige Blick kaum streift, werden erlauchte Majestäten ihres Gottes.
Mein Meister rufet mich, er will mich brauchen. Was ist das für ein wundersamer Gott, der aller Dinge Fülle hat, vor dessen hl. Wort die Trauben schwellen und köstlichen Wein geben – und der dann spricht: Gehet hin in meinen Weinberg! (Matth. 21 28.) Was ist das für ein Gott, dem die Ernte entgegenreift und der die ganze große Welt zur Ernte hin sich zeitigen heißt, und der dann spricht: Arbeitet in meiner Ernte! Was ist das für ein Gott, der zu der einzelnen Seele sagt: Siehe, ich will dich, der Meister ist da und ruft dich! (Joh. 11 28.) Und du klagst über deinen geringen Dienst und sprichst: Wenn ich nur so wäre wie der und die. Du neidest törichte Dinge und bist dabei mit einem Diadem geschmückt, von dem du noch nie eine Perle beachtet hast. Ein Diener Gottes bist du! Mein Christ, das sind alle jene erlauchten Persönlichkeiten droben in den Dachkammern, im vierten oder fünften Stock der Großstadthäuser, zu denen nie ein Pfarrer seinen Weg findet, die nie von einer Dienerin der Barmherzigkeit besucht werden, deren elende Dachlucke aber eine Aussicht hat nach dem Jerusalem, das droben ist. (Gal. 4 26.) Das sind die armseligen Existenzen, bei deren Ende der Armensarg schnell gezimmert, an deren Grab eine kurze Formel schnell gelesen ist, die aber den Ruf ihres Königs vernommen haben: Siehe, ich sende dich! Der Allgenugsame tritt in dieser Stunde vor deine Seele und spricht: Willst du es nicht mit mir versuchen? Er könnte dich zwingen; du müßtest ihm frönen, bis der letzte Schweißtropfen auf deiner Stirn vertrocknet ist; er könnte dich sklavisch knechten an Leib und Seele. Und er wirbt um dich und bittet dich, und wenn du ihn zurückweist, kehrt er traurig von dir, um in der nächsten Stunde noch einmal zu kommen und dir zu sagen: Gib mir dein Herz! –
Er ist Person, darum rufe ich ihn: Du! Er ist der Allgenugsame und dennoch will er mich. Wir geben ihm nichts und er dankt uns. Wir leisten ihm nichts und er rettet uns. Wir können ihn nicht bereichern und er belohnt uns. Ei, spricht er, du frommer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude! (Matth. 25 21.) Und dieser allgenugsame Gott ist zum dritten der ewige und unveränderliche Gott!
Die alten Heiden haben Launen ihrer Götter gekannt und gefürchtet. Sie haben von der umwölkten Stirn des Göttervaters gefabelt und von der ewig lichten Stirn ihrer Göttin geträumt. Und Dichter sprechen von den Tücken des Schicksals und der Willkür des Zufalls und reden von einem freundlich lächelnden Himmel und den günstigen Launen des Geschicks. So bist du, armer Mensch, nur abhängig von Launen, die den einen erheben und liebkosen, den andern verwerfen und verspotten? Bist du Beute einer lächelnden Willkür, die mit dir eine Weile spielt und dich dann wegwirft, die dir Hoffnungen ins Herz senkt, um sich bald an deiner Enttäuschung zu erquicken?
Sobald mich solche Gedanken bedrängen, sucht meine Seele das Kreuz! Wenn er mir wirklich die Hoffnung ins Herz gesenkt hätte, um sich an meiner Verzweiflung zu weiden, wenn er mir die Freude gegönnt hätte, um mich an ihrer Entbehrung zu töten, dann wäre dieses schweigende Kreuz nicht der Erde entwachsen, und der, der die Hände ausbreitet um die Mühseligen und Beladenen an sich zu ziehen aus lauter Güte wäre nicht mein Heiland.
Der persönliche und allgenugsame Gott ist auch der ewige und unveränderliche, der da ewig denselben Sinn trägt. Weil er Licht ist, über das kein Schatten zieht, und Glanz, den keine Finsternis trübt, darum ist er auch Liebe, die nicht rastet, bis sie gefunden hat, und nicht ruht, bis sie getröstet hat.
Aber ich höre dich einwenden: Wenn sein Sinn unveränderlich ist, was rätst du mir dann das Gebet, das Bitten? Sein Entschluß steht doch fest. Höchstens das Dankgebet hat dann noch einen Sinn!
Das unveränderliche, ewige Wesen deines Gottes gleicht nicht der unverständigen Art deines Sinnes, sondern ist die Unveränderlichkeit der ewigen Liebe, welche deine Gedanken und deine Bitten in ihren Plan einordnet und sie erhört. Das wäre Veränderlichkeit Gottes, wenn er einmal die Liebe zu sein aufhörte. Aber das ist nicht Veränderlichkeit Gottes, wenn ihm dein Elend reut. Das wäre Veränderlichkeit, wenn er einmal dir verböte, zu ihm zu beten, nachdem er doch geboten: du sollst mein Antlitz suchen! (Ps. 27 8.) Aber das ist nicht Veränderlichkeit, daß er seine Gedanken von den deinen bestimmen läßt, nicht weil er muß, sondern weil er will. Es ist nicht Veränderlichkeit Gottes, daß das kleinste Kind, das sein Gebet und seine Bitten kaum überdenkt, mit an Gottes Weltregierung teil hat. Das ist nicht ein Traum frommer Schwärmer sondern: du bist ein Gott, der Gebete erhört (Ps. 65), und doch bleibest du, wie du bist. (Ps. 108 28.)
Es gibt auf Erden nichts Unveränderlicheres als die Mutterliebe und darum hat Gott seine Liebe mit der einer Mutter verglichen: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. (Jes. 66 13.) Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen? Und ob sie desselbigen vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen! (Jes. 49 15.) – In unserer Erinnerung lebt das Bild der Mutter als das einer unveränderlichen Güte. Daß sie manchmal ihre Worte und ihre Weisung änderte, weil sie unser kindliches Bitten sah und hörte, weil Kindesbitte und Mutterherz sich verstanden – war das Schwäche? War es veränderlich, wenn sie einen Rat, den sie mir gestern gab, um der eingetretenen andern Verhältnisse willen heute zurücknahm? Nein, das war Treue! Daß sie meine kleinen Dinge und Anliegen in ihr großes, reiches Leben hereinnahm, war nicht Laune, das war der Mutterliebe unveränderliche Größe.
Und wenn es bei sündigen Menschen so ist, wie viel mehr muß es so bei Gott sein! Er ist darum unveränderlich, weil er sich von mir bestimmen läßt; denn er hat es mir zugesagt, daß ich alle meine Anliegen auf ihn werfen dürfte (Ps. 55 23), daß er mich erhört zu seiner Zeit.
So, mein Christ, hat der ewige und unveränderliche Gott dir das Vorrecht gegeben, daß er dir zuruft: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht! (Matth. 24 35.) Und auf diese wunderbare Offenbarung, die ein Menschenleben mit Sonne und Licht durchflutet, habe ich keine andere Antwort, als die schüchterne, die ein Kind aussagt, die gewaltige, an der ein Mann sich verzehren kann:
Ich glaube an Gott den Vater, Allmächtigen.
4
Herr, lehre mich doch, daß es ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muß. Ps. 39, 5.