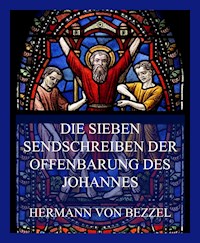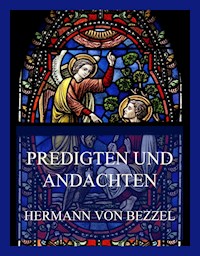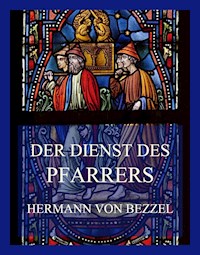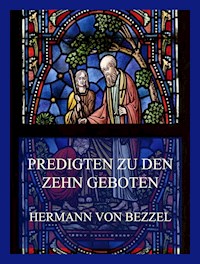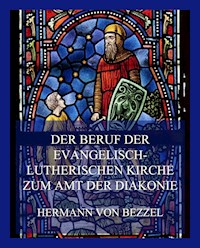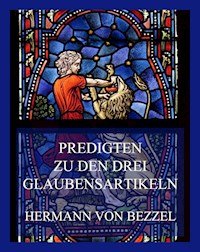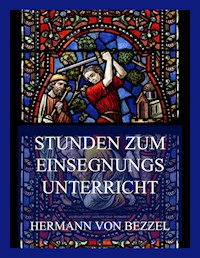
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der 1917 in München verstorbene Hermann von Bezzel war lutherischer Theologe, Rektor der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und Oberkonsistorialpräsident der bayerischen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. In diesem Werk finden sich Unterrichtsstunden aus den Einsegnungsunterrichten, die Bezzel 1892 und 1909 gehalten hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stunden zum Einsegnungsunterricht
HERMANN VON BEZZEL
Stunden zum Einsegnungsunterricht. H. von Bezzel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662264
Cover Design : Cropped, 27310 Oudenaarde Sint-Walburgakerk 87 by Paul M.R. Maeyaert - 2011 - PMRMaeyaert, Belgium - CC BY-SA.
https://www.europeana.eu/en/item/2058612/PMRMaeyaert_eaa59c4c3340ca0a0e5d1bfdf2aaafc1522cc823
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Einsegnungsunterricht 1892. 1
1. Stunde.1
Zweite Stunde. Montag Abend.7
Dritte Stunde. Dienstag Morgen.13
Vierte Stunde. Dienstag Abend.18
Fünfte Stunde. Mittwoch früh.24
Sechste Stunde. Mittwoch Abend.29
Siebente Stunde. Donnerstag früh.35
Achte Stunde. Donnerstag Abend.41
Neunte Stunde. Freitag Morgen.49
Zehnte Stunde. Freitag Abend.55
Elfte Stunde. Samstag früh.62
Zwölfte Stunde. Samstag Abend.66
Einsegnungsunterricht 1909. 71
1. Stunde.71
2. Stunde.80
3. Stunde.88
4. Stunde.98
5. Stunde.110
6. Stunde.122
7. Stunde.133
8. Stunde.146
9. Stunde.158
10. Stunde.167
Einsegnung am 25. Juli 1909.176
Einsegnungsunterricht 1892
1. Stunde.
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, und erfüll die Herzen Deiner Gläubigen, wie Du sie einst am Tage Deines Pfingsten erfüllt hast, und schenke ihnen aus Deiner Fülle, daß sie Dich, Jesum Christum, unsern Herrn, samt Gott dem Vater einmütiglich preisen mögen. Amen.
In dem Herrn Christo geliebte Schwestern, es mag Ihnen vielleicht befremdlich gewesen sein, daß, als Ihnen die Mitteilung geworden, das Mutterhaus habe Sie für fähig erachtet, eingesegnet zu werden, ich Ihnen gerade das hohepriesterliche Gebet zur Betrachtung empfohlen habe, weil ja scheinbar dieses Gebet mit den nächsten Aufgaben, die Ihrer warten, ja mit den Aufgaben der ganzen Diakonissensache zunächst nicht viel zu thun hat – aber desto mehr sollen wir inne werden, daß in dem hohenpriesterlichen Gebete des Herrn, wie alle Bewegungen Seiner Kirche auf Erden, so auch der jüngsten Bewegungen eine, die Diakonissensache mitgefaßt worden ist. Wir haben nicht bloß das Recht, sondern geradezu die Pflicht, uns alles das anzueignen, was Er für Seine ganze Kirche fürbittenden Herzens im hohepriesterlichen Gebet Seinem himmlischen Vater vorgetragen hat.
Es ist, seitdem die Diakonissensache in unserer Kirche wieder bekannt geworden ist, ein mächtiger Umschwung in der Beurteilung und Stimmung seitens der Welt vorgegangen. Als vor nun bald 60 Jahren der sel. Fliedner, vor nun bald 40 Jahren unser sel. Vater Löhe die Diakonie begonnen haben, da war die Stimmung der Welt, wenns hoch kam, eine zuwartende, keineswegs eine günstige, fördernde, von warmen Wünschen begleitete. Die warmen Wünsche und ernsten Gebete wagten sich nicht aus dem engsten Kreise heraus. Die Kirche im allgemeinen und die Welt im ganzen und großen hatten für die Sache keine Wünsche, Mißtrauen um so mehr. Es ist anders geworden. Sie und ich leben in einer Zeit, in der ein mächtiger Umschwung zu Gunsten dieser Sache vor sich gegangen ist. Die Diakonie ist in der Kirche kein landfremdes, unbekanntes Kind mehr; sie hat Bürgerrecht [un]d Heimatschein in derselben bekommen. Sie ist auch nicht mehr fremd in der Welt und unbekannt, sie hat sich heimisch gemacht in der Welt, sie wird von ihr anerkannt. Da mag es für den ersten Augenblick scheinen, als ob jenes Wort der Schrift sich erfüllt hätte: „Wenn jemandes Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht Er auch seine Feinde mit ihm zufrieden!“ Es mag ein erhebender Gedanke sein, daß die Welt sich für uns erwärmt und uns mit ihrem Interesse begleitet, aber es muß wohl dabei bedacht werden, daß die Welt nur aus selbstsüchtigen Interessen die Diakonissensache fördert; in demselben Augenblick, da wir nicht bloß dienend, sondern bekennend vor die Welt hintreten, wird man um dieses Bekenntnisses willen den Dienst zurücktreten lassen – und um der Entschiedenheit des Bekenntnisses willen den Dienst nicht mehr so würdigen. Die Mißgunst der Welt, unter welcher die Diakonie lange gelitten, war eine weit geringere Gefahr, als die Sympathie, welche diese jetzt der Sache entgegenbringt. Das mangelnde Verständnis von Seiten der Welt könnte die Schwestern dahin fördern, daß sie sprechen lernen: Wir gehen dem Herrn und Seinem Kreuze nach, wir sind Dienerinnen Dessen, Der auch auf Erden nicht wußte, wo Er Sein Haupt hinlegen sollte – Er hatte keine bleibende Stätte, darum soll auch der Ihm erwiesene Dienst die Sympathien der Welt nicht haben. Die Mißgunst der früheren Jahre war eine weit geringere Last, als die Gunst unserer Zeit. Diese hat eine große Gefahr. Die Sache der Diakonie macht, ohne es zu wollen und zu wissen, der Welt Zugeständnisse; auch die einzelne Schwester macht in ihrem Auftreten, Dienen und Handeln der Welt Zugeständnisse und nicht dem Weltheiland. Je mehr die Welt sich für diese Sache erwärmt, desto mehr werden die einzelnen Schwestern und die ganze Sache Gefahr laufen, zu werben um die Gunst der Welt. Das, was Ihrem Beruf die eigentliche Weihe giebt, wird mehr und mehr abgestreift, flüchtige Interessen, vergängliche Sympathien der Welt kann man nur erwerben, wenn man unvergängliche Interessen und heilige Rechte daran giebt. Der berufene Diener Christi hat von Seinem Herrn die heilige Pflicht erhalten, zu warnen, so lange es Zeit ist. Nehmen wir es ganz äußerlich: Die Sache wächst nach außen, neue Häuser bilden sich, ohne daß das Bedürfnis nachgewiesen wäre, wie durch einen warmen Frühregen, so kommt die ephemere Existenz eines Hauses zum Vorschein. Aeußerlich genommen wächst die Sache mächtig, aber nicht darum, weil die Forderungen strenger würden, die Ansprüche wüchsen, sondern weil man den an sich engen Weg etwas verbreitert und die schmale Pforte erweitert. Die römische Kirche verschärft die Forderungen an ihre Schwestern; die Neugründungen der römischen Kirche haben strengere Askese; dort füllen sich die Häuser trotz der wachsenden Strenge, bei uns wegen einer gewissen Laxheit, wem hier nicht die Augen aufgehen, dem ist überhaupt nicht zu helfen, wer hier nicht merkt, wo die Gefahr ruht, der merkt überhaupt nichts mehr. Das wollen wir uns sehr ernstlich gesagt sein lassen, darin liegt unsere Gefahr, daß wir die Diakonissensache verallgemeinern, daß wir das Feuer, welches der Herr auf dem Altar angezündet hat, in die Welt hinaustragen, ohne daß es genügend geschützt wäre. Die Einfachheit und der Ernst, welcher die Sache bisher getragen hat, muß bleiben und noch mehr verschärft werden. Mein Ideal ist, daß unsere Schwestern immer mehr mit ernstem Blick der drohenden Gefahr entgegensehen und die Fehler, die sie selbst begangen haben, um diese Gefahr heraufzubeschwören, erkennen und sie überwinden.
Unsere Sache soll nicht als eine von der Welt begrüßte und getragene, sondern nur als eine von der Welt geduldete sich fühlen. Unser Bestreben, unsere Arbeit, unser Ringen, unser Bitten gehe dahin, daß die Sache nur eine geduldete bleibe. Die Not wächst ins Immense, die Hilfsbereitschaft nicht in diesem Grade, infolgedessen müssen die einzelnen mehr leisten. Die Welt freut sich dieser Mehrleistung, läßt sie sich gefallen – wir aber müssen bedenken, daß diese Mehrleistung, wenn sie nur eine quantitative, unbedingt auf Kosten der qualitativen geschehen muß. Die Schwestern geben aus und nehmen nicht mehr ein; sie verlieren sich in ihrer Werkgeschäftigkeit, deshalb glaubte ich, Ihnen das hohepriesterliche Gebet auslegen zu dürfen, weil in diesem Gebet die Wurzeln der Kraft für das Leben Seiner Kirche liegen und das rechte Verhältnis dargestellt wird zwischen der schauenden und anbetenden Liebe einerseits und der wirkenden anderseits. Würde unsere Liebe zu dem Herrn und Heiland nur eine schauende und betrachtende sein, wie wohl in der alten Kirche manchmal gemeint wurde, so würde das ein Leben des Genusses werden. Würde unser Verkehr mit unserm barmherzigen Hohenpriester und durch ihn mit unserm Herrn und Gott bloß beschaulicher, betrachtender Art sein, so müßte dieser Verkehr Genuß werden um des Genusses willen, – er würde bald kranken und dann unfähig machen, die Zeichen der Zeit und ihre Aufgaben zu verstehen. Würde unsere Liebe bloß eine wirkende (in anderer Weise wirkend) – sein, so müßte sie sich in Vielgeschäftigkeit verlieren, die noch weit gefährlicher wäre, als die Vielgeschäftigkeit der Welt. Christen werden durch die Vielgeschäftigkeit sterben; der eine stirbt am Zuviel des Genusses, der andere am Zuviel der Arbeit – unser Heiland will uns das rechte Verhältnis zwischen der anbetenden und betrachtenden, – wirkenden und leidenden Liebe zeigen. Lassen Sie uns einen Blick werfen in das Leben des Herrn: Ein Kirchenlehrer hat unsern Herrn Christum den großen Einsamen geheißen, Er ist der große Einsame, der, weil Er Sich von der Welt nicht verstanden wußte und fühlte, allein durch die Welt ging mit Seinen Sorgen, Anliegen und Gebeten, unverstanden und ungekannt, der Sich immer und immer wieder zurückzog in die innersten Gemächer, in die geheimste Verborgenheit des inneren Lebens. Mit dem Gebetsleben und aus dem Gebetsleben heraus kommt die Verklärung des Herrn. Er hat Sich vertieft in die Geheimnisse Seines Gottes, Er hat sprechen gelernt: Dein Wille geschehe! Das war für Ihn und ist für uns die Krone der betrachtenden und beschauenden Liebe. „Dein Wille geschehe,“ darin liegt, daß Er allmählich Sich hineinlebte in die Reichsgedanken Seines ewigen Gottes, daß Er sagen konnte: „Dein Wille ist der meinige, Deinen Willen thue Ich gerne.“ Aber diesem betrachtenden Leben gegenüber steht das Leben der größten Thatkraft, wir dürfen nur ein Kapitel im Evangelium Marci aufschlagen, so werden wir dessen gewahr, wie unser Herr Christus Seine Tage ausgenützt hat vom frühen Morgen bis zum späten Abend. „Er heilte sie alle,“ – „Ich muß wirken, solange es Tag ist.“ Eingedenk der Nacht des Todes, die auch Ihn umfangen sollte, wirkte Er in so selbstvergessender, hingebender Weise, daß Er das Vorbild der wirkenden Liebe geworden ist. „Eure Stunde ist allewege; Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Bei menschlichem Thun und Treiben ist die eine Stunde eben so bedeutsam wie die andere, weil auf die einzelne Zeitfolge durchaus nichts ankommt. Für Menschen-Thun und -Weise ist die Zeit nur der äußere Rahmen; bei Ihm ist alles vollkommen systematisch, vollkommen geordnet. Er will Seine Stunde abwarten, um sie auszufüllen mit Seinem Thun. Ja, so hat unser Herr und Heiland gewandelt auf Erden – in betrachtender Liebe Seinem himmlischen Vater hingegeben, in betendem Ringen von Ihm Sich Kraft erholend und mit immer erneuter Kraft auftretend, immer die richtige Stunde zum richtigen Handeln erfassend, die Stunde auskaufend bis auf ihre letzten Minuten. Die Zeit war kurz für Ihn, und wie hat Er sie ausgefüllt! Wenn uns bang ist um unsere Stellung, hier haben wir Den, der mit einem einzigen Worte Sich die Anerkennung der ganzen Welt hätte erkaufen können und dies Wort nicht gesprochen hat, der mit einer einzigen That, einer einzigen Konzession die Anerkennung, Stimmung und Gunst der ganzen Welt hätte erwerben können und diese That ungeschehen gelassen hat. Von Ihm können wir lernen, wie wir der Gefahr der allzugroßen Beliebtheit begegnen und sie dadurch beschwören, daß wir ein einziges Wort ungesprochen lassen, welches aber doch die Fülle des ganzen Lebens in sich schließt, und dies Wort heißt: Mit der Welt – „Wäret Ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb,“ – „Sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch Ich nicht von der Welt bin.“
ER hat uns das Vorbild gelassen, daß Er ein einziges Wort ungesprochen gelassen hat, das Wort: „mit der Welt.“ Wenn wir aber viel zu schwach sind, „aus eignem Meinen und eigener Kraft den ernsten Gefahren zu begegnen, und wenn auch Sein Vorbild uns viel zu erhaben und zu ferne dünkt, als daß wir es in unser Leben hereinnehmen könnten, so soll das Gebetsleben, das Leben der Beschauung, uns dasselbe näher bringen. Die weisen Ordnungen unseres Hauses haben Ihnen die stillen halben Stunden verordnet. So kurz meine Wirksamkeit hier ist, so viele Klagen habe ich schon gehört, daß dieselben auf den auswärtigen Stationen so oft nicht können eingehalten werden. Es liegt auch nicht so viel an der Form. Die ist ja sehr heilsam; aber wo sie nicht möglich ist, da tritt St. Paulus ein mit seinem: „Betet an ohne Pause,“ betet an, ohne daß zwischen Euch und Euren Heiland etwas dringe. Das können Sie, wenn Sie sich den innern Umgang mit Ihrem Herrn wahren, wenn Sie im Herzen einen Raum haben, in sich hinabsteigen, sich in sich selbst vertiefen, sich zurückziehen in das Heiligtum des inneren Lebens, in welchem nur Ein Name sein darf. Das allein bewahrt vor der schweren Gefahr, das allein rettet aus der ernsten Not, das allein macht stark, Seinem Vorbild zu folgen. Und wenn Sie diese Gefahr erkannt haben und in täglichem und ungeschminktem Gebetsleben in Ihrem Herzen bewegen, dann, nur dann sollen Sie wirken mit dem ganzen Ernst einer wirksamen Persönlichkeit, wirken mit der ganzen Freudigkeit einer von Christo geheiligten Persönlichkeit, mit der Erhabenheit einer um das Urteil einer urteilslosen Menge sich nicht kümmernden Persönlichkeit. „Heilige uns, Herr, in Deiner Wahrheit“, in der Wahrheit Deines Gebetslebens, Deines Betrachtungslebens, Deines Wirkens, Schaffens, Arbeitens, Du hast uns das Heilmittel gegeben, „Dein Wort ist die Wahrheit.“ Das sei der Gegenstand meiner Fürbitte für Sie.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen möchte ich an das hohepriesterliche Gebet selbst herantreten und den Stoff so behandeln, daß wir zunächst eine exegetische Erklärung und sodann eine praktische Anwendung geben. Für beides erflehen wir den Segen Dessen, ohne den wir nichts thun können.
Der Name „hohepriesterliches Gebet“ ist noch nicht so sehr alt. Chyträus, Theologe im Mecklenburgischen, welcher bei der Abfassung der Konkordienformel mitbeteiligt war, hat diesen Namen zuerst gebraucht, weil in diesem Gebet unser Herr und Heiland vorweg genommen hat Seine Stellung, die Er jetzt der Welt gegenüber hat, vorweg genommen das hohepriesterliche Amt, dessen wir uns jetzt getrösten. Es ist, als ob uns der Herr mit diesem Gebete den Vorhang in etwas möchte heben, der noch vor Seinen Augen ist und die Herrlichkeit verhüllt, vor Seinem hohepriesterlichen Leiden und Wirken hat Er Sich Seinem himmlischen Vater geoffenbart; indem Er in beschauender und betrachtender Liebe zuvor an Ihn herantritt, wird er befähigt, in hohepriesterlichem Wirken und Leiden den Gehorsam zu üben. Es ist das Gebet aller Gebete, leicht an Worten, und groß an Inhalt. Es hat am wenigsten Formulierung und doch so viel Worte, so viel hohe Gedanken, daß Spener (1635–1705), der auch für unsere Kirche von unnennbarem Segen gewesen, nie über dies Gebet zu predigen wagte, aber vor seinem Scheiden es sich dreimal lesen ließ. Der Vater unserer Kirche, Luther, der am allermeisten verstand, was unserer Kirche not that, hat Abschiedsreden Christi geschrieben und darin auch das hohepriesterliche Gebet betrachtet. Diese Abschiedsreden gehören zu dem Besten, was Luther geschrieben hat und seien hiemit auf das Wärmste empfohlen.
Nur eine Frage erhebt sich: Wo hat der Herr Christus dies Gebet gesprochen? Die drei anderen Evangelisten haben dies Gebet nicht. Allein Johannes zeichnet es auf. Von Seinem Ringen im Garten berichten die Synoptiker, Johannes erwähnt davon nichts. Man hat gesagt: „Wie ist es möglich, daß aus der Hoheit und Sicherheit dieses Gebetes unser Herr in das Zittern und Zagen eintritt, aus dem Geborgen-sich-wissen in diese Vereinsamung und Verlassenheit? Ja, das ist schwer zu erklären, es bleibt ein Rätsel. Ich will versuchen, einiges darüber zu sagen. Was unserm Herrn an innerlichem Bewußtsein schon längst klar geworden war Seiner göttlichen Natur nach, das mußte durch Kampf und Ringen hindurch von Seiner menschlichen Natur angeeignet werden. Dieser Wechsel der Stimmung von der Hoheit des über das Leiden hinübersehenden Triumphes in die Tiefen des den Triumph übersehenden Leidens, das war eine Mitgift Seiner menschlichen Natur, ein Ausfluß der Schwäche des Leibes, welche unser Herr uns zum Trost getragen hat. Wenn wir von der Hoheit des weltüberwindenden Glaubens herabsinken müssen in die Tiefen des ringenden „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ dürfen wir uns des getrösten, daß unser Heiland, der in Seinen höchsten, von Gott geheiligten Augenblicken nicht beharren durfte, Seinen Dienern und Dienerinnen helfen will. Gesprochen hat Er es noch nicht im Garten Gethsemane, sondern in dem Gemach, in dem ER das heilige Abendmahl eingesetzt. Es knüpft an an das Wort: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, fasset Mut, Ich habe die Welt überwunden.“ Die Tiefen, die noch zwischen dem wirklichen Ueberwinden und dem jetzigen Standpunkt sind, die sind durch die Brücke des Glaubens übertragen. Luther sagt: „Das ist die Wahrheit: wo der Herr Christus anfängt zu kämpfen, da beginnt ER zu triumphieren.“ Habe ich innerlich überwunden, so wird mein Herr und Gott nicht zulassen, daß ich äußerlich zu Schanden werde. ER hat die Welt überwunden, und damit giebt ER Seiner Gemeinde auf Erden den Trost, daß ER in ihr und mit ihr die Welt überwinden wird. Was bangen wir? Was ängsten wir uns vor den Gefahren der Welt? ER hat die Welt überwunden, Er hat alles überwunden, auch diese Gefahren. An uns liegt es, Seine Siegeskraft ins Leben treten zu lassen. Sie ist gebunden, wenn wir sie binden, sie ist gelöst, wenn wir sie lösen. Laßt uns die Welt überwinden, laßt Seine besiegende Kraft sich entfesseln durch unser Gebet. In ihm ist unser Sieg.
O Herr Jesu Christe, treuester Erbarmer, der Du uns den Trost Deiner weltüberwindenden Gnade zugesagt hast, wir eilen zu Dir arm und sehr verlassen und bitten Dich, Du wollest aus der Kraft Deines Sieges uns, den Schwachen, neue Kraft bereiten, uns, den Armen, aus dem Reichtum Deines Erbarmens alles schenken, dessen wir bedürfen, und unser Herz sehr getrost machen in Deiner Nachfolge. Ohne Dich nur Niederlage, in Dir nur Sieg. Herr, laß es uns so erfahren um Deiner Liebe willen. Amen.
Zweite Stunde. Montag Abend.
O Herr Jesu Christe, Du ewiger Erbarmer, der Du uns willst die Gnade verleihen, daß wir aus dem Aufblick zu Dir neue Kraft zum Dienen und Leiden erhalten, wir bitten Dich, verleihe uns immer mehr Erleuchtung unseres Geistes, daß wir Dich erkennen in Deiner Gewalt und in Deiner Gnade. Amen.
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, Ich habe die Welt überwunden. Es ist, ehe wir uns über dies Wort unseres Herrn und Heilandes noch kurz besprechen, notwendig, uns klar zu machen, was die Schrift unter „Welt“ versteht. Man kann nur das meiden, was man kennt. „Welt“ ist ein vieldeutiger Begriff. Man hat wohl eine allgemeine Umfassung des Begriffs, man ordnet alles Mögliche, vielleicht was einem unsympathisch ist, in diesen Begriff ein und giebt sich die Mühe nicht, klar zu sehen. Die Welt nach der Schrift ist zunächst die aus Seiner Hand hervorgegangene, mit dem Prädikat „sehr gut“ geschmückte, von Seinem Willen getragen, von Ihm geordnet, trug sie den Stempel Seiner Herrlichkeit. Durch die Sünde ist eine falsche Mischung hereingekommen, nun setzt der Gegensatz ein. Es ist nicht richtig, daß man Welt identifiziert mit dem Reich des Bösen. Das eigentliche Wesen der Welt nach den Worten unseres Herrn und Seiner Apostel ist die Zwieschlächtigkeit, die untemperierte, ungeordnete Mischung zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge. Auf der einen Seite heißt es: „Habt nicht lieb die Welt,“ auf der anderen: „Also hat Gott die Welt geliebt.“ Auf der einen Seite haben wir das Verbot, diese Welt zu lieben, auf der anderen Seite wird uns gezeigt, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Also das eigentliche Wesen der Welt ist die Mischung zwischen Wahrheit und Irrtum, Licht und Finsternis. Kein Mensch auf Erden ist so geliebt und so gehaßt worden, wie unser Herr Jesus Christus, keiner so glühend, so mit der ganzen Seele erfaßt und wiederum keiner so feindlich ausgestoßen, aus dem einfachen Grunde, weil bei Ihm alles klar war. Wäre in unserem Herrn eine Mischung gewesen, nur eine ganz kleine Beimischung, nur eine scheinbare Trübung dieser ewigen Klarheit, so würde eine Teilstellung, ein „sowohl als auch“ bei Ihm gegenüber möglich gewesen sein. Lieben aber mit dieser Hingabe, wie Seine Jünger, wie St. Johannes, kann man nur Einen, und das ist ER, weil in Ihm eine solche Fülle von Anziehungskräften ruht, daß der Mensch mit Leib, Seele und Geist, mit sämtlichen Funktionen Seines Seins auf Ihn hinarbeiten muß. Im Gegenteil liegt in Ihm wiederum eine solche Fülle von abwehrenden, unbedingt zurückwerfenden Elementen, daß der Haß gegen Ihn ein dämonischer sein muß. Judas und Johannes. –
Es ist ein und dieselbe Person, diese Fülle von Anziehungskräften, der wir bis zur Stunde erlegen sind, und, so Gott will, erliegen wollen. – Er wurde darum mit solcher Glut geliebt und gehaßt, weil Er die in Sich abgeschlossene Persönlichkeit war, ohne jeden Zusatz von Finsternis, Unwahrheit und Unklarheit. Die Welt ist vermischt, sie ist nicht schlechthin „das Schlechte“; wollte Gott, es wäre so, dann würden wir uns leichter thun; aber das macht uns die Entscheidung manchmal so peinlich, daß wir sagen müssen: „Das ist Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut.“ Sie ist mit Lichtgedanken und Wahrheitselementen durchzogen. Diese Lichtgedanken und Wahrheitselemente sollten wir festhalten und doch nicht mit der Welt paktieren (Verträge schließen). Darin liegt das Geheimnis der Nachfolge Christi. Es ist das sehr einfach, die Welt obenhin schlecht zu nennen, aber es ist eine Lüge. Es ist die Welt eine Mischung, auf der einen Seite mit dämonischem Haß erfüllt, auf der anderen Seite kann sie von Impulsen so fortgetrieben werden, daß sie rufen möchte: „Hosianna, möchte es Ihm gelingen!“ Darin liegt das Wesen der Welt, daß sie, weil selbst widerspruchsvoll, in unser Inneres einen Widerspruch hineintragen will. Der Herr knüpft an die Mischung, an den Widerspruch an und sagt: Entscheide dich für Mich.“ Die Welt knüpft ebenfalls an diesen Widerspruch an und will uns auch zum Siege führen, aber zum Siege des Bösen in uns. Das ist nichts Dogmatisches, sondern etwas unendlich praktisches für unser ganzes Christenleben. Den Feind muß man kennen, der Feind ist die Welt, die Welt aber ist nicht in der Peripherie um uns, sondern central in uns, darum der Trost: In der Welt habt ihr Angst, Bedrängnisse, schwere Qual, werdet ihr in die Enge getrieben, in die Enge der Entscheidung; aber fasset Mut, Ich habe die Welt überwunden. Unser Herr Jesus Christus hat auch das Versuchliche der Welt geschmeckt, bis zur Grenze des für Ihn Möglichen, es ist an Ihn herangetreten in drohender und verlockender Weise, es hat Ihn gefaßt in freundlicher und in feindlicher Weise; Er hat gelernt und uns das Vorbild des Lernens gegeben, Er hat gedient und damit das Beispiel des Dienens eröffnet, Er hat gelitten und damit das Leiden verherrlicht. Er mußte eine Entwickelung durchmachen, nicht prinzipiell, aber praktisch. „Ich habe die Welt überwunden, aus diesem Vermächtnis heraus sehen wir, welche Lasten sich von Seinem Herzen gewälzt haben, als Er überwunden hatte. Er weiß, wie es Ihn nur ein einziges Wort gekostet hätte, um diese Welt zu Seinen Füßen zu sehen. Daß Er dies Wort ungesprochen lassen mußte, aus Gehorsam gegen Seinen Vater, daran hat Er schwer genug getragen; aber „Ich habe überwunden.“ Damit ist auch Ihnen der höchste Trost gegeben. Wir stehen in der Welt, in einer Welt noch nicht, die sich direkt gegen Christum entschieden hat, – so weit sind wir noch lange nicht, – die manch freundlichen Zug aufzuweisen hat und manches Verständnis für Ihn, und eben darum ist uns manchmal sehr bange.
„Mache den Gedanken bange,
Ob das Herz es redlich mein’,
Ob wir treulich an Dir hangen,
Ob wir scheinen oder sein.“
Eigentlich ist es das Allerschwerste, jene Kritik zu üben, die unser Herr Christus verlangt, wenn Er sagt: „Habt Salz bei euch“, das Salz der ätzenden, durchgreifenden Kritik. Wir haben eine unsichere Hand und ein schwankendes Auge. „Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde.“ Diese Festigkeit geschieht durch die Gnade des weltbesiegenden Heilandes, der da spricht: „Ich habe die Welt in euch und um euch überwunden.“ Damit ist klare Bahn gemacht. Alles das, was uns nicht klar sehen, nicht stracks vor uns hingehen läßt, ist Welt, und wenn es im Gewand des Idealen wäre. Wir reden den Idealen das Wort; aber, wie einer gesagt hat: „Der Mensch stirbt an seinen Göttern,“ an seinen Idealen, weil diese Ideale Mischung von Unklarheit und Wahrheit, von Gott-Wohlgefälligem und von Gott-Verwerflichem sind. Da mag es Ihnen bange werden, es soll Ihnen bange werden, denn dazu sind Sie hierher gekommen, daß es Ihnen bange werde. Da seien Sie versichert, wir können nicht Friede rufen, wo kein Friede ist, wir können nicht von Herrlichkeit sagen, wo wir nur Knechtsgestalt schauen. Aber wenn ich im Auftrag meines Herrn Ihnen von der Angst und Bedrängnis sage, dann habe ich auch im Auftrag meines Herrn Mut, Ihnen zu sagen: „Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie in euch auch überwunden.“ Wir haben nur Seinen Sieg auszumünzen für uns selbst. Sein Sieg ist unser Sieg, Sein Leben unser Leben. Was Er vor uns, für uns gethan, das hat Er ein für allemal uns zu gute gehandelt, daß wir sämtliche Aufgaben und Konflikte unseres Lebens Ihm befehlen können. In Seinem Siege sind sie gelöst. Das ist nicht eine Betrachtungsform, sondern das ist so. So sollen wir mit unserem Herrn Christus handeln, daß wir nicht einzelne Züge aus Seinem Leben ziehen, das ist Ihm ein Greuel, nicht einzelne Verhaltungsmaßregeln aus der Schrift ziehen; dann wäre zersplittert, was der Herr ganz haben will. Wir sollen Ihn in Seiner Ganzheit, Abgeschlossenheit auf uns wirken lassen, als den Sieger über alles. Die Schrift erspart uns nicht das eigene Nachdenken, wir sollen nicht einzelne Stichworte suchen, es ist das sehr bequem, aber so beginnt man das, was der Apostel Zerteilung Christi nennt, und das ist Sünde: Christus wird nicht zerteilt. Lassen Sie Ihn in Seiner Ganzheit auf sich wirken, lassen Sie ein solches Leben in sich aufwachen, daß, mit mancher Schwachheit und Sünde, aber doch Er der Regierende in Ihnen ist. Dann brauchen Sie nicht in einzelnen Fällen Ihn zu fragen, dann rät Er Ihnen selbst. Christus in Ihnen ist der einzige Weg zur Welterkenntnis und Selbsterkenntnis. Die Gesamtpersönlichkeit, von der St. Paulus rühmt, daß in ihr verborgen seien alle Schätze, holen Sie und nehmen Sie und brauchen Sie. Er wird nicht arm, und Sie werden dann reich.
Es eröffnet sich Sein Herz im hohepriesterlichen Gebet. Nachdem Er Sich Kapitel 14–16 tröstend, ermahnend, verheißend geäußert hat, geht Er über zum hohepriesterlichen Gebet, welches ebenfalls in drei Teile zerfällt: Erstens für Sich Selbst, zweitens für Seine Jünger, drittens für die gesamte Gemeinde, für die gesamte Kirche. Vers 1–3. Wie der Herr Christus Kapitel 16 Sich Seines Sieges getröstet hat, der für Ihn grundsätzlich allewege feststand, ohne daß Er ihn schon wirklich ganz erfochten hatte, so erscheint im hohepriesterlichen Gebet Ihm schon die Stunde der Verklärung gekommen, obwohl zunächst noch in der Hoffnung. In dem die Welt überwindenden Glauben konnte Er über den Abstand hinüberblicken, wirklich war der Sieg für Ihn erfochten, die Stunde der Verklärung gekommen, obgleich es noch durch tiefe Thale des Todes gehen mußte. „Vater, die Stunde ist hier,“ – ein Wort in seiner Einfachheit, nur aufgenommen von dem letzten Wort: „Vater, in Deine Hände etc.“ Bengel sagt: „Ein Wort, einfach in Buchstaben, aber von dem tiefsten Sohnesbewußtsein durchdrungen.“ „Die Stunde ist hier, daß Du Deinen Sohn im Himmel verklärest, damit Dich Dein Sohn auf Erden verkläre.“ Wie diese Verklärung unser Herr Christus Sich denkt, steht in Vers 5: „Verkläre mich mit der vorweltlichen Klarheit, gieb mir, Mein Vater, die vorweltliche Klarheit, damit ich sie mache zur innerweltlichen.“ Das heißt, wie ich bislang in Leidensform Dich verklärte, so schenke mir jetzt, daß ich in Herrlichkeitsgestalt Dich verkläre, verkläre mit vorweltlicher Klarheit Deinen Sohn, damit Dich Dein Sohn verkläre mit innerweltlicher Klarheit. Was heißt verklären? Gieb Mir die Herrlichkeit, die triumphierende Gestalt, nachdem Ich um der Welt willen die Knechtsgestalt getragen habe, so will Ich, nachdem Ich bislang die Knechtsgestalt der Welt auf mich genommen, ihr nunmehr meine Herrlichkeitsgestalt auf- und einprägen. „Gleichwie Du Ihm Macht gegeben hast,“ „Gleichwie“: nach dem selben Maße, nachdem Du Mir in leidentlicher Beschränkung die Herrschaft über diese Welt gabst, gieb Mir jetzt die Herrschaft über die triumphierende. Wie Du Mir bisher die Möglichkeit gegeben hast, auf dem Wege des Leidens der Welt näher zu kommen, so verkläre mit dem Träger der Vollmacht auch die Aufgabe, zu der Du Vollmacht gegeben hast, verkläre Mein Erlösungswerk. Führe Mein Erlösungswerk heraus aus der Gebundenheit in die Freiheit, aus der Vereinzelung in die Zusammenschließung mit Dir.“ Er hat das Eigenbelieben der ganzen Welt am Kreuz geopfert, Er hat es geopfert im Leidensgehorsam. „Gieb Mir jetzt wieder die Herrlichkeit, die Ich nicht als einen Raub, sondern als ein teures Recht beanspruche, damit Ich ewiges Leben gebe allen, über die Du Mir Macht gegeben hast, Macht der Gnade.“ – Dem gegenüber steht das Wort: „So viele Ihn aufnahmen, denen gab Er Gewalt, Gottes Kinder zu werden.“ – „Allen, die Du Mir zur Beute gegeben hast, will Ich ewiges Leben geben.“ Was ist ewiges Leben im Sinne Jesu? Nun kommen wir wieder auf einen fundamental-praktischen Begriff. Für unseren Herrn Christus giebt es weder ein Diesseits noch ein Jenseits, Ihm leben sie alle, die in den Gräbern sind, und Ihm sind sie alle gestorben. Das ewige Leben hebt für die Seinen an in dem Augenblick, in dem es heißt: „Christus lebet in mir!“ „Auf daß ich ewiges Leben gebe allen, die Du Mir zur Beute gegeben, indem Ich Mich gebe.“ Er ist das ewige Leben. „Du hast Mir die Gnade gegeben, Mich zu geben einer Welt, die sich vereinzelt, verödet. Dem Egoismus der Welt gegenüber hast Du Mir die Gnadenfreiheit geschenkt, das Gegenteil des Egoismus zu sein, Mich auszuströmen in Liebe. Du hast Mir die Gnadenfreiheit geschenkt, Mich auszugeben, auszuströmen in Liebe gegenüber einer liebearmen Welt. „Denn das ist das ewige Leben, daß sie Dich, daß Du allein wahrer Gott bist, und den Du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.“ Das ist das ewige Leben, das schon in der Zeit anhebt, Gestalt gewinnt, daß sie Dich erkennen, den allein wahren Gott, den nur wahren Gott erkennen.“ Das liebende Erkennen ist hier gemeint, „So viel wird Gott erkannt,“ sagt Anselm von Canterbury († 1109), „als Er geliebt wird.“ Das ist eine der Stellen, wo unser Herr Jesus Christus Sich mit Seinem himmlischen Vater unlösbar verbindet, Das ist ewiges Leben (nicht, das führt zum ewigen Leben), daß wir Ihn erkennen, unsern einigen, wahren Gott, durch die Gnade Christi.
Knechtsgestalt und verklärte Gestalt im Christenleben, im Leben der Diakonie. Wenn wir uns rühmen wollen, dann wollen wir unserer Schwachheit uns rühmen, wenn wir etwas preisen wollen, so wollen wir unsere Knechtsgestalt preisen. Unseres Herrn Christi Verklärung hob an von Seiner dienenden Gestalt aus; die Verklärung Seines Werkes kann nicht anders anheben. Nur das ist vor Ihm Dienen, des Namens Dienen wert, was in Seiner Schwachheit und Seiner Schwachheit gedient ist. Alles andere kann jede Arbeiterin, jede Löhnerin ebensogut und noch besser. Was Sie können, das können Sie nur im dienenden Gehorsam, der die Phrase scheut, der zunächst nicht auf die Verklärung, sondern nur aufs Dienen sieht. Es sind in Ihrem bisherigen Leben schwierige Fragen an Sie herangetreten, es wird noch schwerer kommen. Es wird eine Zeit kommen, wo die Welt, nicht der Herr, Ihr Dienen erproben will. Die Zeit ist vielleicht nach dem alten Grundsatz, daß Extrem auf Extrem folgt, nicht allzufern, wo die Welt sich lediglich beobachtend verhält, ob Sie so dienen können, wie unser Herr Christus gedient hat. Es wird eine Zeit kommen, und ich glaube, ich sehe recht, daß sie nicht allzufern ist, wo eine Menge Häuser mit Dienerinnen der sogenannten Barmherzigkeitsübung entstehen werden, die manches weit besser können werden, als Sie, denn sie werden bloß technisch gebildet. Wehe uns, wenn wir bloß technisch ausbilden würden! Die Zeit wird kommen, wo sich die Frage erheben wird zwischen technischer Ausbildung und christlicher Ausbildung. Es wird die Zeit kommen, wo speziell unser Mutterhaus, vielleicht auch mit durch unsere Schuld, von einem Gebiet nach dem anderen verdrängt wird, und man uns nur noch übrig läßt, was die Welt nicht mag. Man wird uns die Schulen nehmen, überhaupt jegliche Kindererziehung, die Krankenpflege zum Teil, man wird uns nur noch übrig lassen den Abschaum der Menschheit, die Pflege der Elendesten, der Idioten, der sittlich Gefallenen, der Krüppel. Da werden wir der Welt ein Schauspiel, ob wir Ihm dienen wollen, Ihm in Seinen Armen und Elenden, und dann wollen wir uns freuen mit unermeßlicher Freude, nicht, weil es uns leicht würde, sondern es wird uns bitter hart und sehr leid sein, dies Scheiden wird durchs Herz gehen, aber mit Ihm können wir es, und sollen wir es und sagen: „Jetzt sehen wir, daß wir Deine Nachfolger sind.“ Ehe der Herr unsere Diakonissensache, die Sache am hiesigen Orte, ehe Er Sie und mich verklären kann, muß Er uns noch weit tiefer ins Leiden hineinführen. Er wird uns nehmen alle liebgewordenen Pläne, Hoffnungen, Arbeitsgebiete – es ist der Herr, Er thue, was Ihm wohlgefällt. Aber aus diesem Beraubtsein heraus kommt das „die Stunde ist da.“ Wann? Wenn das Leiden auf seinen Höhepunkt gekommen, wenn schwere, unerträgliche Lasten, unermeßliche Leiden hereinbrechen, dann ist die Stunde der Verklärung gekommen. Zum Schluß zwei Gebetsworte: Das erste von Melanchthon, das er bei jeder Vorlesung seinen Schülern vorgebetet: Herr, gieb, daß ich möge zeigen, wie so selig Dir zu eigen, mit Dir leiden, mit Dir streiten, Dir einst ewig stehen zur Seiten. – Das zweite aus der Brüdergemeinde: „König, dem wir alle dienen, ob im Ernste, das weißt Du, rette uns durch Dein Versühnen aus der ungewissen Ruh. Mache den Gedanken bange, ob das Herz es redlich mein’, ob wir treulich an Dir hangen, ob wir scheinen oder sei’n.“ Der Schein tötet, denn er hat kein Leben in sich, aber das Sein macht lebendig, denn es ist aus Seinem Sein erflossen. So schenke Ihnen der Herr als erste Frucht des ersten Tages unseres Zusammenseins, die Frage ernstlich zu bewegen, ob das Herz es redlich mein’, ob Sie treulich an Ihm hangen, ob Sie scheinen oder sei’n.
Zeige mir, Herr, ob ich auf verkehrtem Wege bin. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Heilige uns, Herr, in Deiner Wahrheit, Dein Wort ist die Wahrheit.
Treuster Heiland, der Du siehest unsere mannigfache Schwachheit, der Du kennest den Irrtum aller unserer Wege und das Fehlen aller unserer Gedanken, wir bitten Dich, laß leuchten Dein Antlitz, auf daß wir erkennen unsere Sünde, aber noch weit mehr Dich, unsern Erlöser, und in dieser Erkenntnis uns ewiger Friede werde. Amen.
Dritte Stunde. Dienstag Morgen.
O Herr Jesu, treuer Heiland, der Du den Deinen noch eine Ruhe bereitet hast, zu der sie gelangen sollen in Deiner Nachfolge, wir bitten Dich von Herzen, laß uns also Dir nachgehen, daß wir diese heilige und selige Verheißung, einzukommen zu Deiner Ruhe, nicht versäumen, auf daß alle, die wir hier versammelt sind, nicht zurückbleiben, sondern bei Dir ewigen Frieden finden mögen. Amen.
Ich komme auf die praktische Frage von der Wechselwirkung zwischen Leiden und Wirken. Hier wird sich alsbald der Gegensatz geltend machen zwischen Welt und Christentum. Die Welt betrachtet das Leiden als das, was nicht sein soll, sucht infolgedessen alle Mittel und Wege zu ergreifen, um das Leiden fernzuhalten, oder, wenn es da ist, sich über das Leiden hinwegzuhelfen, richtiger hinwegzulügen. Daß der Schmerz milde vorübergeführt werde, das ist ihr größter Zauber. Weil sie den Mann der Schmerzen nicht kennt, so kann sie den Begriff des Leidens nicht tragen, das Leiden selbst ist ihr unsympathisch. Der Christ aber betrachtet das Leiden als das, was sein soll. Wenn die Welt betont, daß das Leiden das Irrationale ist, so betont der Christ: das Leiden soll sein. Ja, die Wurzel, der Grund des Leidens soll nicht sein, die Verfehlung. Nachdem aber einmal durch die Sünde diese Unordnung in die Welt gekommen ist, betrachtet der Christ das Leiden als das Seinsollende, das Notwendiggewordene. Es werden Ihnen für Ihren Beruf ganz gewiß viele Gedanken der Barmherzigkeit kommen, wenn Sie festhalten, daß das Leiden das Seinsollende ist. Der Herr Christus hat ihm durch Sein Leiden die Existenzberechtigung zugesprochen. Wenn das Leiden nicht sein müßte, dann hätte Er nicht gesprochen: „Wer Mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich.“ Wir fassen den Begriff der Leiden zu enge, wenn wir sie nur da suchen, wo eine Störung der leiblichen oder geistlichen Lage sich findet. So gut bei Ihm das Leiden Wirken und das Wirken Leiden ist, so gut bei den Seinen. Bei Seinem Leiden tritt das Wirken in den Hintergrund und umgekehrt. Aber gerade von Seinem Leiden heißt es: Seine Seele hat gearbeitet. Es besteht kein Gegensatz zwischen Arbeit und Leiden, sondern vielmehr ein innerer Konnex, eine Wechselwirkung, es sind Korrelate, Ergänzungsbegriffe. In dem Moment, wo unser Herr auf der Höhe Seines Wirkens steht, hat Er am meisten gelitten. „O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll Ich bei euch sein, wie lange soll Ich Mich mit euch leiden,“ sagt Er auf der Höhe Seiner Arbeit. Nicht die Arbeit, sondern das Leiden betont Er in diesem Falle; so wie Er, sind auch wir in dieser Welt. Jede Arbeit, welche nicht im letzten Grunde ein Leiden ist, arbeitet sich auf und hat keinen Erfolg für den inneren Menschen, und wenn der äußere Erfolg noch so groß wäre; und jedes Leiden, das nicht eine Arbeit ist, stumpft ab und hat auch keinen inneren Erfolg für den Menschen. „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“ – Das ist die Arbeit des Leidens, in der das tiefste Weh beschlossen ist – gearbeitet und nichts gefangen. „Ich dachte, ich brächte meine Tage vergeblich zu.“ In der Arbeit liegt ein verborgener Segen, den man nicht hoch genug schätzen kann. Es soll kein Mensch, am wenigsten eine Dienerin Christi, Ueberfülle von Arbeit beklagen. Es giebt eine Arbeit, in der wir uns so heimisch fühlen, welche die verborgenen Kräfte der Sünde so sehr zurückbannt, daß wir für sie danken müssen, aber in aller Arbeit muß es heißen: „Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gieb Ehre.“ Daß wir unsere besten Kräfte und Erfolge nicht uns, sondern Ihm zuschreiben müssen, darin liegt zunächst etwas Leidentliches; daß wir ganz andere Werturteile über unsere Arbeit bekommen, als sie unser natürlicher Mensch fällt, darin liegt das Leiden. Wir haben etwas erreicht und wir glaubten, etwas Bedeutendes erreicht zu haben, und mit der Zeit wird uns klar: „Es ist nichts gewesen!“ Umgekehrt: daß wir unsere Kräfte einsetzen müssen, unbekümmert um jeden Erfolg, einfach unsere Kraft und Leben darangeben, das ist das Leiden der Arbeit. Auf die Worte: „Herr, haben wir nicht in Deinem Namen große Thaten gethan?“ antwortet Er an jenem Tage: „Ihr habt sie gethan, aber Ich habe euch nicht erkannt.“ Darüber geben Sie sich keinen Illusionen hin. Wenn man nach dem Erfolg das Christenleben beurteilt, so legt man einen falschen Maßstab für dasselbe an. Wer nach den Großthaten den Segen Gottes bemißt, der bemißt ihn falsch. Es muß bei allen unsern Thaten das Leiden die eigentliche Grundbedingung sein; wir arbeiten für eine Sache, die zunächst nicht die unsere ist, sondern die Seine. Das ist das bitterste für den menschlichen Egoismus. Wenn Ihre ganze Berufsarbeit sich so ausgestaltet, daß Sie in allem und jedem, auch im Schwersten und im Schwersten zu meist, da am treusten arbeiten, wo Sie ganz gewiß wissen, menschliche Anerkennung trifft mich nie, dann sind Sie auf der rechten Fährte. Wenn Sie das Beste thun unter solchen Bedingungen und Verhältnissen, daß kein Mensch davon weiß, dann stehen Sie im Leiden, denn Sie haben Ihre Kräfte an Nichtanerkanntes verwendet, und das ist schwer; aber der Vater, der ins Verborgene siehet, wird es Ihnen vergelten öffentlich. Wenn Ihr Leiden in den Vordergrund und das Arbeiten in den Hintergrund tritt, dann ist die Gefahr, daß man nur leidet, daß man sich im Schmerz giebt und dem Schmerz sich hingiebt, den Schmerz nicht als eine erziehliche, sondern als eine erdrückende und abstumpfende Macht ansieht. Wer das thut, der hat den Segen des Leidens sich geraubt, hat umsonst gelitten. Denn dadurch, daß einer leidet, wird er noch nicht gekrönt, ist er noch lange nicht ein Nachfolger Christi, sondern dadurch, daß einer im Leiden arbeitet. Und so oft das Leiden mehr in den Vordergrund tritt, soll es eine Arbeit sein am innern Menschen. Seine Seele hat gearbeitet (im Leiden). So ist auch Ihr Leiden, wenn es im Leben in den Vordergrund tritt, eine Arbeit am inwendigen Menschen, eine innere Entwickelung, eine Gebetsarbeit für das Reich Gottes, eine Arbeit im letzten Grunde für Ihn. Leiden und Arbeiten sind bloß zwei verschiedene Seiten derselben Sache. Das ist Christi Nachfolge, und darauf folgt die Verklärung. Wenn unsere Sache das „Verkläre sie, Vater“ hören soll, so muß sie zuvor durch leidentliche Arbeit und wirksames Leiden hindurchgegangen sein. Die erste Phase hat sie erreicht, das leidentliche Arbeiten. Daß sie das arbeitende Leiden schon erfahren hat, glaube ich nicht. Halten Sie sich diese zwei Frageformen stets gegenwärtig, und Sie werden in viel Thorheit und Schwindel des modernen Christentums unserer Tage nicht willigen. Sie können ein solch kurzatmiges Christentum, wie die innere Mission es oft darstellt, nicht billigen. Das sage ich im Vollbewußtsein des göttlichen Gebotes: „Du sollst kein falsch Zeugnis reden!“ Kurzatmigkeit, Schnellatmigkeit hat das Aufhören des Atmens zur Folge; wo bleibt bei dieser Arbeit der inneren Mission das Leiden? Ist wirklich das zweite Stadium, das des arbeitenden Leidens angebrochen, dann weigern Sie sich desselben nicht. Es kann eine Zeit kommen, sie wird kommen, wo man uns auf die Probe stellen wird über unserer Arbeit im Leiden.
„Du hast Ihm Macht gegeben über alles Fleisch, auf daß Er das ewige Leben gebe allen, die Du Ihm gegeben hast,“ an denen Du Meine Gnade hast wirken lassen. Das ewige Leben hebt für unsern Herrn und Seine Diener schon im Diesseits an. Darin besteht das ewige Leben, daß wir Ihm und Ihn leben. Daß wir Ihm leben, das ist unsere Zeitlichkeit, daß wir Ihn leben, das ist unsere Ewigkeit. „Das ist das ewige Leben, daß sie Dich, wahren Gott, und den Du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.“ Dies ewige Leben sei Ihr Teil, dies ewige Leben soll man Ihnen anmerken. Als Moses vom Berge des Gesetzes herabtrat, leuchtete Sein Angesicht. Das Antlitz eines Ewigkeitsmenschen soll noch weit mehr leuchten, und dieses Leuchten des Angesichts eines Ewigkeitsmenschen, der sich zu hoch fühlt für diese Zeit mit all ihren elenden Plänen, sei Ihr Los. „Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, sie aber suchen viele Künste.“ Und dieses Wort: „Die Ewigkeit ins Herz gelegt,“ ist das einzige Palliativ gegen komplizierte Charaktere, das ist eine Species von Menschen, die im Christenleben nicht existieren sollen. Gott ist ein Gott der Einfachheit, die Komplikation stammt aus dem Willen unseres Fleisches. „Schlecht und recht, das behüte mich, denn ich harre Dein.“ Haben wir die Ewigkeit im Herzen, und beherrscht die Ewigkeit unsere Gedanken, so haben wir ein Ziel im Herzen und vor Augen, und damit hört alle Komplikation auf, denn wir haben nur ein Ziel. „Wem Zeit wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, der ist befreit von allem Streit,“ von aller Komplikation. Wem alle Seins- und Zeitformen nur in die Ewigkeit herüberdeuten, wem die Ewigkeit nichts anderes ist, als eine in die Unermeßlichkeit gesteigerte Seinsform, wer von sich weiß, daß er nicht ein Gehender, sondern ein Bleibender ist, daß er das Recht hat, dem Strom der Zeit sich entgegenzustellen in Christi Kraft, der ist befreit von allen! Streit, weil er ein Ewigkeitsmensch ist. Ich leb schon in der Ewigkeit, weil ich in Ihm lebe, der die Ewigkeit selbst dargestellt hat, weil ich in Jesu lebe, Ihn erkennen heißt Ihn lieben. Darum muß der innere Gebetsumgang mit Gott scharf betont werden. Ich komme hier auf die Frage des Gebetsumgangs mit Christo. (Etliche Schriften zu empfehlen: Monrad, aus der Welt des Gebets, Vortrag von Cremer; Lemme: Gebet des Herrn.) Die Gefahr des Gebets gerade bei Ihnen liegt auf der Hand: Das ‚viele Worte machen‘ und ‚lange Gebete‘ setzt große Kraft voraus, die nicht jeder zu haben braucht und nicht haben muß und kann. Wenn ich die Entscheidung zu treffen habe, welches Gebet das bessere sei, kurz oder lang, so lege ich auf kurz den Nachdruck. Das größte Gebet, das uns unser Herr Christus gelehrt hat, ist ein kurzes. Das bricht der Wahrheit nichts ab: „Betet ohne Unterlaß.“ Ich möchte den Nachdruck darauf legen: bei Jesu bleiben. Sie haben nicht immer die Zeit, in wohlgesetzter, formulierter Rede zu beten, reden Sie frei mit Ihm, wie die lieben Kinder mit dem lieben Vater, nicht auf deutsche Grammatik achtend. Reden Sie Ihm nichts vor, was Sie selbst nicht glauben. Wenn Sie veranlaßt sind, frei zu beten, dann thun Sie es mit Anlehnung an die Worte der Kirche, an das Wort der Schrift, dem Vorgange Ihres Heilandes getreu, der in Seinen letzten Stunden auch Psalmworte betete. Mit großem Ernst betone ich die Kürze des Gebets; das Gebetsleben krankt, wenn es ein Empfinden wird, vor Gott keine künstlichen Reflexionen anstellen! Nicht in den Fehler der Tagebücher verfallen, die reflektieren da, wo sie berichten sollen. Das Gebet sei keusch! Wir haben einen barmherzigen Hohenpriester, darum dürfen wir mit Redefreiheit zu Ihm kommen, aber mit der Redefreiheit, die nichts weiß, als: „Ich bin ein armer, verlorner Mensch, und Du bist mein ewiger Erbarmer.“ Ich bin mißtrauisch, skeptisch, wo ich lange, freie Gebete höre. Anfängern giebt man nicht feste Speise, und wir bleiben schließlich immer nur Anfänger. Das Thema Ihres Gebetslebens sei ein gesundes, normales. Wir müssen unser ganzes Sein eintauchen ins Meer der Ewigkeit, man muß es uns anmerken, um Morgen und am Abend, daß wir ein erfrischendes Bad in Seiner Gnade genommen haben – man muß es unserm ganzen Wandel ansehen, daß wir Menschen des Gebets sind, nicht früh, nicht mittags, nicht abends, sondern allezeit. Dann tritt ein das Hochgefühl des Bürgerrechts im Himmel. Sie dürfen sich nicht verlieren auf dieser armen Erde mit ihren Verzweigungen, sondern sollen Ihren Wandel führen als Bürgerinnen im Himmel, so daß man es Ihnen ansieht: hier sind edle Gestalten, weil von Christo veredelt. Dann können Sie all die schweren Nöten Ihrer Seele, Ihrer Familie, der ganzen Kirche, der ganzen Welt und Zeit in kurzen Worten, aber um so inhaltreicher unserem ewigen Erbarmer vortragen. Wenn Sie nach mühevollem Tagewerk der Schlaf übermannen will, so legen Sie Ihr Herz in ein einziges kurzes Gebetswort und Sie sind geborgen in Ihm.
V. 4: „Ich habe Dich verkläret auf Erden und vollendet das Werk, das Du Mir gegeben hast, daß Ich es thun sollte.“ Ich habe einer knechtsgestaltigen Erde Deine Herrlichkeitsgestalt bereits aufgeprägt, wenn auch nicht äußerlich. Ich habe einem in Sündendienst versunkenen Geschlecht Deine Herrlichkeit und Gottheit wieder gezeigt, einer Welt, die in Zeitlichkeit verloren, den Ewigkeitsgedanken gegeben, der ganzen widergöttlichen Welt einen Stachel ins Herz gedrückt. Ich habe das Werk vollendet, Dich der Menschheit nahezubringen. Indem Ich Mich Dir opferte, habe Ich die Selbstsucht der Welt geopfert. Ich habe hinweggenommen die Sünde der ganzen Christenwelt. Ich habe Dich allein zum Herrn gemacht, und jetzt, weil ich zu Ende bin, jetzt, Mein Herr und Vater, eile zu Ende mit Mir, verkläre Mich, nicht mit einer ungeahnten Herrlichkeit, sondern setze Mich wieder ein in mein Recht, verkläre Mich mit der vorweltlichen Klarheit. Ich habe sie abgelegt, die Knechtsgestalt um Deinetwillen genommen, jetzt gieb Mir wieder zurück, was Mein ist, nachdem Ich Dir gegeben habe, was Dein, nachdem Ich Dir die im Principe erlöste Welt zurückerstattet habe.“
Herr Jesu, Du ewiger Erbarmer, der Du alles vollendet hast, was Dir aufgegeben war, aus Erbarmen mit uns, schau in Gnaden herab auf uns, die Deinen, die der Vollendung entgegenharren und streiten, und darüber klagen müssen, daß Du ihnen noch so ferne bist. Erbarme Dich unserer Schwäche, habe Mitleid mit all unserer Unfertigkeit, Unreife und Armut, und erstatte und erfülle Du gnädig aus Deinem Verdienst, was wir nicht können. Gieb uns Deinen Sieg und verkläre uns mit der Klarheit, die bei Dir und vor Dir ist um Deiner ewigen Liebe willen. Amen.
Sehet, welche Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen.
Vierte Stunde. Dienstag Abend.
O Herr Jesu Christe, der Du von uns allen verlangst, daß wir Dir nachfolgen und verheißen hast, daß Du in dieser Nachfolge uns reichlich wollest Kräfte geben, wir bitten Dich, siehe auf unser Wollen und schenke das Vollbringen, siehe auf unsern Anfang und gieb Du den Fortgang, und sprich endlich zu all unserem Thun Dein segnendes Amen hier in der Zeit und dort in der Ewigkeit um Deines heiligen Namens willen. Amen.
„Verkläret habe Ich Dich auf Erden,“ „vollendet das Werk der Erlösung, einer Neuschöpfung“. Die Erlösung haben wir immer anzusehen als eine Neuschöpfung. Diese Neuschöpfung hat der Herr Christus vollendet, und wie über der ersten Schöpfung das Wort Gottes stund: „Es war alles sehr gut,“ so steht über der neuen: „Es ist vollbracht.“ ER neigt Sein Haupt, das Werk ist vollendet, und dafür, daß Er die Herrlichkeit Seines himmlischen Vaters einer Welt wieder zum Bewußtsein gebracht, die Sein vergessen, verlangt Er als Gegengabe, daß der Vater Ihn verkläre. Daß Er nicht nach eigenem Gutdünken gehandelt, daß Er in Gottes, Seines Vaters Kraft sich abgemüht hat bis zum Tode, das soll die Welt daran erkennen, daß Gott Ihm Seine Herrlichkeit giebt und Ihn so mit Sich Eines Wesens, Einer