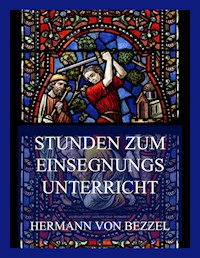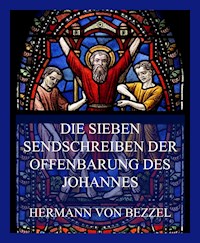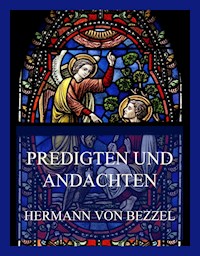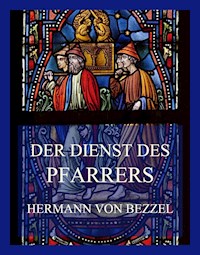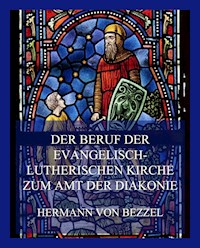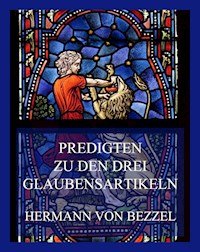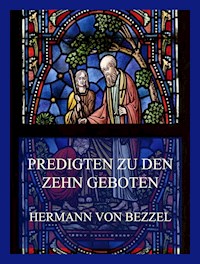
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der 1917 in München verstorbene Hermann von Bezzel war lutherischer Theologe, Rektor der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und Oberkonsistorialpräsident der bayerischen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. In diesem Werk setzt der Autor seine Predigten fort, in denen er versucht, Luthers "Kleinen Katechismus" zu erklären. In über zwanzig Predigten behandelt er die Zehn Gebote.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Predigten zu den Zehn Geboten
HERMANN VON BEZZEL
Predigten zu den Zehn Geboten, H. von Bezzel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662233
Cover Design : Cropped, 27310 Oudenaarde Sint-Walburgakerk 87 by Paul M.R. Maeyaert - 2011 - PMRMaeyaert, Belgium - CC BY-SA.
https://www.europeana.eu/en/item/2058612/PMRMaeyaert_eaa59c4c3340ca0a0e5d1bfdf2aaafc1522cc823
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorbemerkung.1
Vorwort zur 2. Auflage.2
Zur Einführung.3
Erstes Gebot I.9
Erstes Gebot II.14
Zweites Gebot I.21
Zweites Gebot II.28
Zweites Gebot III.36
Drittes Gebot I.44
Drittes Gebot II.52
Drittes Gebot III.60
Viertes Gebot I.68
Viertes Gebot II.77
Viertes Gebot III.87
Fünftes Gebot I.96
Fünftes Gebot II.104
Sechstes Gebot I.112
Sechstes Gebot II.123
Siebentes Gebot I.130
Siebentes Gebot II.138
Achtes Gebot I.146
Achtes Gebot II.152
Neuntes Gebot.160
Zehntes Gebot.167
Schluß der Gebote I.174
Schluß der Gebote II.181
Vorbemerkung.
Der heimgegangene Präsident D. Dr. Hermann von Bezzel, Exzellenz, hat in den wöchentlichen Bibelstunden, die er vom Beginn seines Münchener Aufenthalts an im Betsaal der Diakonissenanstalt in der Arcisstraße zu halten pflegte, im Oktober 1913 den Kleinen Katechismus Luthers zu erklären begonnen. Er war bis zu den ersten Bitten des Hl. Vaterunsers gelangt, als ihm die Todeskrankheit Schweigen auferlegte. Von treuen Händen waren die Predigten nachgeschrieben worden. Nach dem Tode des Präsidenten wurde der dringende Wunsch laut, die Predigten über die vollendeten zwei ersten Hauptstücke durch den Druck zu veröffentlichen. So wurde im Einverständnis mit den Hinterbliebenen die Drucklegung zunächst der Predigten über die zehn Gebote beschlossen.
Dem Unterzeichneten war es eine wehmütige Freude und eine willkommene Dankespflicht gegen den Heimgegangenen, unter dem er früher hat arbeiten dürfen, die Handschrift für den Druck vorzubereiten. Es leitete ihn die Absicht, die Unmittelbarkeit des gesprochenen Wortes, den lebenskräftigen Erdgeruch der frisch gepflügten Scholle, sorgfältig zu schonen selbst auf Kosten der glatten Lesbarkeit. Es war ihm dabei ein lieber Gedanke, daß durch diese Predigten der Entschlafene, dessen Stimme zum Jubiläumsjahr der Reformation man allenthalben schmerzlich vermißt, noch übers Grab herüber zu seinem lieben deutschen Kirchenvolk reden darf von einem der köstlichsten Kleinode der Reformation. Was aber von Herzen kommt, das geht zu Herzen.
Neuendettelsau, September 1917.
Götz, Pfarrer.
Vorwort zur 2. Auflage.
Nach kaum dreiviertel Jahren ist die zweite Auflage nötig. Sie ist ein unveränderter Abdruck der ersten.
Der Eifer, mit dem man nach diesen Predigten griff, der Dank, der für sie dem Entschlafenen noch ins Grab nachgerufen wurde, lassen hoffen, daß die Stimme, die in böser, verwirrender Zeit das erprobte Hausmittel der Väter der Gegenwart anpreist, doch da und dort ein offenes Ohr und ein williges Herz gefunden hat. Denn diese Lektion will nicht nur gelernt, sondern auch geübt sein.
Neuendettelsau, Lichtmeß 1919.
Götz, Pfarrer.
Zur Einführung.
Wie habe ich dein Gesetz so lieb!
Täglich rede ich davon. Ps. 119. 97.
Als wir am 24. Juli nach zweijähriger Betrachtung die Offenbarung des hl. Johannes schlossen, da haben wir einander zugerufen, wir wollten nicht um Jahre rechten und nicht mit Jahrhunderten zählen und feilschen, wenn und weil wir wüßten, daß der Herr Christus gesprochen hat: Ja, Ich komme bald!
Unser Warten ist kein vergebliches und unsere Hoffnung ist nicht Täuschung. Sondern, so gewiß Er einmal in Niedrigkeit kam, um die Welt zu erlösen, so gewiß wird Er einmal in Herrlichkeit wiederkehren, um die Welt zu vollenden.
Dieses „Ich komme bald“ tönt in den Arbeitsmorgen herein, an dem die Aufgabe so schwer und unüberwindbar scheint, und Er selbst erbietet sich uns zur Hilfe und zur Unterstützung. Dieses „Ich komme bald“ tröstet bei der Hitze des Mittags, wenn man fürchten muß zu erlahmen und seufzt zu erliegen, weil gar keine freundliche Kühlung sich zeigen und nirgend ein Baum Schatten bieten will. Da will Er der Schatten über der rechten Hand und die Erquickung auf dem Wege sein; da will Er seinen Frieden schenken und selbst unser Friede werden.
Und wenn es Abend geworden ist, Abend im Arbeitstag, Abend im Arbeitsleben, und wenn die Füße dessen, der uns holt und abruft, schon nahen, dann will Er uns über dem Weh des Unerreichten und über dem Jammer des Versäumten trösten: Ich tilge deine Sünde um meinetwillen und behalte deine Missetat nicht. Siehe, Ich komme bald, nicht als Richter, sondern als Retter; nicht als fordernderHerr, sondern als heilender Priester; nicht um unser ganzes Leben als inhaltsleer zu zerbrechen, sondern um es selbst mit Gnade und Erbarmen zu krönen.
Tröstet euch mit diesem Worte untereinander und ruft es euch fleißig zu und erwidert die einmalige Zusage des Herrn Christus täglich mit dem herzlichen Seufzer: Ja, komme Herr Jesu! Meine Seele hält Dir vor Dein Wort und mein Geist bindet sich an Deine Versprüche.
So lange wir aber noch in der Welt der Sichtbarkeit und Diesseitigkeit wandeln, Er unserer Arbeit geistlich nahe, aber unsichtbar und in der Ferne ist, führen wir unsern Wandel mit Furcht und Zittern.
Und darum habe ich geglaubt, euch einen Dienst zu tun, wenn ich in den nächsten Bibelstunden den kleinen Katechismus auslege, ein großes Werk, äußerlich besehen und innerlich betrachtet.
Wie viele Jahre werden wohl vergehen, bis wir äußerlich mit diesem kleinen Büchlein fertig geworden sind! Und wenn wir es sind, haben wir ihm lange nicht genug getan. Aber da wird jemand sprechen: der Katechismus war das Buch meiner Jugend, mit dem ich reichlich gequält wurde, und nun bietest du es uns in den alten Tagen an. – Und andere sagen: der Katechismus hat wohl für seine Zeit hohe Bedeutung gehabt, aber in dem persönlichen Leben unserer Tage trägt er nichts mehr aus. – Und wieder andere werden sich wundern, daß man diesem Buch noch Geschmack abgewinnen kann, dieser altertümlichen Rede. Und es gefallen sich manche Lehrer des Katechismus, die es sich zur höchsten Ehre schätzen sollten, Lehrende des Katechismus zu sein, in harten, abschätzenden Urteilen über denselben und suchen diese aus dem Golde des Glaubens gemünzten Worte und diese mit dem Herzblut geschriebenen Sätze der Jugend, die ihnen anvertraut, nicht teuer, sondern mißliebig zu machen.
Ich möchte nun ganz kurz heute ein Dreifaches zur Vorbereitung sagen: Der Katechismus ist ein Lehrbuch, ein Bekenntnisbuch und ein Gebetbuch.
Ein Lehrbuch mit der einfachen, gesunden Lehre der Kirche. Es geht durch unsern Katechismus, was wir am allerwenigsten unterschätzen wollen, der ganze Strom der kirchengeschichtlichen Entwicklung. Was Luther gelehrt hat, haben die Väter um das 1. Jahrhundert bereits festgestellt, und die Hauptgrundzüge unseres kleinen Katechismus haben die Kinder von den Missionaren am Schwarzen Meere im 3. Jahrhundert bereits empfangen. Als ums Jahr 600 von Rom aus die Mission, die auch unser Glück begründete, nach England kam, haben die Missionare von dem sie führenden Abte Augustin die einfache Mahnung bekommen, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Gesetz einzupflanzen.
Es ist in unsern Tagen sehr gefährlich, plötzlich aus der Entwicklung der Kirchengeschichte heraustretend eine ganz neue Lehrweise einschlagen zu wollen. Ich fürchte, daß vor lauter Versuchen mit der Kinderseele, vor lauter Versenken in sie, das Eine, was not tut, ihr vorenthalten und der Eine, der sie allein erfüllen soll, ihr ferne gerückt wird. Es ist eine große Sorge, daß man jetzt nicht mehr Lehre geben will, alles soll jetzt Gefühl, Erregung und Erlebnis sein. Aber, liebe Christen, wie kann ich denn etwas erleben, was nicht vorher erlebt ward, wie kann ich etwas erfahren, was nicht vorher geschah! Wie Luther einmal in seinen Tischreden sagt, es sei doch der apostolische Glaube Geschichte aller Geschichte.
So ist es: wir müssen Geschichte lehren, wir müssen Geschichte aufzeigen ohne Zutat und ohne Abstrich und dann dem Geiste Gottes es befehlen, ob er die Einzelseele, das Kindesgemüt, diese Großtaten erleben und erfahren läßt.
Man hat in diesen Tagen ein geheimes Grauen vor allem Lehrmäßigen. „Die finstere Kirche mit ihren Lehrsätzen, die harte, geknechtete Theologie mit ihren Dogmen, diese schwerfällige Rüstung, in der David nie den Riesen bestanden hätte,“ so nennt man die Lehre unserer Kirche. Aber laßt euch nicht beirren; wo keine Lehre ist, da ist auch kein Leben; da kann wohl sehr viel Lebensregung, aber sehr wenig Lebensgehalt wird da sein. Ich habe nie gesehen, daß eine Mutter ihre Tochter in häusliche Verrichtungen einweihte, ohne sie eben das Leben zu lehren, ohne den Hausbrauch dem Kinde festzustellen: so hat’s mich meine Mutter gelehrt, so habe ich’s getrieben und so lehre ich’s dich. Die ganze Lehre einer guten Mutter an ihr Kind wird von der Überlieferung des Hauses aus, durch dieselbe hindurch zum persönlichen Erlebnis führen. Die Mutter wird lehren: so habe ich’s von meiner Mutter gelernt; ich hab’s erprobt im eigenen Leben und es hat sich bewährt; so lehre ich’s dich.
So ist der Katechismus ein Lehrbuch ohne gleichen, das den ganzen Strom der kirchengeschichtlichen Entwicklung hereinnimmt in seinen stolzen Bau. Wie dich vielleicht einst die Mutter an der Hand nahm und dich zum ersten Male in eine große Kirche führte und dich dann ganz dem Eindruck des Überwältigenden überließ. Die hohen Fenster, in denen die Sonne farbig sich brach, die stolzen, himmelanstrebenden Säulen, die vor deinen erstaunten Augen verschwanden, das geheimnisvolle Dunkel in der Kirche – das alles durfte zusammenhelfen, um dich an der Hand der Mutter in der Kirche heimisch zu machen. Es war dir wohl an ihrer Hand. Allein hättest du dich vor dieser großen Weite gefürchtet und das ehrfürchtige Schweigen im Gotteshause hätte dir den Atem benommen. Aber an der Mutterhand und am Mutterherz gewannst du die Kirche lieb. Und so ist es auch innerlich. Der Katechismus führt unshinein in die hl. christliche Kirche, in diesen wundersamen Dom, da Jesus Christus der Eckstein und alle Väter und Apostel, alle Märtyrer und Lehrer, Zeugen und Bekenner nichts anderes sein wollen als Steine in dem Bau, der gen Himmel sich hebt. Der Katechismus zeigt dir, daß nie eine Zeit war, in der die Kirche verlassen gewesen. So wie dir die hl. zehn Gebote ausgelegt werden, so sind sie vor vielen hundert Jahren dem Verstand und dem Herzen, dem Gewissen und der Verantwortung nahe gebracht worden. Und wenn es schlecht und hölzern geschah, so ist das kein Beweis gegen das Buch, sondern gegen die, die es gebrauchten.
So ist der Katechismus auch ein Bekenntnisbuch. Denn ich rede doch nicht zu einer Gemeinde, die sich mit dem Faustischen Trost begnügt: wer kann ihn kennen, wer kann ihn nennen, ich glaube ihm, sondern ich rede mit einer Gemeinde, die die Großtaten Gottes für wahr hält und nicht nur für wahr hält, sondern für wirklich und nicht nur für wirklich, sondern die sich unter diese Großtaten unterschreibt: das ist auch mir zugute geschehen, für mich und meine Sünden ist das alles vollbracht.
Glaubt es mir, ohne Bekenntnis gibt es keine Gemeinde. Wenn einmal das Bekenntnis, wie wir es haben, hinfallen wird, die Zukunftskirche wird ganz bestimmt wieder ein Bekenntnis haben und wenn es das Bekenntnis der Bekenntnislosigkeit ist.
Ein Bekenntnis, ganz bestimmte Grundsätze müssen die Gemeinde einigen, sonst hört sie auf, ehe sie begann, sonst wird ihr Geburts- gleich Todestag. Wenn drei Menschen zusammen kommen in Freundschaft, zu gemeinsamer Lektüre, zu gemeinsamer, tiefer Unterhaltung, so gibt es alsbald einen Brauch, ein ungeschriebenes Gesetz z. B. über pünktliches Kommen, über das deutliche Lesen, über die Wahl der Bücher. Es können nicht drei beisammen bleiben,deren Einer leichte Lektüre wählt, während die beiden Andern ernste Bücher wünschen.
Wenn also schon in äußeren Dingen ganz bestimmte Grundsätze vorhanden sein müssen, wie vielmehr in den höchsten Dingen. So ist der Katechismus ein Bekenntnisbuch, wie Luther 1520 schrieb: einmal zeigt er dir, was du tun und lassen sollst und alsbald wirst du gewahr, wie krank du bist. Zum zweiten wirst du die nötige Arznei in ihm finden und den hl. Arzt, der das vollbringt, was du nicht vollbringen kannst. Und endlich zeigt er dir, wie du die Arznei umsonst bekommen kannst, indem du bei dem Arzte anklopfst und ihn bittest. – Das sind die drei Stücke von alters her: die Gebote sagen uns, was wir tun sollen und zeigen den Sitz unserer Krankheit, unsere Verkehrtheiten des Herzens, die Einseitigkeit unseres Willens, unsere abweichende, von Gott uns lösende Art. Und wenn wir dann in tiefem Leid uns befinden, dann ist uns ein Arzt gegeben, der selber das Leben ist. Und das lehren uns die drei Glaubensartikel in ihrem Zusammenhange, in ihrem „goldenen Zusammenschluß“, und damit wir der hl. Arznei, des hl. Arztes sicher, teilhaftig und froh werden, lehrt uns der Katechismus das Vaterunser. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. So ist der Katechismus ein rechtes Bekenntnisbuch; er bekennt mein Leid, sein Heil und den Weg zu dieser seligen und ewigen Heilung.
Aber, das Höchste ist das nicht, was unsern lutherischen Katechismus, der jetzt mit seinen Vorarbeiten bald ein 400 jähriges Jubiläum feiert, weit über alle Katechismen heraushebt und was ihn so unvergleichlich macht, wie jener Mönch in Venedig, der ihn las und seinen Verfasser nicht kannte, sagte: Selig sind die Hände, die das Buch geschrieben haben, und selig ist die Mutter, die diesen Mann geboren hat.
Was den Katechismus so heraushebt über alle andern Lehr- und Bekenntnisbücher, ist: man kann ihn beten.
Wer sich für solche Fragen innerlich interessiert, der nehme die Zusammenstellung vom seligen Buchrucker (vor 20 Jahren in München verfaßt); er vergleicht die verschiedenen Katechismen der christlichen Kirche, den der katholischen Kirche, den von Peter Canisius, den der griechischen Kirche, den Heidelberger Katechismus von 1563, einen andern von 1551 mit dem lutherischen Katechismus. Wenn ihr diese Zusammenstellung durchblättert und näher studiert – für solche, die Zeit und Interesse dafür haben, eine werte, teure Arbeit – so werdet ihr sagen: unvergleichlich ist doch unser Buch, von dem der große Historiker Leop. von Ranke sagt: „Kindlich und doch so tiefsinnig; dem größten Gelehrten zu groß und dem ärmsten Kinde faßlich“ (Geschichte der Reform.).
Das aber läßt uns wenigstens, die wir seit fast 40 Jahren an diesem Katechismus lehren und in ihm lernen und die wir jetzt in unsern höhern Jahren wieder zu ihm zurückkehren wie Kinder, das läßt uns so fest an ihm halten und so tiefes Gefallen an ihm finden, daß man ihn beten kann.
An wie vielen Krankenbetten habe ich, besonders wenn ich einfache Katechismusleute vor mir hatte, beten können und beten dürfen – ich lege besonderen Ton auf das Wort „dürfen“: „Ich glaube, daß Jesus Christus sei mein Herr usw. usw.“ Und immer wieder habe ich dann bei den Kranken gemerkt, wie das in der Jugend Gelernte und im späteren Leben vielleicht Verschüttete hervorbrach, wie der Quell, der eine Zeitlang im Verborgenen schleicht. Es waren die Klänge der Jugend, es war die Zeit der ersten Liebe.
Und wenn es zum Sterben ging, habe ich manchmal statt der Sterbelitanei mit ihren großen, majestätischen Worten, gebetet: daß dich der Vater im Himmel von allerlei Übel Leibes und der Seele erlöse und jetzt, weil dein Stündlein und dein Ende naht, dir ein seliges Stündleinbeschere und dich mit Gnaden aus diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel.
Seht, dieses Lehr- und Bekenntnisbuch könnt, ja vielmehr sollt ihr beten. Und wenn ihr einmal versucht, das, was euch am klarsten und deutlichsten entgegentritt, im Leben nachzubeten, so werdet ihr mir zustimmen: das sind Klänge aus der Heimat und darum dringen sie in die Heimat.
Ob es mir in diesen wenigen Worten gelungen ist, vielleicht eine oder die andere Seele dazu zu bringen, daß sie unter den mancherlei Büchern, die sie besitzt, den verstaubten kleinen Katechismus wieder hervorholt? Ob eine oder die andere der hier Zuhörenden jetzt wieder die Willigkeit besitzt, immer ein Gebot vorher durchzulesen und sinnend zu betrachten, ehe hier in diesem Gotteshaus die Betrachtung durch mich versucht wird? Ob vielleicht – das wäre allerdings das Höchste – wieder Verteidiger des alten Katechismus und seiner Wahrheit sich erheben, die von „der goldenen Leier, von diesem güldenen Kleinod“ rühmen, daß es wirklich ein großes, reiches Besitztum unserer Kirche ist. Wir haben bei der Offenbarung unwillkürlich mehr von dem Leben der Diesseitigkeit hinüber in das Leben der Vollendungszeit geblickt und das ist eine Gefahr. Man wird heimisch in einer andern Welt und vergißt, daß man an diese Welt noch Pflichten hat. Da wird es wohl gut sein, wenn wir die hl. zehn Gebote mit all den Pflichten, die sie uns auferlegen, nicht in äußerlicher, scholastischer Weise auslegen, sondern daß wir sie in ihrem innersten Gehalte auf uns wirken lassen. Manche sittliche Frage, die jetzt das Herz bewegt, wollen wir dabei besprechen. Und das bleibt ja das Größte:
Sobald wir die Liebe zu Gott haben, haben wir auch das Maß aller Dinge.
Der aber, der nach schwerer dunkler Zeit seiner Kirche den Katechismus gegönnt hat und unsern Martin Luthermit der wundersamen Gabe dieses einzigartigen Geschenkes an uns betraut und befähigt hat, der Gott unserer Väter, der, nachdem im vergangenen Jahrhundert der Katechismus ganz vergessen war und durch andere Katechismen (von Herther oder den von Seiler) verdrängt ward, seit jetzt 60 Jahren ihn wieder in unserer Landeskirche zu Ehren gebracht hat, der Gott unserer Väter, bei dem jetzt Tausende den Dienst des Katechismus rühmen als eines Wegweisers in die Heimat, der ihnen ihren Herrn und den Weg zu Ihm zeigte und pries, der Gott verleihe euch und mir, daß wir wieder Liebe zu dem Buche unserer Jugend bekommen und daß manches Unverstandene oder Übelverstandene von uns weiche und wir auch sprechen mögen, wie wir vorhin lasen: Wie hab ich Dein Gesetz so lieb!
Seht, alles vergeht, das Große und Reiche, alles Schwere und Mühsame und zuletzt bleibt doch nur die eine Frage:
Trägt mein Leben so viel, daß es über die Brücke hinüberreicht, die in die Ewigkeit führt?
Wohl dem, der diese Frage bejahen und sagen kann: Ich weiß an wen ich glaube und Er wird mir meine Beilage aufbewahren bis zu jenem Tage.
Und wohl dem, der dann der Handleiter und Wegweiser, der Bahnbereiter nicht vergißt.
Er verdient es, so sagen wir am Schluß, indem wir unseres Martin Luthers gedenken, daß Du ihn jetzt zu den Heiligen Deines Volkes und zu den Größten Deines Reiches zählst; denn er hat unser Volk lieb gehabt und die Schule hat er uns mit seinem Katechismus erbaut; die christliche Schule, das christliche Haus muß den Katechismus wieder lieben und lehren, dann wird auch die Kirche wieder seiner froh werden.
Amen.
Erstes Gebot I.
Ich bin der Herr, dein Gott!
So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste, und Ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Jes. 44, 6.
Wir sind mit den eben gehörten Worten, den ersten, die wir überhaupt in der Schule gelernt haben, als der erste Religionsunterricht bei uns begann, in das selige Heiligtum der Gewißheit aus all dem Vergänglichen und den Wandelwegen des Ungewissen und Unsicheren, des Vielleicht und des Zweifels wieder heimgekehrt. Wie der Sohn in der Fremde, nachdem er die Gabe des Vaterhauses vergeudet und die letzte Erinnerung an das Vaterhaus und Vaterherz zu verlieren Gefahr lief, noch in der entscheidenden Stunde sich aufmachen und zu seinem Vater gehen wollte, so wollen auch wir, wie uns das Leben geführt und welche Narben es bei uns hinterlassen und was es an Gedankenträgheit und Gedankenarmut und Zerrissenheit bei uns geschaut hat, hinlegen und aufgeben. Und wie wir als Kinder nach wildem, wirrem Spiel uns zur Mutter flüchteten, um an ihrem Herzen zu rasten, so wollen wir wieder nach mühevollem Spiel des Lebenstages und nach der Bitternis des Vielbegonnenen und Wenigerreichten heimkehren und sagen: Laß mich hören Freude und Wonne und nach allem Vielleicht und unter den tausend Etwa die Stimme mich vernehmen, die mich einst so trost- und machtvoll umtönte, die mir die Glockentöne der Heimat näherbrachte, die an Weihnachten mich umglänzte und mitdem ersten Grün der Osterfreude mich begrüßte. Laß mich wieder hören das Wort, Dein Wort: Ich bin!
Wir stehen alle an Gräbern und das letzte Grab, vor dem wir zurückschauern und das immer klarer, schärfer umrissen sich uns auftut, ist das eigene. Wir haben Liebe begraben, die Täuschung war, Vertrauen begraben, das uns betrog und haben Hoffnungen zu Grabe geleitet, deren keine wert war, je unser Herz zu bewegen. Und dann sind die Menschen herangetreten, mit denen wir eine Weile gingen und dann verließen sie uns und fragten nicht mehr darnach und endlich merken wir, es wird ernst, es ist dir gesetzt, Mensch, zu sterben und dann – das Gericht. Diese zwei Gewißheiten bleiben dir von deinem Leben: ein großes, heiliges Ende, das dir dein Gott verordnet, und deine schüchterne Antwort auf Gottes Gebote.
Aber weil wir so vom Scheiden zum Abschied und vom Abschied wieder zum Scheiden gehen, weil über all unsern Festen der leise Hohn Gottes ruht, daß Er die Menschen eine kleine Zeit spielen und sich freuen und sich anfeiern läßt, bis Er dann mit einer einzigen Handbewegung den ganzen Ertrag jählings versenkt, klingt es aus der Tiefe unseres Herzens, das mit tausend ehernen Banden und mit Myriaden seidener Fäden an das Leben gebunden ist, „Laß mich hören Freude und Wonne, sprich mir endlich: Du Meister des Raubes, Du König der Vernichtung, Du Gewaltiger, der alles zerstört, sprich mir endlich von bleibenden Gütern und überragenden Größen!“
Und Er wendet sich zu mir so einfach, wie Er dem armen Knechte erschien, als ihn seine Mutter verbergen und sein Vater verlassen mußte, der in der Wüste keinen Freund und nirgend eine Heimat hatte; und mit dem allerschlichtesten Worte, mit dem Er den armen Hirten draußen in der Einsamkeit der Wüste das ganze Herz erquickte, mit dem Er das brechende Auge seines treuesten Propheten himmlischverneute und stärkte, wendet Er sich an dich und mich und spricht: Ich bin!
Wenn das Kind nächtens durch den Wald eilt – es hat seinen Vater verloren und weiß nur noch das Eine, dieser Wald trennt mich von ihm und einigt mich mit ihm – dann hört es in weiter Ferne, aber es hört doch, die trauteste Stimme: Ich bin es!
So spricht Er zur armen, weltverirrten, weltverlorenen, weltvergessenen Seele, zur Seele, die nur noch ein Verlangen hat: sich auszuweinen und dann scheiden zu gehen: „Sei getrost. Ich bin es!“ Nun dürfen alle Wellen forttragen, was nimmer gehalten werden kann und alle Wogen fortführen, was ich mir halten wollte an Lieb und Treu, an Erinnerung und Güte und Gnade; nun kann alles fallen und ich so arm werden als hätte ich nie etwas gewußt, noch besessen, ja ärmer – denn der ist wohl ärmer, der einst etwas hatte und nun alles enträt –, wenn ich nur Dich weiß, dann weiß ich mir genug; und wenn nur Du bist, dann ist es mir reichlich genug.
Ich bin es! Wenn dieses Wort nicht mehr wäre, was wäre dann dies Leben? Ausstaffierter Flitter, dem man lächelnde Lüge in jedem Zuge ansieht; ernste Miene, hinter der die Torheit wohnt, heiße Mühe, über die Narren lächeln; das ganze Leben ein großes Gaukelspiel; Tropfen des Weltmeeres, die eine kleine Zeit in willkürlicher Eile aneinander sich reihen und eine Welle läßt sie zerstieben. Tropfen des Weltmeeres, in die flüchtig ein höhnender Sonnenblick fällt; das nennt man Glück und – es ist vorüber. Aber Ehre sei dem, der in all dieses unnennbare Weh des Menschenlebens das beste, das gnadenreichste Wort hineingerufen hat: Ich bin es!
Wenn ich am Sarge stand, wo man das Beste von mir nahm und ich wußte nicht, warum gerade jetzt und gerade so dieser schwere, schwarze Strich durch mein Leben undseinen Gang, durch mein Denken und seinen Weg gemacht werden mußte, und es sah alles so unsinnig, so unvernünftig aus, so gar ohne Zweck, so sprach Er: Ich bin es! Und wenn man sich müde gearbeitet hat und der Herr spricht von keinem Worte des Dankes und läßt alles vor den eigenen Augen zerstieben, wie wenn ein Kind achtlos eine Blume zerpflückt, an der dein Herz sich erfreute, wenn du wahrnimmst, daß Gott das Werk deines Lebens und all deine Arbeit, deren Bedeutung du so hoch einschätztest, zur Seite stellt und du wähnen mußt, Er will dich gar nicht mehr; du möchtest aber wenigstens hören, warum Er also tat, dann tröstet sein Wort: Ich bin es.
Ich bin! Bei dem wollen wir zunächst bleiben. Jahre vergehen und die Liebe, die sie uns verhießen, verrinnt und der Ertrag, den wir ihnen gaben, verbleicht und der Erfolg, den sie uns versprochen, vergeht. Aber je einsamer der Lebensweg wird und je rätselvoller das Lebensende sich anläßt, desto trostreicher das Wort: Ich bin!
Also Einer ist es, an den die Vergänglichkeit so wenig hinreichen kann, daß Er sie sendet, damit sie seine Ewigkeit erweise. Einer ist es, an dem der Wechsel der Dinge so wenig Teil hat, daß Er ihn majestätisch herein ins Leben wirft, damit man seine Wandellosigkeit erkennen möge.
Einer, sage ich, ist es, der da Jahrtausende aufeinander – bald in eiliger Folge, bald in langsamem Zuge – folgen läßt, um schließlich, zu dem Menschen der Unkultur wie zum Sohne der höchstgesteigerten Bildung, immer nur das eine Wort zu sagen: Ich bin es! Ich weiß nicht, ob du es schon einmal empfunden hast, was es um die Geschichtlichkeit ist. Wenn man so einsam seine Straße zieht und sieht über sich die sogenannten ewigen Sterne und den Mond in seiner Klarheit und denkt sich: das ist der Stern, der einst meinen Vätern schien und der Mond, der einst einem Hiob glänzte; das sind die Sterne, unter denen mein Heilandim Garten einsam litt und stritt, und das ist der Mond, der da die Erde erleuchtete also, daß man seines heiligen ernsten Leidens Spuren sah. Und derselbe Mond scheint mir und die alten Sterne zeigen auch mir den Weg.
Da wird man erfüllt von einer gewissen Sicherheit, von Ruhe und beständiger Hoffnung. Der da gesprochen hat: „Ich bin es,“ heißt alle, denen die Vergänglichkeit ein Grauen ist und die des Todes Schrecken mit eherner Gewalt anfaßt, zu ihm sich flüchten als zu dem Herrn aller Zeiten und dem Könige aller Vergänglichkeit.
Ich bin der Herr, dein Gott!
Also, Er braucht mich nicht, daß Er vielleicht mit kosendem Worte, weil jetzt seine Anhänger selten werden, nach mir ausblickt, ob ich ihm vielleicht noch mein dürftig, ärmlich Opfer darbrächte. Ist Er vielleicht der Gott, der, weil jetzt die Massen von ihm weggelockt werden, um eine Schar von Frauen und etliche armselige Männer mit gebrochenem Rückgrat wirbt, daß sie wenigstens ihm ihren Dank noch stammeln. So lest ihr es wohl da und dort und so vernehmt ihr es auch: der alte Gott ist opferbedürftig um zu leben.
Doch mit souveräner Gewalt spricht Er: Ich bin der Herr. Nicht, daß du mich hättest gerufen, Jakob, oder daß du um mich gearbeitet hättest, Israel. Mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gesättigt.
Nein, Christen, macht euch von diesem Wahne los, als ob Er in einer Sekunde deiner oder meiner bedurft hätte. Denn Er ist in sich selbst genug, völlig selig, völlig abgeschlossen, ganz in sich reich, ohne daß er irgend einer Sache bedürfte. Denn wenn Er meiner bedürfte und ich käme nicht zu ihm, bliebe Er ja ewig bedürftig.
Christen! Und wenn die ganze Welt und sein ganzes Weltwerk zerscheiterte und keiner heimkäme, seine Seligkeit wäre dadurch nicht getrübt. Sondern, wenn Er spricht:Ich bin der Herr! so will Er uns zeigen, wie Er unsere Bedürftigkeit zu Ihm hin ansieht. Er hat sich in unsere Seele senken müssen, weil der Meister immer einen Zug seines Ichs in jedes Bild legt und kein Meisterbild wäre, das nicht des Meisters allein froh wäre und sein sollte. Als Er dich und mich schuf, hat Er eine einzige Saite in unser Leben gelegt, die nie ganz zur Stille kommt, bis sie wieder von dem gerührt wird, der sie schuf und endlich den Grundakkord anstimmt: Er ist mein Vater!
Siehe, wenn du das wissen darfst, daß Er dich nie vermißt, aber daß Er dich vermissen will, und du daran dich festhalten kannst, daß Er, ohne dich völlig im Frieden, dich in sein Friedensreich hereinnehmen will, dann, o Seele, kannst du des Wortes dich trösten: Ich bin der Herr, der seine Gedanken auswirkt, damit sie zu ihm wiederkehren und seine Worte spricht, damit sie, weit durch die Welt hin geehrt, endlich bei ihm wieder heimfinden. Dann sollst du es gewiß haben: Ich bin der Herr! Also auch mir bereit und gewärtig.
Ich bin der Herr, dein Gott!
Wie viel hat man schon über das Wort Gott zunächst äußerlich, aber auch innerlich betrachtet, geredet. Die einen haben das Wort Gott von einer Wurzel abgeleitet, die bedeutet: verborgen, versteckt, verhüllt. Also: Ich bin der Verborgene, der in einem Lichte wohnt, da niemand zukommen kann. Die andern haben das Wort Gott erklärt: Ich bin der, der von sich aus alles gibt.
Luther hat in seiner praktischen, seelsorgerlichen Weise am schönsten in einer uns noch erhaltenen Predigt über das Wort Gott gesprochen. Es ist das in der Predigt am Laurentiustag, den 10. August 1516, gewesen. Da sagt er: Gott ist der, der dir etwas ist, so daß alles andere dir nichts ist. Ein Kind kann mit diesem Worte zufrieden werden und ein Mann kann an ihm sich erbauen. Gottist der, der dir etwas ist, so daß dir alles andere nichts mehr ist. So soll dir Vater und Mutter, Weib, Mann, Lieb, Treu, Gut, Ehre, Glück und Gunst, alles nichts sein, weil Er dir das Etwas deines Lebens, das Große, das Überwältigende, das, was sage ich, das einzig dein Leben Ausfüllende geworden ist.
Und wenn dir noch etwas außer Gott etwas bedeutet, so bist du eben nicht in Gott. Und wiederum sagt Luther – im großen Katechismus: Gott und höchstes Gut sind innerlich beisammen. Ich bin der Herr, dein höchstes Gut!
Diese kurzen Worte mögen uns heute genug tun. Vielleicht haben sie doch da oder dort eine Frage geweckt: ist Er mir wirklich noch etwas? Oder könnte ich ruhig meine Straße ziehen, wenn Er und weil Er mir nichts ist? Ist Er mir wirklich etwas, nach dem ich verlange von einer Morgenwache bis zur andern? Oder ist Er mir nur ein Begriff, der mich durch Jahre gequält hat? Ein hartknochiger Katechismusunterricht hat mir diesen Begriff eingequält und dann bin ich immer wieder an ihn herangezwängt worden. Ist dieses Etwas so dein Herz ganz erfüllend, wie es am Eingang des großen Katechismus heißt: Gott, Herz und Glaube, die gehören zusammen. Gott, Herz und Glaube! Ist es so bei dir, daß Er dir das Eine geworden ist, für das du lebst, weil du von ihm lebst, an das du denkst, zitternd, manchmal zagend, aber im tiefsten Grunde doch mit der fröhlichen Sicherheit: Er kennt die Seinen. Siehe, das Eine nimm mit in deine Arbeit. Wie klein ist die Welt mit Gott in ihren Ängsten; wie groß ist die Welt mit Gott in ihren Gaben! Wie klein ist die Welt mit all ihren Rechten; wie groß ist die Welt mit all ihren Pflichten!
Wie wird mir der kleinste Dienst so wichtig: Ich bin der Herr, dein Gott! Und wie wird mir das größte Lob der Menschen so kleinlich: Ich bin der Herr, dein Gott. Wiewerde ich immer wieder auf Höhen geführt, da die Nebel und Schwaden des Tages weit zu meinen Füßen langsam zu Sumpf und See niedergehen, während ich Leben atme und Freiheit empfinde!
Darum beten wir aus der ganzen Innerlichkeit der Seele:
Nach Dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe stets auf Dich!
Zu mir Dich neig’, zu mir Dich wend’.
Aus Zion Deine Hilf’ mir send’!
Die Sonnenblum’ sucht ihre Sonn’,
So such’ ich Dich, mein’s Herzens Wonn’.
Und dies nur ist noch mein Begehr,
Daß ich Dir immer näher wär’!
In Gott versinken, aber nicht in Gott vergehen.
Das schenke Er euch und mir aus Gnaden!
Amen.
Erstes Gebot II.
Du sollst keine andern Götter neben mir haben!
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen!
Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben erwählest, und du und dein Same leben mögest, daß ihr den Herrn, euren Gott, liebet, und seiner Stimme gehorchet, und ihm anhanget.
5. Mos. 30, 19, 20.
Das ist das einzige Gewisse in all den Fragen des Lebens, die, je länger das Leben währt, desto peinigendere Ungewißheit in sich schließen, daß Du allein wahrer Gott bist und eher alles, was für die Ewigkeit gebaut und für die Unvergänglichkeit gegründet erscheint, verfällt, ehe Du vergehst und mit Dir Dein heilig Recht. Nehmt es zu Herzen, wenn es heute wieder an euch dringt – es ist kein vergebliches Wort. Das spricht Er zwei- oder dreimal zu einem jeglichen unter uns und dann schweigt Er. Nehmt es zu Herzen, bindet es auf euer Gewissen, nehmt es in die Einsamkeit eures Lebens und in die Lebensbeziehungen, die euch Gott erschlossen hat: Ich bin der Herr dein Gott. Frage dich jeden Tag: was erfüllt mein Herz und was ist der Mittelpunkt meines Denkens und Tuns? An wen denke ich, wenn ich schweige? Wen meine ich, wenn ich rede? Für wen streite ich, wenn ich wirke und wen will ich preisen, wenn mein Mund im Lob übergeht? Woran der Mensch sein Herz hängt und was sein Herz bis in das letzte Versteck ausfüllt: das ist sein Gott. Kann man neben ihm nochandere Götter haben? Neben ihm andere Götter haben heißt ihn verdrängen. Schauet zuerst, wie ihr an Selbstvergötterung leidet. Du armer Mensch! Am sonnigen Tage, da ist es leicht in sich etwas gotthaftes, großes, herzerfüllendes und lebenbeglückendes Gut zu finden und zu sehen. Wenn aber der Mensch sich selber täuscht, sich Versprechungen am Morgen gemacht hat, die der Mittag bereits als unausführbar erweist und die der Abend kläglich darstellt und es sich zeigt, daß man Kraft und Leben versäumt und verträumt – wo ist dann dein Gott? So lange dir die Arbeit vonstatten geht und du immer wieder deinem Ich schmeicheln und es liebkosen darfst, so lange ist es wohl begreiflich, daß du in Selbstvergötterung vergehst. Aber nun wirst du älter und ärmer, die Tage werden schwerer, all die Anfänge reden wider dich, all die Vergangenheit zeugt gegen dich. Und nun willst du außer dir zu jemand fliehen und hast niemand. Wohin du hinauswillst, da steht dein Ich, das dich zuerst anlächelte, und nun starrt es dich an. Sieh, das ist das Ich, das dich umkoste und beschmeichelte und – betrog. Und jetzt steht es da so bettelarm und so trostlos und nennt sich deinen Gott. Und in heller Verzweiflung suchst du den Höheren, aber der ist längst von hinnen gezogen, der will seine Ehre nicht deinem Götzen geben.
Ach, wenn man es doch den Leuten sagen könnte, welch ein Jammer die Selbstvergötterung ist!
Zuerst lauter frohe Gedanken: der Mensch ruht in sich aus; dann lauter aufpeitschende Gedanken: der Mensch wird sie nicht los – da stachelt ihn der Ehrgeiz, da kommt über ihn die Ruhmsucht, da quält ihn die Verletztheit, da findet er sich nicht genug geehrt, geliebt, verstanden – und endlich merkt er: an sich gebunden sein heißt bitteres Sklavenjoch tragen.
Und zur Selbstvergötterung tritt, wenn der Mensch seiner müde geworden ist, als ob er sich selbst des Preisesnicht genug zahlen könnte, so jämmerlich und so kläglich zumal: die Menschenvergötterung. Das Beste an mir habe ich mir selbst weggenommen und nun komme ich mit einem einladenden Lächeln, das nichts anderes ist als versteckte Lächerlichkeit, und werbe um Liebe. Ich habe mir selbst genug gelebt und mit dem dürftigen Rest meines Könnens, Vermögens, Verstehens laufe ich umher und bitte um Menschenhuld.
Es gehört zu den schwersten Dingen, sehen zu müssen, wie ein Mensch, von sich betrogen, bei seiner Umgebung um Götter bittet: sei du mein Gott! Und welche Götter stehen dann auf? Menschen, die ich in der Vollkraft meiner Jahre nicht achtete, umwerbe ich, daß sie die Dürre meines Lebens erhellen. Persönlichkeiten, an denen ich im Stolz der Arbeit vorbeieilte, halte ich auf, ob sie mir nicht huldvoll und geneigt sein wollten. Und so sucht der Mensch von sich selbst betrogen, nicht an seinem Gott emporzuwachsen – dazu ist er nicht mehr fähig – sondern seinen Gott zu sich herabzuziehen.
Wie arm wird der Mensch, der von sich selbst enttäuscht ist! Welch klägliche Ideale hat er dann! Menschenvergötterung! Manchmal sieht und steht man mit Schauder still: was kann dieser Mensch seinem Nächsten geben? Wie konnte der an ihn sich wahl- und willenlos verkaufen? Ach, er hat ihm versprochen, ihn nie zu durchschauen; er hat ihm verheißen, ihn nie zu ermahnen; er hat verzichtet, sein Gewissen zu sein. So werden sie miteinander in die Grube fallen und der Mensch stirbt willig an seinem Gott und sein Gott stirbt mit ihm.
Oder ist es Menschenvergötterung besserer Art, dieser Menschenkultus, wie wir ihn jetzt sehen, wie wir ihn vor 100 Jahren erblickten, als die gebildetsten Deutschen, als ein Goethe und ein Wieland im Staube vor Napoleon lagen? Ist das nicht Menschenvergötterung, wenn man all dasReiche, Große, Geniale, Bedeutsame, zu dem ein Mensch fähig ist, in eine Höhe erhebt, um dann von ihm erdrückt zu werden? Als die Schlacht bei Leipzig das Ende Napoleons heraufführte, wußte Goethe nichts anderes von seinem Abgott zu sagen, als:
Der Mensch erfährt, er sei auch wer er mag,
Ein letztes Glück und einen letzten Tag.
Das sind die Götter, an die der Mensch sich verkauft. Und nun frage sich jeder an seinem Teil, was eigentlich, nicht wer, was eigentlich sein Herz so ganz ausgefüllt hat. Was war es, das dich so erfüllte, daß du ganz beherrscht davon warst? War es das beifällige Lächeln deines Vorgesetzten, um das du warbest? War es dessen Wohlwollen, über das du Gottes Wort und Gebot leicht vergaßest? War es irgend eine Gütigkeit oder Huld eines Kranken, an dessen Lob dir viel lag? Seine Stimme schon durchdrang dich mit zauberhafter Gewalt und eine Freundlichkeit von ihm erhellte dir den Tag. Oder war es in der Stille des Kämmerleins ein immer mehr forttönendes Lobeswort, eine zarte, feine und darum so gefährliche Schmeichelei, die dich berauschte?
Da steht der alte, eherne Gott vom Sinai mit den wie in Erz gegrabenen Zügen. Und dort dieses reiche, weiche, frohe Menschentum und Menschenlächeln. Und doch, was tröstet dich, o Seele, in deiner Todesstunde? Wenn nun alles vergeht und alles dich verläßt, hebt plötzlich aus den Tiefen deines Lebens und den Höhen deiner Ängste eine vertraute Stimme an zu tönen: Fürchte dich nicht; Ich bin der Herr, dein Gott.
Das ist die Stimme, die dir am Morgen den Weg zeigte, die am Mittag um dich treulich klagte, die, als dein Tag sich neigte, lockend dich suchte, die in die Nacht und ihre Schrecken herein, wie ein Vater nach dir treulich ruft:mein Kind, mein Kind, das Ich erlöst habe; Ich bin der Herr, dein Gott!
Wie groß ist es, was einmal Matthias Claudius seinem Sohn schrieb:
Hau deine Götzen mächtig um,
Es sei gleich Ehre, Wollust, Ruhm.
Alles vergehet, Gott aber stehet ohn alles Wanken;
Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund.
Sein Heil und Gnaden die nehmen nicht Schaden,
Heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund.
Denn Du bist der Herr, mein Gott!
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.
Zuerst heißt es du und dann wir. Dazu sagt Augustinus: Siehe, das ist dein Gott, der die Gesamtheit so behandelt, als wäre sie ein Einzelner und den Einzelnen so teuer nimmt, als wäre es seine Gemeinde.
Habe kein Bangen, als ob Er über der Menge dich vergäße, sorge dich nicht, als ob Er dich verließe: Ich bin der Herr, dein Gott.
Wir sollen Gott fürchten.
Luther sagt: Wer nicht fürchtet, der wird nicht demütig, wer nicht demütig wird, der wird nicht schwach; wer nicht schwach wird, der wird nicht erhöht und wer nicht erhöht wird, der kommt nicht heim. Wer nicht fürchtet, der wird nicht gedemütigt. Wenn man mich fragt, was der Grundschaden unserer Zeit ist, so antworte ich ohne Besinnen: sie fürchtet Gott nicht mehr! Die Menge der Selbstmorde, die wir gar nicht mehr achten, die Gedankenlosigkeit, mit der der Mensch sich forttreiben läßt, dieses Tollen und Hasten trägt die Inschrift: Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Es ist, als ob der Tod einherginge und all die großen Narrentänze unserer Zeithöhnend betrachte, und wenn der Tanz zum Letzten aufspielt, dann kehrt er Kronen und Ehren, Freuden und Masken und Rollen all in ein großes Grab. „Sie wollen sich von meinem Geiste nicht mehr strafen lassen.“ Und wie Moses sprach, angesichts der offenen Lustgräber in der Wüste, als die Schlangen ihr verheerendes Werk vollbracht und böse Seuchen durch die Gemeinden hin und her gewütet hatten: Wer glaubt es, daß Du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor solchem Deinem Grimm?
Seht, diese schreckhafte Sicherheit, die genau weiß, daß mit diesem Tode alles zu Ende ist, hat keine verneuende Kraft mehr. Unser Volk hat den Gott seiner Väter zu fürchten vergessen.
Und dann gibt es etliche, die Gott fürchten, weil Er so furchtbar straft. Sie stehen an den Krankenbetten und nehmen wahr, wie Gott durch heimliche Leiden ein Menschenbild zerstört. Sie sehen, wie Er den Verstand auslöscht, wie eine umgedrehte Fackel, und der Mensch dämmert seelenlos dahin Jahr um Jahr, Jahrzehnt auf Jahrzehnt – und sie fürchten sich vor Ihm. Dann sehen sie, wie Gott hohe Namen stürzt – heute glänzen sie und morgen sind sie, wie in Meerestiefen versenkt, ausgelöscht und vergessen – und sie fürchten sich vor ihm.
Wenn aber der Finger Gottes sich wieder zurückzieht, wenn sie, wie die Hl. Schrift sagt, wieder Luft gekriegt haben, dann ist auch diese Furcht wieder dahin. – Wir aber, die wir freilich nicht bloß Knechte sein wollen, bitten mit der ganzen hl. Gemeinde: lehr mich Dich fürchten, daß ich nicht vergehe! Die Angst, daß auf ein mühereiches Leben ein ewiges Verderben folgen möchte, die Schreckensnot, daß eine lange, eine unaussagbar lange Nacht diesem kurzen Tag, genannt Leben, sich anschließen möchte, die Sorge, daß alles, alles in Nichts vergeht, ohne doch ins Nichts zu versinken, diese Sorge vergällt den Bissen, denman ißt, und jagt die Schatten übers Licht, dessen man sich freut, und wirft alle Lust um, die man sich erlaubt, und über dem Leben stehen die schwarzen mächtigen Wolken und eine Stimme ruft: über ein Kleines, so wirst du auch darankommen.
Schämt euch der Furcht nicht, ihr Christen! Es ist eine knechtische Furcht, aber es ist eine Furcht, die den Menschen wieder auf die Bahn der Gottesnachfolge zwingt. Schämt euch dieser furchtbaren Gedanken nicht, daß der Richter vor der Türe steht mit dem verzehrenden Feuerblick, vor dem nichts bestehen kann! Und heiliget euch vor Ihm in Furcht und Zittern!
In euren jungen Tagen komme die Angst, daß ihr über dies alles müßt Gott Rede stehen. In den Mittag des Lebens komme die Not: weh mir, ich habe noch wenig Jahre und dann ist alles vorüber. Und am Abend stehe die blasse Sorge: was werde ich heimbringen, wenn nun dieses Leben vergeht?
Es ist noch nicht das Höchste, aber es liegt in dieser knechtischen Furcht so viel Schreck und Not und Angst, daß man wieder beten lernt: willst Du nicht, die wir durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein müssen, uns erlösen!
Wer mit der Kindesfurcht anfängt, der wird nicht fromm; denn Kindesfurcht entnervt, verweichlicht, verflacht. Und wer immer mit der Erlösung sich tröstet, der kommt nicht heim. Wir müssen zuvor die Höllenfahrt antreten, ehe wir das Kreuz umfassen und sagen dürfen: rede durch Dein Stillschweigen, liebster Jesu, mir das Wort! Wir sollen Gott fürchten im Schrecken seiner Gerichte, in der Angst seiner Strafen, in der Furchtbarkeit der Einsamkeit, bis wir wieder den Saum seines Kleides anrühren dürfen: Du hast doch eine große Tat getan, daß wir uns nicht noch einmal fürchten müssen. Du hast einen kindlichenGeist in unser Herz gesenkt, daß wir aus Schreck und Angst rufen dürfen: Abba, lieber Vater! Und in unsere Todesnacht, die täglich sich wiederholen muß, kommt diese Nacht von Gethsemane, da Einer Tränen und blutigen Schweiß vergoß – schwer, bang, gottverlassen, allein, gottverloren – bis der Vater zu ihm sagte: es ist alles wohlgetan, mein Sohn; um Deinetwillen sei es vergeben!
Ich habe wohl gesonnen, wie man diese fröhliche, kindliche Gottesfurcht, dieses selige Ruhen in dem hl. Gott ohne Christi Leiden haben könnte. Ich habe es nie ersonnen und nie gelernt und werde es auch nie lernen. Das aber habe ich gelernt, daß, wenn alles mich verklagte, Einer zu mir trat und sprach: Ich habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht aufhöre.
Ich weiß wohl, man sagt es auch jetzt immer wieder und ihr hört es gern, es legt sich nicht so schwer aufs Gemüt: man kann in Gott immer den liebenden Vater sehen. – Nein, das kann man nicht. Man muß immer wieder seine Schrecken gewahren bis endlich die Angst uns dem zur Seite stellt, der die Welt überwunden hat.
So in kindlicher Furcht über alle Dinge wollen wir ihm nahen, wir wollen uns scheuen, daß wir ihn verletzen, wie ein Kind den Atem verhält, daß der Vater nicht zürnt. Wir wollen die Minuten zählen, die uns noch von ihm trennen, und bei jeder neuen Wendung des Weges unserer Seele zurufen: siehe, Er kommt bald! Wir wollen in hl. Scheu vor der Sünde uns hüten, nicht um ihrer schreckhaften Folgen willen, sondern weil sie den betrübt, der so viel für uns getan hat.
Und den wollen wir lieben, lieben, wie ein armes, unscheinbares Grüblein das Weltmeer in sich aufnehmen möchte, wie das Auge trunken die herbstliche Landschaft in sich einschließen wollte, wie diese arme Brust einmal aus tiefstem Grunde, ehe die Sonne scheidet, noch einmalSonnenwärme in sich aufnehmen möchte. Wir wollen ihn lieben. Er hat uns erst geliebet, alle Gedanken uns zugewendet, alle Worte für uns ersonnen, alle Wege uns geebnet, alle Werke, von Anbeginn der Welt, für uns bereitet, seines einigen Sohnes nicht verschonet um unseretwillen.
Wir wollen ihn lieben, weil Er so viel an uns getan hat. Und wie die Blume gern am Wege blüht, nur damit sie noch einmal den Tau des Himmels koste und den Strahl der Himmelssonne in sich aufnehme, so wollen wir auch seitab, wenn es sein muß, oder am Wege im Sonnenlicht vollenden, nur, daß wir ihn lieben.
Auf dem Grabe jenes großen, so weltweiten und doch dem Kreuze so nahe verbundenen Engländers stehen die Worte: Wir sind geliebt worden, wir werden geliebt, wir lieben.
Wir sind geliebt worden und ahnen gar nicht, in welche Tiefen seiner Liebe hinein Er uns versenkt.
Wir werden geliebt, gesucht, umworben; nach uns fragt Er, um uns sorgt Er, so wollen auch wir ihm Liebe erweisen. Und endlich
ihm über alle Dingen vertrauen.
Der Mensch muß, damit er nicht an sich selbst verzweifle, hoffen. Er muß hoffen, daß hinter den Wolken die Sterne und über dem Tod das Leben und über der großen, verderblichen Fläche des „Nein“ ein lebensreiches „Ja“ stehen wird. Wir wollen ihm von ganzem Herzen unser Hoffen zusenden: betrüge mich nicht und täusche mein Vertrauen nicht. Es ist eine schwache Hand, die die Deine sucht, unsicher tastet sie nach Deinen Verheißungen. Du wollest sie nicht verschmähen, noch zurückstoßen!
So, meine Christen, hat der Herr im ersten Gebot uns sein Herz erschlossen, wie ein großes, weites Meer, das immer mächtigere Kreise zieht, hat Er zu uns gesagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Dir gehört mein Herz und auf dich ist es gerichtet.
Und wir antworten: Dir bringe ich mein Herz zum Opfer. Ich habe nichts, was Du mir nicht gegeben hättest; ich kenne nichts, was nicht von Dir wäre. Aber über Eines hast Du mir das Recht gegeben: ich kann es Dir vorenthalten. Aber ich will es Dir schenken. Ich kann Dir mein Herz verweigern und darüber sterben; doch ich bringe es Dir zum Opfer.
Nimm, ach nimm doch freundlich an,
Was ich, Armer, schenken kann!
Ein enttäuschtes, ein enttäuscht habendes, ein leer gewordenes, viel betrogenes, oft verzagtes, öfter noch entmutigtes Herz habe ich vielen angeboten, alle haben es zurückgewiesen. Nun komme ich zum Letzten, zu Dir, der Du gesagt hast: Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, Ich will dich erquicken!
Dir gebe ich mein Herz zum Opfer; nimm es, bewahre es und verneue es aus Gnaden!
Amen.
Zweites Gebot I.
Du sollst den Namen deines Gottes nicht mißbrauchen!
Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken.
Der Herr erhöre dich in der Not, der Name des Gottes Jakobs schütze dich! Ps. 20, 2.
Seit 1400 Jahren feiert die Kirche den Advent des Herrn. Am ersten Sonntag gedenkt sie der Niedrigkeit seiner Ankunft, da Er arm und gering denen sich naht, die aus der Armut erlöst werden wollen. Am zweiten Advent sieht sie hoffend auf die Zukunft hinaus, da Er prächtig und mächtig wiederkommen wird, zum Schrecken der Feinde und zum Troste der Seinen. Am dritten Adventsonntag denkt sie daran, wie Er jetzt noch täglich zu uns kommt in Wort und Sakrament. Und am vierten faßt sie die dreifache Zukunft, die einstige, die jetzige und die ewige, in den Lobpreis dessen, der vor der Türe steht, anbetend zusammen.
Wir wünschen einander, daß diese Vorbereitungszeit, welche ein Abbild der großen Vorbereitungen auf den Eintritt des Herrn Jesus in unser Leben sein soll, reichen Gewinn bringe, daß die Erdensorgen verschwinden und die Ewigkeitssorgen hervortreten mögen. Wir bitten Gott, daß Er uns an Jesus Genüge haben lasse und uns erfülle mit der Freude in ihm. Wir versprechen dem Herrn, daß wir, so viel an uns ist, ihm in unseren Herzen Raum und Wohnungmachen, damit Er bei uns einkehre und unser Leben erfülle, unsere Sehnsucht stille und unserm Heimweh die Gewißheit der Erhörung gebe.