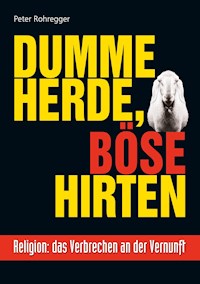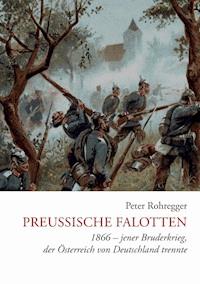
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der geschichtlichen Erinnerung ist der "Deutsche Krieg" von 1866 kaum präsent. Doch die Ereignisse jener "heißen" Jahresmitte verdienen auch heute die besondere Aufmerksamkeit, denn immerhin wurden damals die Machtverhältnisse in der Mitte Europas markant verschoben: Österreich verlor seine führende Position in Deutschland und wurde zur Mittelmacht degradiert - Preußen konnte das weite deutsche Land mit seinen vielen Einzelstaaten nun nach seinen Vorstellungen formen und auf die Zukunft innerhalb eines neuen deutschen Kaiserreiches unter seiner Führung einstimmen. Über die militärischen und politischen Vorgänge in jenen Wochen des deutschen "Bruderzwistes" konnte sich die kriegsbegeisterte Bevölkerung durch ein erstaunlich vielfältiges Zeitungsangebot relativ rasch und umfassend informieren. Die vom Tiroler Historiker Peter Rohregger ausgewählten Zeitungsartikel und Zeitzeugenberichte aus dem Kriegssommer 1866 ermöglichen einen sehr eindringlichen Blick auf das damalige Geschehen und zeigen die vorhandenen Feindbilder sowie die Kampfmentalität der Presse und ihrer Leserschaft in direktester Form.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Österreich ist nun einmal Deutschlands Haupt.«
Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV.
INHALT
Prolog
Habsburgs Adler über Deutschland
Der preußische Emporkömmling
Die dreisten Dänen
Trügerische Herzlichkeiten in der Salzachstadt
Bismarck drängt dem Krieg entgegen
Holstein – der Zündfunke im Pulverfass
Tod dem welschen Erzfeind
Die papierene 800.000-Mann-Armee
Spione im ganzen Land
Akkurater Truppenaufmarsch
Mit der Preußenhymne ins Böhmische hinein
Getrennt marschieren, vereint schlagen
Wilhelms Wunderwaffe
Trügerische Siegesträume
Hiobsbotschaften für den Kaiser
Mehr als 400.000 Gewehre vor Königgrätz
Ein Übermaß an Tapferkeit
Hauen und Stechen im Horrorwald
Österreichs Waterloo zwischen Bistritz und Elbe
Schauriger Ritt über das große Totenfeld
Freimütige Überlegungen eines Kriegsreporters
Preußische Ulanen gegen kaiserliche Husaren
Durchhalteparolen der Zeitungspresse
Kulturschock in Böhmen und Mähren
Am Main und an der Adria
Das letzte preußisch-österreichische Gefecht
Grimmiger Wilhelm, bedachtsamer Bismarck
Berlin feiert die heimkehrenden Helden
Heimatlos in der Vielvölkermonarchie
»Reicht die Hände euch, Germanen …«
Das große Vergessen
Zeitungsmeldungen aus dem Kriegssommer 1866
Anhang
Zeittafel
Was ist des Deutschen Vaterland?
Bibliographie
Ein Brief über die Schlacht bei Königgrätz
Die Rechtschreibung im 19. Jahrhundert unterscheidet sich zur heutigen Schreibgewohnheit relativ deutlich. Um die Originalität der für dieses Buch ausgewählten Zeitungstexte möglichst weitgehend zu bewahren, wurden nur geringfügige Textkorrekturen vorgenommen: Das »ß« ist gegen das heute gebräuchliche »ss« ausgetauscht, und das damals in vielen Hauptwörtern eingeschobene »h« (Beispiel: Abtheilungen anstatt Abteilungen) ist aus allen entsprechenden Wörtern entfernt (mit Ausnahme des Briefes am Ende dieses Buches). Ansonsten wurden die Zeitungstexte von 1866 in der Originalform übernommen.
PROLOG
Unter dem Sammeltitel »Österreichs Kämpfe im Jahre 1866« gab das »Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte« in den Jahren von 1867 bis 1869 insgesamt fünf Bände heraus, in denen die kriegerischen Ereignisse des Sommers 1866 auf der Grundlage der »Feldacten« akribisch genau dokumentiert sind. Mit den einleitenden Worten des ersten Bandes ist es den Autoren bemerkenswert gut gelungen, sowohl die machtpolitischen Grundlagen als auch die Folgen des blutigen Konfliktes in bündiger Form sehr trefflich zu beschreiben. Die Worte von damals vermitteln eine Ahnung von Österreichs einstiger Stellung in Deutschland. Deshalb soll dieses Buch mit dem Vorwort des »Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte« aus dem Jahr 1867 beginnen:
»Das Jahr 1866 hat mitten im Herzen Europas einen Kampf entstehen sehen, von dessen Erschütterungen heute und wohl für lange Zeit noch der gesamte Kontinent vibriert.
Zwei große Staaten, das eben entstandene Italien und das nach größerer Macht und der Führerschaft in Deutschland strebende Preußen, griffen, unter sich verbündet, den Kaiserstaat Österreich, diesen beständigen Verfechter des vertragsmäßigen Rechtes, im Süd und Nord seiner Grenzen an.
Der Kampf war ein ungleicher, und die Würfel fielen zum Nachteile Österreichs.
Einer der glänzendsten Feldzüge der kaiserlichen Waffen gegen dreifache Übermacht im Süden – der Sieg bei Custoza und die große See-Tat bei Lissa – gingen spurlos unter in dem Missgeschicke, dem Österreichs Heer im Norden erlag.
Die beiden Gegner des Kaiserstaates haben ihre Ziele erreicht. Der kaiserliche Soldat steht nicht mehr auf italischem Boden, den er in hundertfältigen Kämpfen zum Ruhme und zur Größe des deutschen Namens errungen hatte.
Im Norden ist mancher deutsche Thron gefallen, manches bisher selbständige Staatsleben vernichtet; der deutsche Bund liegt zertrümmert; Österreich steht in keinem politischen Zusammenhange mehr mit dem deutschen Wesen, und die Krone Preußens, bereichert durch die schleswig-holsteinischen, hannover’schen, kurhessischen, nassauischen Lande und andere ehemals freie Gebiete, hat nun die Führerschaft und auch die Verantwortlichkeit für die weiteren Geschicke Deutschlands allein übernommen.
Die Zeit wird lehren, was von den neuen Verhältnissen gesund und lebensfähig ist und was nicht; – sie wird erweisen, ob Deutschland ohne Österreich, das durch Jahrhunderte sein bestes Blut und seinen ganzen Wohlstand für Deutschlands Größe und Unabhängigkeit geopfert hat, stark genug sei, sich inmitten der europäischen Staatengesellschaften zu konsolidieren und zu erhalten; – die Zeit endlich wird zeigen, ob das große deutsche Volk jener strammen Zentralisation fähig ist, der es unterworfen werden soll.
Wie dem nun sei, Österreich wird in der Zukunft frei und unabhängig, mit seiner ganzen ungeteilten Kraft da eintreten können, wo es sein eigenstes Interesse erheischt, und das Heer Österreichs wird sich dabei – nach wie vor – seiner großen Aufgabe bewusst bleiben.«
HABSBURGS ADLERÜBER DEUTSCHLAND
Von den Süddeutschen, also von den Österreichern, Bayern, Württembergern, Badenern, Hessen, Pfälzern und auch den Sachsen, wurde im Schicksalsjahr 1866 angezweifelt, ob die Preußen überhaupt »richtige« Deutsche sind, denn sie benahmen sich in deren Augen niederträchtig und undeutsch, indem sie gegen das »wahre« und ehrliche Deutschland, bestehend aus den vorgenannten Ländern (sowie Hannover, Schleswig-Holstein und noch andere Territorien), hetzten und drohten und schließlich jenen »Bruderkrieg« provozierten, der in die größte Schlacht des 19. Jahrhunderts mündete.
Propagandistisch blieben sich die Gegenseiten nichts schuldig. Ein nicht geringer Teil der österreichischen Presse gefiel sich darin, die Preußen als »undeutsche Falotten« verbal zu prügeln. Die »Innsbrucker Nachrichten« waren sich schon am 28. Mai 1866 mit einer Frankfurter Zeitung einig, dass große Gebietsteile Preußens unter dessen Nachbarn aufgeteilt werden sollten und dass die Bevölkerung »Kernpreußens« kaum den Gattungsbegriff »Deutsche« verdient. Eine Blutauffrischung durch »richtige« Deutsche wäre also das Gebot der Stunde: »Die Familie Hohenzollern behält ein Gebiet von etwa 4 bis 5 Millionen Einwohner; da aber diese aus germanisierten Slawen bestehen und ganz eigentlich jenen preußischen Kartoffelschnapsgeist erzeugen, welcher als innerer Düppel und Fusel die Großmachtgelüste und das Berlinertum hervorbringe, so werden zwanzig Jahre lang Truppen der rein deutschen Staaten: österreichische Kaiserjäger, baierische Kürassiere und Chevauxlegers, württembergische Ulanen, hessisches und kurhessisches Militär in der Mark Brandenburg einquartiert, damit dort die Rasse gekreuzt und eine neue Generation erzeugt werde.«
Die Gegenseite blieb den Lästerern aber auch nichts schuldig. Der preußische Ministerpräsident Graf Otto von Bismarck ließ keine Gelegenheit aus, um von den Österreichern abfällig als »slawisches Mischvolk« zu sprechen, und Herr v. Usedom, der preußische Gesandte in Italien, verstieg sich vor einer gegen Österreich pöbelnden Volksmenge in Florenz zu der mit großem Beifall bedachten Behauptung: »Der wahre und einzige Vertreter Deutschlands ist Preußen, die Österreicher sind Bastard-Deutsche.«
»Es blutete der Brüder Herz, ganz Deutschland, ach, in Schmach und Schmerz« – diese Zeilen aus der Tiroler Landeshymne wären auch der Stimmung der Deutschen Nation in den Kriegswochen des Sommers 1866 gerecht geworden. Der vom Vogtländer Julius Mosen 1831 verfasste Text dieser Hymne bezieht sich allerdings auf die Exekution des Tiroler Volkshelden Andreas Hofer im Jahr 1810. Als der Dichter und Schriftsteller Julius Mosen (bis 1844 Moses) an diesem Text feilte, setzte sich das Deutschland des mit der »Bundesakte« am 8. Juni 1815 (Wiener Kongress) gegründeten »Deutschen Bundes« aus den Territorien von 35 souveränen und gleichberechtigten Potentaten sowie vier freien Städten zusammen. Teile der Staatsgebiete Österreichs und Preußens, den zwei größten deutschen Mächten, befanden sich außerhalb des Bundesgebietes, wie etwa Ostpreußen, Galizien, Ungarn, Dalmatien, u. a.
Im Jahr 1865 lebten an die 48 Millionen Menschen innerhalb der Grenzen des Bundes, der sich mehr oder weniger als Erbberechtigter des 1806 unter dem Druck Napoleons verblichenen »Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« verstand. Dem »Deutschen Bund« gehörten kleinste Herrschaften an, wie etwa die Fürstentümer Lippe und Waldeck, die Königreiche Sachsen, Bayern, Württemberg und Hannover zählten zu den »Mittelstaaten«, Österreich und Preußen waren die »Großmächte« innerhalb dieses Bundes, dessen Gremium, die »Bundesversammlung«, seinen Sitz in Frankfurt am Main hatte.
Mit der Wahl des Habsburgers Rudolf I. zum deutschen König am 1. Oktober 1273 begann die lange Reihe der deutschen Könige und Kaiser aus dem österreichischen Haus Habsburg. Jahrhunderte lang (mit wenigen Unterbrechungen) befand sich das Machtzentrum Deutschlands in der Person des Königs und Kaisers nun in Wien (zeitweilig im böhmisch-österreichischen Prag) und unter Maximilian I. auch in Innsbruck. Vor diesem Hintergrund einer Epochen überdauernden machtpolitischen Tradition war es für die fürstlichen und königlichen Herrscher der einzelnen deutschen Staaten nahezu selbstverständlich, dass Österreich auch im »Deutschen Bund« den Vorsitz führte und der Kaiser in Wien (mit Unterbrechung während der Revolutionsjahre 1848/49) als das eigentliche Oberhaupt Deutschlands angesehen wurde.
Nur der »Emporkömmling« Preußen neidete dem Kaiserstaat Österreich seine starke Position in Deutschland. Ab dem Zeitpunkt, als der konservative Landjunker Graf Bismarck von König Wilhelm I. am 24. September 1862 zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, bekam die Rivalität zwischen den beiden großen deutschen Staaten eine neue Qualität und unheilschwangere Dynamik. Der Respekt vor dem höherrangigen Kaiser in Wien und vor der Jahrhunderte alten »deutschen Sendung« Österreichs, den der Preußenkönig trotz aller Rivalität immer noch besaß, bedeutete Bismarck absolut gar nichts. Er wollte Preußen auf Biegen und Brechen an der Spitze Deutschlands sehen, und deshalb gab es kein Wenn und Aber für ihn: Österreich musste aus Deutschland raus. Ganz nach machiavellistischer Manier waren zur Erreichung dieses Zieles alle Mittel heilig. Sehr bald sprach Bismarck vom notwendigen Krieg gegen die nachbarliche Monarchie. Dass eine »heiße« Konfliktaustragung auch die meisten anderen deutschen Staaten involvieren würde, das passte in das Kalkül des »eisernen Kanzlers« (in Österreich und in den anderen süddeutschen Staaten bald auch »Blutkanzler« genannt), denn seine Absicht der »Neuordnung« Deutschlands würde ja alle betreffen. Die erforderliche Gewalt zur Umsetzung dieses Zieles nahm der Gutsherr und ehemalige Deichgraf aus der Altmark billigend in Kauf. Otto von Bismarck spielte oft und gerne mit dem Wort »Deutschland« herum. Seine Gegner wie auch seine Bewunderer waren sich jedoch in dem einen Punkt einig, dass alles Denken und Handeln des Ministerpräsidenten (und späteren Reichskanzlers) einzig und allein auf die Machterweiterung, Größe und Herrlichkeit Preußens gerichtet war. Entgegen den Argumentationen der späteren nationalen Heiligsprechung Bismarcks war dieser kein »deutscher«, sondern ein »preußischer« Patriot. Erst wenn Österreich empfindlich geschwächt sei, wird der andere Teil Deutschlands vor Preußen kuschen und sich dessen Machtanspruch fügen – so die zutreffende Analyse des altmärkischen Junkers.
Aus österreichischer Sicht galt Preußen schon lange als undankbarer Emporkömmling. Es blieb unvergessen, dass im »Türkenjahr« 1683 aus Berlin keine Waffenhilfe kam, als die osmanischen Heerscharen vor den Mauern Wiens standen und nicht nur diese Stadt, sondern das Deutsche Reich insgesamt massivst gefährdet war, zur Beute des »türkischen Blutegels« zu werden. Der als Habsburger in Wien residierende deutsche Kaiser Leopold I. (der während der Türkenbelagerung nach Passau flüchtete) hatte den Eroberungswillen des Osmanenherrschers Mohammed IV. zu spät erkannt. Seine politische und militärische Energie war während seiner langen Amtszeit meist durch Frankreich und dessen landhungrigen König Ludwig XIV. gebunden, der im Westen des Reiches Stück für Stück deutschen Bodens raubte (u. a. Straßburg im Jahr 1681).
Nicht wenige deutsche Regenten, wie etwa die erzbischöflichen Kurfürsten des Rheinlandes sowie auch Friedrich Wilhelm von Brandenburg, gefielen sich darin, mit Ludwig XIV. (laut Titel der »allerchristlichste König«) gemeinsame Sache gegen den Habsburger Leopold zu machen und verkannten oder ignorierten dabei die Gefahr, die im Frühjahr 1683 vom Balkan herauf vorrückte. Der französische König zeigte keine Scheu, sich mit den »Knechten des Teufels« (so Martin Luthers Charakterisierung der Türken 154 Jahre vor der zweiten Belagerung Wiens) gegen Österreich und somit gegen das Deutsche Reich zu solidarisieren.
Es waren schließlich die Sachsen, die Bayern, sowie Reichstruppen des fränkischen und schwäbischen Kreises, die sich gemeinsam mit polnischen Truppen daran beteiligten, die symbolträchtige Donaustadt aus den Klauen des Erbfeindes der Christenheit zu befreien.
Dass man in Berlin untätig blieb und der brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm auf seine »Liebesdienerei« gegenüber dem österreichfeindlichen Frankreich nicht verzichten wollte, als 150.000 muslimische Streiter auf österreichischem Territorium und somit auf dem Boden des Deutschen Reiches vorrückten, dieser »Verrat« blieb in Wien – wie vorhin bemerkt – auch nahezu zwei Jahrhunderte später noch unvergessen.
Knapp 20 Jahre nach der »Türkensache« zeigte man sich in Berlin gewogen, den Kaiser zumindest in einer anderen Sache zu unterstützen – allerdings nicht uneigennützig. Seit 1697 war August der Starke von Sachsen zugleich König in Polen; das Haus Hannover besaß Aussicht auf den englischen Thron, da wollten die Brandenburger und somit das Haus Hohenzollern nicht allzu mickrig daneben stehen. Der Spanische Erbfolgekrieg eröffnete die Möglichkeit für einen politischen Handel, denn der Kaiser benötigte für diesen Krieg dringend Soldaten. Der brandenburgisch-preußische Kurfürst Friedrich III. stellte nun ein Kontingent von 8000 Mann zur Verfügung, als Belohnung dafür wurde das Herzogtum Preußen zum Königreich erhoben. Prachtvolle Feierlichkeiten begleiteten die Zeremonie, als sich der Kurfürst am 18. Januar 1701 in Königsberg die Krone aufsetzte und fortan als »König Friedrich I.« regierte. Brandenburg-Preußen wechselte damit in eine neue und höhere Liga und scheute sich künftig immer weniger, das alte und große Österreich anzurempeln.
An der Spitze seiner Truppen brach der Preußenkönig Friedrich II. am 16. Dezember 1740 unter dem fadenscheinigen Vorwand von Erbansprüchen und ohne Kriegserklärung in das seit 200 Jahren zu Österreich gehörende Schlesien ein (»Erster Schlesischer Krieg»). Friedrich (»der Große«) bezeichnete diesen Eroberungszug ganz ungeniert als ein »Rendez-vous des Ruhmes«. Von nicht wenigen Mitmenschen wurde ihm der Titel »Raubkönig« verliehen. Nach dem »Dritten Schlesischen Krieg« (Friede von Hubertusburg am 15. Februar 1763) musste Österreich endgültig auf die reiche Provinz Schlesien und die Grafschaft Glatz verzichten. Preußen wurde nun zur europäischen Großmacht und zum beharrlichen Rivalen und Gegenspieler Österreichs innerhalb Deutschlands – das politische Klima zwischen Wien und Berlin wird künftig vom »Deutschen Dualismus« bestimmt.
Wenn von der Treue eines Volkes gegenüber seiner Herrschaft gesäuselt wird, kann etwas Skepsis nicht schaden. Als das mehrheitlich katholische Schlesien noch bei Österreich war, gehörte die tief verwurzelte Abneigung gegen die Preußen zum alten Erbgut der Schlesier. Ein Wettersprichwort, das zwischen Breslau und Gleiwitz in aller Munde lebte, charakterisiert diese Abneigung in wenigen Worten: »Aus Preußen kommt kein guter Wind, viel weniger ein gutes Kind!« Ein Jahrhundert der preußischen Herrschaft hatte offenbar genügt, um die gute Erinnerung an die frühere Heimstatt Österreich zu tilgen und um preußischer als die Preußen zu werden. Jedenfalls die schlesischen Zeitungsschreiber und nicht wenige Honoratioren in den Städten und auf dem platten Land gebärdeten sich im Jahr 1866 vehement und mit aller Verve antiösterreichisch. Die Berliner Hofpresse wusste diese Orientierung und das Engagement der Schlesier für den kommenden Krieg zu würdigen. So war auch der »Staatsanzeiger« am 25. Mai 1866 voll des Lobes:
»Ein Blick auf Schlesiens Haltung im Angesicht der drohenden Kriegsgefahr erfüllt unser preußisches Herz mit Stolz und Freude.
Wenn eine Provinz Grund hätte, Besorgnissen wegen eines Krieges mit Österreich Raum zu geben, so ist es Schlesien. Alle Provinzen leiden in Handel und Wandel bei der drohenden Kriegsgefahr; aber Schlesien ganz besonders. Andere Hauptstädte des Staates sind ängstlich, zaghaft; – aber Breslau, die Hauptstadt Schlesiens, sagt ihrem Könige, dass sie zu Opfern wie 1813 bereit sei, um Preußens Unabhängigkeit zu retten. Aus allen Provinzen eilen die Söhne des Vaterlandes auf den Ruf ihres Königs zu den Waffen, aber nirgends mit größerem Opfermut, als dort. Schlesische Männer von hoher Stellung entschließen sich, aus eigenen Mitteln Kavallerie- und Jäger-Regimente ihrem Könige zur Verteidigung der heimatlichen Provinz zu stellen.
In Schlesien ist die unwürdige Angst vor dem Kriege, welche in diesen Tagen öfters bei den Kommunalbehörden anderer Provinzen hervortrat, nicht bekannt, und doch sind Schlesiens Gefilde zunächst von der Brandfackel des Krieges bedroht.
Wem ein preußisches Herz im Busen schlägt, der spreche den Bewohnern Schlesiens für diese patriotische Haltung, welche auch auf die andern Provinzen des Vaterlandes ihre zündende Kraft ausüben wird, seinen Dank aus.
Schlesien bleibt die glänzendste Perle in der preußischen Krone.«
Am Beginn des 19. Jahrhundert wirbelte der Franzosenkaiser Napoleon Bonaparte das europäische Machtgefüge so elementar durcheinander, dass insbesondere in Deutschland kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Sowohl Preußen als auch Österreich führten gegen den korsischen Imperator und dessen mächtige und scheinbar unbesiegbare Armee Schlachten und Kriege, die verloren und später in größerer Allianz (Völkerschlacht bei Leipzig) auch wieder gewonnen wurden. Das nahezu Tausendjährige »Heilige Römische Reich Deutscher Nation« (der Begriff »Regnum teutonicum« – Deutsches Reich – taucht erstmals im Jahr 920 auf ) endete am 6. August 1806, als der römisch-deutsche Kaiser Franz II. auf die Kaiserwürde verzichtet (das 1804 neu geschaffene Amt des »österreichischen Kaisers« hat er als Franz I. inne) und die Kurfürsten, Fürsten und sonstigen Reichsstände sowie die Reichsbeamtenschaft und die Mitglieder der Reichsgerichte ihrer Pflichten entbindet. Die gemeinsame Klammer für die in den deutschen Gebieten lebenden Menschen existierte nicht mehr.
Neun Jahre später, nach der endgültigen Niederwerfung des napoleonischen Frankreich, wurde im Zuge des »Wiener Kongresses« ein modifizierter und den neuen Gegebenheiten angepasster Ersatz für das verblichene alte »Reich« geschaffen. Am 8. Juni 1815 unterzeichneten die Repräsentanten von 35 deutschen Fürstenstaaten und vier freien Städten die »Deutsche Bundesakte«, und damit war der »Deutsche Bund», der bis zum 23. August 1866 manchmal mehr schlecht als recht existieren sollte, aus der Taufe gehoben. Als Heimstätte der Bundesversammlung (Bundestag) wurde die freie Stadt Frankfurt auserkoren. Die »Bundesakte« kam den kleineren Staaten entgegen, denn die Stimmverteilung in der Bundesversammlung war so festgelegt, dass eine hegemoniale Vormachtstellung der »Großen« weitgehend ausgebremst wurde – zumindest in der Theorie.
DER PREUSSISCHE EMPORKÖMMLING
Bis zu den Revolutionsjahren 1848/49, also im »Vormärz« bzw. im »Biedermeier«, harmonisierten Preußen und Österreich relativ gut und weitgehend konfliktfrei. Berlin und Wien verband in diesen Jahren der »Restauration« das gemeinsame Interesse am Niederhalten bzw. auch Niederknüppeln jeglicher republikanischer, demokratischer oder nationalstaatlicher Ideen, die von unten – also aus dem Volk – kamen. Die französische Zeit und die Befreiungskriege hatten bei nicht wenigen Bürgern politisch-emanzipatorisches und auch nationalstaatliches Denken freigesetzt, das den absolutistisch herrschenden monarchischen Machthabern nicht gefallen konnte. Die »März-Revolution 1848«, die sich in unterschiedlicher Intensität und Form bis in das Jahr 1849 hinzog, sollte das absolutistische System vor allem in Österreich und Preußen zertrümmern und Deutschland auf parlamentarischer Grundlage vereinen (Paulskirchen-Versammlung in Frankfurt). Die Bajonette der Herrschenden behaupteten sich gegen die leidenschaftlich vorgetragenen Ideale der Revolution. Die »Ordnung« innerhalb des Deutschen Bundes wurde wieder hergestellt; und doch war es nicht mehr wie vorher. Die relative Einigkeit zwischen den beiden deutschen Großmächten Österreich und Preußen im »Vormärz« zerbröselte nun zusehends, insbesondere seit im Konflikt um Kurhessen (Kurhessischer Verfassungsstreit) die Spannung zwischen Österreich und Preußen bis hin zum Krieg zu eskalieren drohte. In diesem Zusammenhang kam es am 8. November 1850 zu einem kurzen Schusswechsel zwischen preußischen und bayerischen Vorposten, die einem Schimmel das Leben kosteten.
Preußen musste – auch bei seinem Plan einer »norddeutschen Union« – klein beigeben und stand gedemütigt da. Sein Hegemonieanspruch scheiterte wieder einmal an Österreich. In der »Olmützer Punktation«, die am 29. November 1850 in der mährischen Stadt Olmütz zwischen Österreich und Preußen abgeschlossen wurde, verzichteten die Berliner Gegenspieler (vorerst) darauf, die deutsche Einheit unter preußischer Führung verwirklichen zu wollen. Preußen erklärte sich auch zum gemeinsamen Vorgehen mit Österreich in der leidigen Schleswig-Holsteinischen Frage bereit. Wenigstens für einige Zeit war der Dynamik des »Deutschen Dualismus« durch Olmütz etwas der Schwung genommen.
In Preußen wurde die Zeit des Stillhaltens zur Modernisierung und strafferen Organisation des Heereswesens genutzt. Neue Erfindungen, wie der Telegraph und die Eisenbahn, wurden in die militärstrategischen Planungen konsequent miteinbezogen. Mit der Übergabe der Regentschaft am 7. Oktober 1858, als der 61-jährige Prinz Wilhelm von Preußen von seinem erkrankten Vater Friedrich Wilhelm IV. die Amtsgeschäfte übernahm und nachdem Wilhelm am 26. Oktober vor den vereinigten Kammern in Berlin den Eid auf die Verfassung leistete (von dieser Eidesleistung hatte ihm sein Vater abgeraten), begann in Preußen die mit Hoffnungen befrachtete »Neue Ära« mit ihrem (zumindest eine Zeit lang) gemäßigt liberalen Kurs. Das Bürgertum war nun im Unterschied zur früheren Restaurationspolitik mehr und direkter an der Politik beteiligt, und das gab dem preußischen Patriotismus neue Impulse und eine breitere Basis.
In Österreich sah die Sache etwas anders aus. Franz Joseph, der junge Kaiser in Wien, hielt noch länger an alten Zöpfen und der obrigkeitlichen »Vormärz«-Gesinnung fest. Der Gedanke an eine Mitsprache des Volkes an Angelegenheiten der Gesetzgebung und an Politikgeschäften war bis zu den verlorenen Schlachten 1859 in Norditalien aus seiner Vorstellungswelt noch ausgesperrt. Erst die Niederlage der österreichischen Armee 1859 gegen die Franzosen in Solferino und Magenta und die daraus resultierende machtpolitische Schwäche des Kaisers und seiner Regierung erzwang ein Umdenken Franz Josephs, und im »Laxenburger Manifest« vom 15. Juli 1859 versprach der Kaiser seinen Untertanen endlich eine Änderung der machtpolitischen Rahmenbedingungen. Tiefgreifende Verbesserungen in der Möglichkeit der politischen Mitsprache wurden aber erst ab 1866, nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen, also unter dem Druck der Verhältnisse, in Angriff genommen. Mit dem »Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder«, das Kaiser Franz Joseph I. am 21. Dezember 1867 unterzeichnete, wurde Österreich schließlich doch noch zu einem vorbildhaften und im Sinne der Rechtssicherheit, der politischen Willensbildung und des Bildungswesens modernen Verfassungsstaat.
DIE DREISTEN DÄNEN
1864 braute sich ein außenpolitisches Gewitter hoch im Norden des Deutschen Bundes zusammen. Die vom dänischen Reichstag in Kopenhagen im März 1863 beschlossene und am 1. Jänner 1864 in Kraft getretene Vereinigung des Herzogtums Schleswig mit Dänemark konnte vom Deutschen Bund und somit von dessen zwei größten Mächten – Österreich als Vorsitz führender Staat und Preußen als nachbarlicher »großer Bruder« Schleswigs und Holsteins – nicht hingenommen werden.
Im »Londoner Vertrag« vom 8. Mai 1852, von Österreich, Preußen, England, Frankreich, Russland, Schweden und Dänemark unterzeichnet, war in einer neuen Thronfolgeordnung festgelegt worden, dass Prinz Christian August von Sonderburg-Glücksburg zwar Erbe sowohl Dänemarks als auch der deutschen Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg sein sollte, eine Einverleibung der Herzogtümer in das Königreich war jedoch strikt ausgeschlossen. Erbberechtigt in Schleswig-Holstein war eigentlich der Herzog von Augustenburg, der aber gegen eine Entschädigung auf seine Ansprüche verzichtete.
Die ganze Besitztums- und Machtfrage in diesem zwischen Dänemark und Deutschland und der Nord- und Ostsee eingeklemmten platten Stück Land war traditionell sehr kompliziert, so dass der britische Premier H. J. Temple Palmerston laut dem Historiker Werner Maser resignierend geklagt haben soll, »dass es jemals nur drei Menschen gegeben habe, die in der Lage gewesen seien, sich durch die jeweiligen und vielfach einander widersprechenden Bestimmungen des Fürsten-, Bundes-, Landes- und Erbfolgerechts hindurchzufinden: Ein Prinz, und der sei gestorben, ein deutscher Gelehrter, und dieser sei darüber verrückt geworden – und schließlich Palmerston selbst, der aber wieder alles vergessen hätte«.
In Kopenhagen gewannen die nationalliberalen »Eiderdänen« zunehmend an Macht. Deren beharrliches Bestreben ging dahin, Schleswig umfänglich in den Staat Dänemark einzugliedern. Am 13. November 1863 gab sich Dänemark eine neue Verfassung, die als »eiderdänische Gesamtstaatsverfassung« nun auch vollinhaltlich für Schleswig galt – bis hin eben zur Eider, jenem Fluss zwischen Schleswig und Holstein. Als der dänische König an einem kalten Januartag des Jahres 1864 die Verfassung paraphierte und die Schleswiger damit de jure zu »richtigen« Dänen wurden und das ewig ungeteilt der Schleswiger und Holsteiner die alte Gültigkeit dieser Worte verlor, war in Deutschland – von der Etsch bis an den Belt und von der Maas bis an die Memel – Feuer am Dach. Galt doch schon der Sängergruß der Augsburger Liedertafel beim ersten gesamtdeutschen Sängerfest im Sommer 1845 in Würzburg den deutschen Brüdern im Norden:
»Wo an den Marken deutscher Erde
Die Nordsee ihre Wogen rollt,
Dort wo mit drohender Gebärde
Um unser Recht der Däne grollt,
Auch an der Eider wohnen Brüder:
Da tönet deutscher Bardensang,
Herbei! lasst schallen eure Lieder,
Zum Bruder ist der Weg nicht lang.«
Am 16. Januar 1864, wenige Tage nach des Königs Unterschrift, richteten die beiden deutschen Großmächte Österreich und Preußen an die dänische Regierung eine Note mit der ultimativen Aufforderung, bis zum 18. Januar die verfassungsmäßige Vereinigung Dänemarks mit Schleswig aufzuheben, ansonsten sei mit unangenehmen Folgen zu rechnen: »Sollte die Königlich dänische Regierung dieser Aufforderung nicht entsprechen, so würden die beiden genannten Mächte sich genötigt sehen, die ihnen zu Gebote stehenden Mittel zur Herstellung des Status quo und Sicherung des Herzogtums Schleswig gegen die widerrechtliche Vereinigung mit dem Königreiche Dänemark in Anwendung zu bringen.«
Die Dänen lehnten die Forderungen des Ultimatums ab, da sie fälschlicherweise auf die englische Unterstützung hofften. Graf Bismarck, der geschickte Taktiker, der inzwischen ja preußischer Ministerpräsident war, überredete die Regierung in Wien zur gemeinsamen militärischen Aktion gegen die Dänen. Österreich, als bis dahin der mächtigste Staat Deutschlands, musste schon aus Gründen der Ehre und Reputation den Brüdern (und Schwestern) »da oben« zu Hilfe kommen. Das erwarteten die Deutschen, in Tirol oder Kärnten ebenso wie etwa im Rheinland oder in Ostpreußen. Mehr als die Ehre und eine gute Nachrede war für die Österreicher nicht zu gewinnen, aber allein schon wegen der machtpolitischen Auswirkungen – »Deutscher Dualismus« – konnte man die Preußen südlich und nördlich der Eider nicht alleine werkeln lassen. Der gewiefte Bismarck dachte schon etwas weiter: Er wollte, dass das österreichische Militär mithalf, den Dänen Mores zu lehren, früher oder später sollten Schleswig und Holstein aber von Preußen geschluckt werden, um dessen Macht und Glorie zu vergrößern und um neue – ideal positionierte – Häfen für die Marine und die Handelsschifffahrt zu gewinnen. Der Gedanke an diese Häfen raubte wiederum den Politikern in England etwas an Schlaf. Die Sache drohte, international zu eskalieren. Die Zeitung »Lokomotive an der Oder« aus dem preußisch-nie-derschlesischen Oels beschäftigte sich in ihrer Ausgabe vom 4. Februar 1864 mit der englischen Haltung in diesem Konflikt:
»Von allen europäischen Mächten tritt England am lautesten für die dänische Regierung auf; ja lebhafter sogar, als dies ein großer Teil der Dänen selbst tut. Von London gehen jene Nachrichten und telegraphischen Depeschen aus, welche bestimmt sind, die Deutschen einzuschüchtern. Als vor einigen Wochen nur die deutschen Mittelstaaten Truppen in Holstein hatten einrücken lassen, da schrieb Lord Russel als Minister des Auswärtigen seine groben, anmaßenden Noten an die Regierungen dieser Staaten, auf welche wenigstens der sächsische Minister Beust den hoffärtigen Engländer gebührend bedient hat. Jetzt, wo Österreich und Preußen Schleswig ebenso in Pfand nehmen wollen, wie der deutsche Bund Holstein schon genommen hat, jetzt versucht die englische Regierung, die genannten beiden Großmächte mit der Drohung eines Krieges von größtem Umfange und unberechenbaren Folgen zu erschrecken. Die Times vom 29. Januar berechnet, dass 38.000 Mann Dänen schon jetzt vom besten Geiste beseelt in Schleswig stehen und dass zu ihrer Verstärkung 35.000 Mann Schweden und 30.000 Engländer bereit seien, für den Fall, dass die Deutschen in der Tat in Schleswig vor Ablauf von fünf Wochen einrücken. Da auch dieser Schreckschuss die Österreicher und Preußen vom Vordringen nicht abhielt, so folgen jetzt versteckte Drohungen mit Frankreich.«
Am 20. Januar 1864 rückten österreichische und preußische Truppen in Holstein ein, und am 1. Februar überschritten die verbündeten Waffenträger die dänische Grenze. Die Dänen wurden in mehreren Gefechten rasch zurück gedrängt. Schon am 7. Februar zogen österreichische und preußische Truppen gemeinsam in Flensburg ein. Die Leser der »Wiener Abendpost« konnten schon am 5. Februar mit Stolz vernehmen:
»Ein Teil unserer tapferen Armee steht unter den Waffen, um, dem Rufe ihres Kaisers und erhabenen Kriegsherrn gehorsam, an den Nordgrenzen Deutschlands für Österreichs Ehre und deutsches Recht zu kämpfen. Mit innigster Teilnahme folgen unsere Gedanken den wackeren Kriegern, die auf fernen Schlachtfeldern unter den Unbilden der Jahreszeit mutvoll der Gefahr und dem Tode ins Auge blicken.
Wir haben schon die ersten Waffentaten unserer Armee zu verzeichnen gehabt. Es bedarf wohl keiner ausdrücklichen Hervorhebung, dass es mit den Gefühlen voller patriotischer Befriedigung, mit den Gefühlen des Stolzes und der Freude geschehen ist. Die Tapferkeit der österreichischen Truppen war über alles Lob erhaben. Diese Worte, dessen sind wir sicher, werden so oft wiederholt werden, als österreichische Fahnen im offenen Felde wehen, als österreichische Soldaten diesen Fahnen auf der Bahn der Ehre und hoffentlich des Sieges folgen werden. Das Vertrauen in die Kraft und den Wert der österreichischen Armee ist selbst in trüben Tagen nie erschüttert worden, an den Schanzen des Dänenwerks wird es neue und kräftige Blüten treiben.«
Dieser Krieg gegen die Dänen, der die Deutschen in nationaler Hochstimmung einte, könnte auch die innerdeutschen Querelen zum Erliegen bringen – das hoffte man zumindest in der Redaktion der »Wiener Abendpost« (eine Beilage zur »Wiener Zeitung«) am 3. Februar:
»Das deutsche Volk, das sich in seiner Friedensmuße in hunderterlei theoretische Streitigkeiten und Verfassungsfragen vertieft und in endlose Formalien verloren hat, kann nun endlich einmal Gelegenheit finden, mit ernster Teilnahme einen Kampf zu verfolgen, den die von jenem Meinungsstreit glücklicher Weise unberührten Krieger Preußens und Österreichs für die Ehre und Interessen Deutschlands ausfechten werden. Da wird ja wohl endlich Hader und Zwiespalt schweigen, und jeder wird wissen, was er für sein Vaterland zu tun und zu wünschen hat.«
Nach dem Sturm der Preußen auf die Düppeler Schanzen am 18. April war die Widerstandskraft der Dänen gebrochen. Im »Wiener Frieden« vom 30. Oktober 1864 musste Dänemark die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Österreich und Preußen abtreten. Eine gemeinsame preußisch-österreichische Regierung für diese Territorien wurde vereinbart. Die in diesem Krieg zusammen arbeitenden beiden deutschen Großmächte handelten in dieser Sache »herrisch« und ohne tiefere Einbindung der Bundesversammlung in Frankfurt. Das kostete insbesondere Österreich einige Sympathien bei den deutschen Klein- und Mittelstaaten (heute könnte man dies mit der Situation in der Europäischen Union vergleichen, wenn etwa die beiden »Großen«, Deutschland und Frankreich, richtungweisende Entscheidungen »von oben herab« treffen, welche die kleineren Mitgliedsstaaten willig akzeptieren sollen).
Mit der Harmonie zwischen den beiden Großen war es bald wieder vorbei. Bismarck machte sich kaum mehr die Mühe, seine Absicht, Schleswig seinem über allem geliebten Vaterland Preußen einzuverleiben, zu verbergen. Nicht nur deshalb führte das sogenannte »Kondominium«, die gemeinsame preußisch-österreichische Herrschaft über Schleswig-Holstein, innerhalb kürzester Frist zu Spannungen zwischen Berlin und Wien. Der »Deutsche Dualismus« brandete wieder mächtig auf. Am 19. August 1865 warnte das »Neue Fremden-Blatt« die österreichische Regierung, sich nur ja nicht noch einmal vor den preußischen Karren spannen zu lassen: »Österreich muss mit der deutschen Frage zu Ende kommen, wenn der deutsche Bund nicht ein Gewicht an seinen Füßen, anstatt einen Machtzuwachs bedeuten soll. Das System, Preußen überall hin als überwachende Gouvernante zu folgen, wie man es sich unter der Kooperation in den Herzogtümern gedacht hat, ist ein unnützes und aufreibendes.«
TRÜGERISCHE HERZLICHKEITEN
Mit der »Gasteiner Konvention« vom 14. August 1865, die am 20. August von den Monarchen Österreichs und Preußens in Salzburg unterzeichnet wurde, gelang noch einmal eine kurzzeitige Hintanstellung der gegenseitigen Gereiztheiten: Österreich verwaltete nun Holstein und Preußen Schleswig. Das geldklamme Österreich trat das Herzogtum Lauenburg gegen eine erkleckliche Summe an Preußen ab. Die »Wiener Abendpost« (Wiener Zeitung) klärte ihre Leser über dieses weitgehend unbekannte kleine Herzogtum auf: »Das Herzogtum Lauenburg hat einen Flächeninhalt von 18,05 Quadratmeilen ohne die Enklave von 3 Quadratmeilen, die zu Hamburg gehört. Es zählt gegen 50.000 Seelen in 3 Städten, 1 Marktflecken, 150 Dörfern, darunter 8 Kirchdörfer, oder überhaupt 4 städtischen und 24 Landkirchspielen und 22 adeligen Gütern. Von den 3 Städten haben Ratzeburg 39.898, Mölln 3401, Lauenburg 1072 Einwohner. Das Herzogtum ist westlich und nordwestlich von Holstein begrenzt, nördlich von Lübeck und dem mecklenburg-strelitz’schen Fürstentum Ratzeburg, östlich von Mecklenburg-Schwerin, südlich von Hannover, und davon durch die Elbe geschieden, südwestlich von Hamburg.
Das »Neue Fremden-Blatt« mit seinen beiden Herausgebern Isidor Heller und Wilhelm Wiener fand diesen Verkauf aus patriotischer Sicht nicht recht koscher: »Einen eigentümlichen, beinahe wehmütigen Eindruck macht der Verkauf Lauenburgs. Mit gerechtem Stolze hat bisher Österreich jede freche Zumutung zurückgewiesen, gegen pekuniäre Entschädigungen sein Besitztum zu schmälern. Nun ist Lauenburg kein Erbland, aber unseren Feinden wird dieser Handel bequemen Anlass geben, willkommene Parallelen zu ziehen.« (23. August 1865).
Nur eine Zeitungsausgabe später beklagte dasselbe Blatt die Vereinbarungen von Gastein (»Gasteiner Konvention«) als Versagen der österreichischen Diplomatie:
»Der 14. August 1865 wird fortan als einer der merkwürdigsten Tage in der Geschichte Österreichs, in der Geschichte Deutschlands angesehen werden. Mit der Unterzeichnung des Gasteiner Abkommens am 14. August hat sich ein weltgeschichtliches Ereignis von ungeheurer Bedeutung vollzogen. Es war gleichfalls im Monate August, man zählte den 6. August 1806, als Kaiser Franz I. die deutsche Kaiserwürde niederlegte. Das deutsche Reich hatte tatsächlich zu existieren aufgehört, der Partikularismus der deutschen Fürsten hatte den Rheinbund hervorgerufen, – sie haben bitter ihre Sünden am deutschen Genius gebüßt. Das deutsche Kaiserreich ist nicht wieder erstanden. Mit der Gründung des Deutschen Bundes im Jahre 1815 ging das Präsidium des deutschen Bundestages an Österreich über, der abgeblasste Schatten der deutschen Kaiserwürde. Auch auf diese Schattenwürde sah das langgestreckte Preußen mit Missgunst hin und die Blätter der Geschichte seit jenen Tagen verzeichnen viele Taten, in denen sich diese Missgunst dokumentiert. Mit aller Beharrlichkeit hat Preußen seither gesucht, das Übergewicht in Deutschland zu gewinnen, und es ist noch nicht lange her, als ein österreichischer Minister, es ist Graf Mensdorff, im österreichischen Parlamente zu verstehen gab, dass auch die gegenwärtige preußische Regierung nationalvereinliche Tendenzen verfolge. Was Preußen bisher vergeblich erstrebt, es ist ihm am 14. August d. J. gelungen. Freiwillig tritt Österreich vor Preußen zurück.
Mit der Unterzeichnung der Gasteiner Konvention datiert das tatsächliche Übergewicht Preußens in Deutschland. Was zählt denn das Präsidialrecht Österreichs in Frankfurt gegenüber den Bestimmungen der Gasteiner Konvention? – Preußen hat an Gebiet gewonnen und es steht ihm ein noch größerer Gebietszuwachs in Aussicht, Preußen erhält einen der besten Häfen der Welt und dominiert militärisch über den ganzen Norden Deutschlands. Denn zu glauben, dass Kiel wirklich einmal ein deutscher Bundeshafen werden sollte, wie es die Konvention bestimmt, dazu fehlt uns das kindliche Gemüt. Da müsste der deutsche Bund nicht der deutsche Bund sein und Deutschland dürfte keinen Hannibal Fischer erzeugt haben. Wenn aber, was geradezu unmöglich ist, die deutschen Fürsten sich wirklich zu einer Tat aufraffen und die Gründung einer deutschen Flotte beschließen wollten, so wird sich Preußen erst recht die Hände reiben können, denn diese deutsche Flotte wird eine preußische sein müssen.
Auf die einzelnen Punkte der Konvention einzugehen, halten wir nach dem Gesagten für überflüssig. Wo es sich um so große Dinge handelt, feilscht man nicht um Kleinigkeiten. Die Militärstraßen, die Telegraphendrähte, ja selbst der Nord-Ostsee-Kanal, der Verkauf Lauenburgs sind verschwindend kleine Zugeständnisse gegenüber der Tatsache, dass Preußen der erste Platz in Deutschland eingeräumt wird.
Uns sei nur die bescheidene Frage gestattet: Welches sind die Gegenkonzessionen, die Preußen Österreich macht und wo sind sie verzeichnet?«
In der Stadt Schleswig fanden solch kritische Überlegungen am 18. August keinen Raum, denn dort wurde unter »allgemeiner und herzlicher« Teilnahme der 35. Geburtstag des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. gefeiert. Der Bericht eines Augenzeugen:
»Kanonensalven verkündeten den Anbruch des Festtages, zu welchem die Stadt ihren vollsten Flaggenschmuck angelegt hatte. Viele von den Fahnen waren mit Kränzen und Blumensträußen geziert. Vormittags war feierlicher Gottesdienst, wozu sich Se. Exzellenz der österreichische Zivilkommissär Freiherr v. Halbhuber, der preußische Zivilkommissär Freiherr v. Zedlitz und die übrigen Autoritäten eingefunden hatten. Der weite Raum des altehrwürdigen Domes war von der Menge Andächtiger aus allen Klassen der Bevölkerung gefüllt. Propst Hansen gab in einer ergreifenden Rede den gegenüber dem Herrscher Österreichs beseelenden Gefühlen des Dankes und des Vertrauens der Bevölkerung würdigen Ausdruck. Nach Beendigung der Andacht erschienen der preußische Zivilkommissär, die Mitglieder der schleswig-holstein’schen Landesregierung, die sonstigen Zivil- und geistlichen Autoritäten und die hier stationierten preußischen Offiziere vor dem österreichischen Zivilkommissär, um ihre ehrerbietigen Glückwünsche für Se. Majestät den Kaiser abzustatten. Zahlreiche Deputationen, Schreiben und Telegramme aus verschiedenen Gegenden Schleswig-Holsteins sprachen gleichfalls Glückwünsche der einzelnen Bezirke, Kommunen und Vereine für Se. Majestät aus und bezeugten die innige Teilnahme des Landes an der frohen Feier.«
Auch in Salzburg schien am 19. August alles eitel Wonne, als sich die Monarchen von Österreich und Preußen am Tag vor der Unterzeichnung der von Bismarck und Graf Blome (österreichischer Gesandter in Bayern) erarbeiteten »Gasteiner Konvention« in der Mozartstadt begrüßten: »Über die Zeit, zu welcher der König von Preußen eintreffen werde, lauteten die Angaben verschieden. Schon vor sechs Uhr hatten sich Ihre Exzellenzen die Grafen Crenneville und Mensdorff und andere höhere Offiziere vor der Einfahrt des Hotels zum »Erzherzog Karl« eingefunden, in dessen zweitem Stockwerk die Zimmer Sr. Majestät des Königs sich befinden. Um 6 Uhr erschien Se. Majestät der Kaiser in der Uniform Allerhöchstseines preußischen Regiments, bald darauf Herr v. Bismarck, und die Herrschaften begaben sich nun in den ersten Stock des Hotels hinauf. Zehn Minuten nach sieben Uhr fuhr der König in österreichischer Generalsuniform im offenen Wagen sitzend und von der Menge lebhaft begrüßt vor, sprang schnell aus dem Wagen und umarmte und küsste den ihm entgegeneilenden Kaiser wiederholt aufs Herzlichste. Nach zehn Minuten kehrte Se. Majestät der Kaiser, Allerhöchstwelcher seinen hohen Gast in dessen Appartements geleitet hatte, in die Residenz zurück, auf dem ganzen Wege von brausend sich fortwälzenden Hochrufen begleitet. Bald darauf erwiderte der König den Besuch.«
Zur Nachfeier des »Allerhöchsten Geburtsfestes« und auch zur Ehre der hohen preußischen Gäste hatte die Stadt Salzburg am Abend dieses denkwürdigen Tages ein rauschendes Ballfest ausgerichtet.
Die Idylle während des Treffens der zwei mächtigsten deutschen Herrscher ließ auf einen konfliktarmen Fortgang der politischen Geschäfte innerhalb Deutschlands schließen. Dieser arglosen Hoffnung stand allerdings Bismarcks eiserner Wille entgegen, Preußen baldmöglichst zum absoluten Beherrscher Deutschlands zu machen. Dazu war es unumgänglich, den Erzrivalen Österreich aus diesem ohne weiteres Zaudern hinaus zu drängen – wenn nötig, auch mit Gewalt
Die Gasteiner Vereinbarung, die auf die Forderung der öffentlichen Meinung in Deutschland, aus den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg einen deutschen Mittelstaat unter der Herrschaft des Prinzen Friedrich von Augustenburg zu errichten, keine Rücksicht nahm, war nirgends besonders populär. Sie diente Bismarck auch nur dazu, etwas Zeit zur idealen Umsetzung seiner Pläne zu gewinnen.
Am 15. September trat der Gasteiner Vertrag in Kraft, und zum österreichischen Gouverneur von Holstein wurde Feldmarschallleutnant Ludwig Freiherr v. Gablenz ernannt. Schon im ersten Monat des neuen Jahres 1866 (am 26. Januar) warf der preußische Ministerpräsident und Außenminister Otto von Bismarck erneut verbale Brandbomben gegen Österreich. In einer scharfen Note an Wien kritisierte er die österreichische Politik in Holstein.
BISMARCK DRÄNGT DEM KRIEG ENTGEGEN
Nur knapp fünf Wochen später, am 28. Februar, entschied sich der preußische Ministerrat, den gordischen Knoten des »Deutschen Dualismus» gewaltsam zu lösen. Erfolgreich plädierte Bismarck in dieser Sitzung für den Krieg gegen den Rivalen Österreich:
»Preußen ist die einzige lebensfähige politische Schöpfung, die aus den Ruinen des alten Deutschen Reiches hervorgegangen ist, und hierauf beruhe sein Beruf, an die Spitze von Deutschland zu treten. Österreich habe das nach diesem Ziele gerichtete natürliche und wohlberechtigte Streben Preußens aus Eifersucht von jeher bekämpft, indem es die Führung Deutschlands, obwohl selbst dazu unfähig, Preußen nicht gegönnt habe. […] Österreich gönne Preußen nicht den gebührenden Einfluss in Deutschland, nicht seine für Preußen und Deutschland gleich notwendige gesicherte Stellung in den Elbherzogtümern, nicht die Frucht seiner Siege. Diese Frucht sich zu erhalten, sei für Preußen eine durch politische Motive und ebenso durch die allgemeine Stimmung im Lande und in der Armee begründete Notwendigkeit.
Es wäre eine Demütigung, wenn Preußen sich jetzt zurückziehen wollte. Eine solche Demütigung müsse um jeden Preis vermieden werden. Dann aber sei der Bruch mit Österreich wahrscheinlich. Es gelte also jetzt, die Frage zu beraten und sich darüber zu entschließen, ob Preußen vor diesem Hindernis – Bruch und eventuell Krieg mit Österreich – zurückschrecken solle? […] Der gegenwärtige Moment sei für Preußen günstig wegen der Stellung Italiens, das seine für Österreich bedrohlichen militärischen Kräfte nicht mehr lange werde zusammenhalten können, wegen des bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse zu Kaiser Napoleon [III.], wegen der jetzt noch vorhandenen Überlegenheit unserer Bewaffnung, ja selbst wegen unserer Dienstzeit bei der Fahne, die jetzt faktisch von längerer Dauer sei als in Österreich. Die ganze historische Entwicklung der deutschen Verhältnisse, die feindselige Haltung Österreichs treibe uns dem Krieg entgegen. Es würde ein Fehler sein, ihm jetzt aus dem Weg zu gehen.«
Nun beschleunigten sich die Ereignisse. Am 14. März ordnete Kaiser Franz Joseph die Aufstellung einer Nord- (gegen Preußen) und einer Südarmee (gegen Italien) an. Preußen schloss am 8. April ein Schutz- und Trutzbündnis mit Italien ab. Italien verpflichtete sich darin zur Kriegserklärung an Österreich, sobald Preußen die Feindseligkeiten gegen Österreich eröffnet. Den Italienern ging es um die Gewinnung Venetiens, das sie zur territorialen Abrundung ihres noch jungen Staatsgebildes und natürlich wegen des nationalen Prestiges unbedingt und um jeden Preis wollten. Tatsächlich waren die Italiener noch im Februar bereit, den Österreichern Venetien abzukaufen. Der Kaiser in Wien lehnte dieses monetäre Anerbieten aus Gründen der Ehre kategorisch ab. Wenn die Welschen das seit 1797 (mit kurzen Unterbrechungen) Österreich zugehörige Venetien schon unbedingt haben wollten, dann sollten sie wenigstens versuchen, es sich mit Waffengewalt zu holen.
Giuseppe Garibaldi, der italienische Revolutionär und Freiheitsheld, lästerte wider besseren Wissens schon seit Jahren in ganz Europa über den österreichischen »Völkerkerker«, in dem die Venetianer und die »Welschtiroler« geknechtet würden. Nicht wenige europäische Schwärmgeister hielten diese Verleumdungen für bare Münze.
Als Gegenleistung für die italienische Kriegsbereitschaft versprach Preußen dem Zitronen- und Apfelsinenstaat, jeglicher Landräuberei seinen Segen zu geben.
Durch Geheimverhandlungen wusste Bismarck schon seit einiger Zeit, dass Frankreich im Fall des Krieges mit Österreich neutral bleiben würde, das gab ihm Schneid beim weiteren Anschüren des Konfliktes. Als das Schutz- und Trutzbündnis mit Italien bekannt wurde und zugleich auch in die deutsche Öffentlichkeit durchsickerte, dass Bismarck als Preis für das französische Stillhalten möglicherweise bereit war, Teile der linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich abzutreten, wogte ein Sturm der Entrüstung durch die deutschen Lande. Das altehrwürdige deutsche Österreich ausgerechnet den Welschen zum Fraß vorzuwerfen und kerndeutsches Land im Westen des »Deutschen Bundes« dem französischen Erbfeind zu versprechen, das war eines Deutschen absolut unwürdig – so die einhellige Stimmung des Volkes und der Presse in Österreich und in den deutschen Klein- und Mittelstaaten. Den Preußen und deren Staatslenker Bismarck wurde vielfach verbal der Status »Deutsch« aberkannt.
Am 21. April wurde die österreichische Südarmee mobilisiert. Zu deren Oberbefehlshaber ernannte der Kaiser Erzherzog Albrecht, den Sohn Erzherzog Karls, des Siegers gegen Napoleon bei der Schlacht von Aspern.
Die Rüstungsspirale drehte sich rasch schneller. Das militärische Fachblatt »Der Kamerad« verwies am 28. April auf die notwendigen Reaktionen:
»Angesichts der Kriegsrüstungen Italiens, welche nach den letzten Nachrichten einen äußerst drohenden Charakter angenommen haben, war es für Österreich ein Gebot der Vorsicht, entsprechende Gegenmaßregeln, die jedoch rein defensiver Natur sind und bleiben werden, zu treffen. Die Geschichte liefert genug Beweise dafür, dass die Anerkennung und Beobachtung des Staaten- und Völkerrechtes bei den piemontesischen Machthabern stets ein überwundener Standpunkt war, und oft genug verbargen sich die Absichten der beutelustigen neuen Regierung Italiens hinter kläglichen Putschversuchen abenteuerlichen Gesindels. Österreich hat in Rücksicht hierauf Anordnungen getroffen, welche genügende Bürgschaft dafür bieten, dass jeglicher Versuch eines Einfalles in unser italienisches Gebiet scheitern wird. Preußen, welches dem schönen Beispiele des neuen Italiens folgt, Verträge, Recht, Gesetz und Ehrlichkeit höhnisch mit Füßen tritt, und unter dem Deckmantel des Protestes gegen angebliche österreichische Rüstungen seine Streitkräfte an unseren Nordgrenzen konzentriert, lüftet mit jedem Tage die Maske etwas mehr und zeigt bereits ziemlich offen das Gesicht des raublustigen Feindes. Es tritt auch gegen diesen Feind das unabweisbare Gebot der Vorsicht an Österreich heran, sich für jede Eventualität vorzusehen und mit den täglich an Umfang zunehmenden Rüstungen Preußens so weit gleichen Schritt zu halten, als es die rein defensive Haltung Österreichs gebietet.«
Jeder warf dem anderen vor, an der Eskalationsschraube zu drehen. Vorschläge zur Konfliktlösung wechselten sich in rascher Folge mit Kriegsdrohungen ab. Die Zeitungen in Österreich, in Preußen und in Italien leckten Blut und gerieten sehr bald in patriotische Raserei. Als Österreich Mitte April seine Rüstungsanstrengungen gegenüber Preußen etwas verlangsamte, um den Konflikt mit dem Kontrahenten möglicherweise etwas zu entschärfen (gleichzeitig wurde aber das Aufrüsten gegenüber Italien intensiviert), heulte das Wiener »Fremden-Blatt« gleich missmutig auf: »Wohin soll, wohin kann eine solche Situation des fortdauernden Krieges ohne Schlachten führen? Dieses schleichende Friedensfieber muss endlich den Staatskörper entkräften und für jenen entscheidenden Moment kampfunfähig machen, wo es gälte, die Existenz, die Machtstellung, die Ehre und Zukunft des Reiches gegen die andräuenden Feinde mit überlegener Gewalt zu verteidigen. Entweder den vollen Frieden oder den ganzen Krieg!«
Als der Frühling des Jahres 1866 sich von seiner schönsten Seite zeigte, kam das Mobilmachungs-Karussell in vollen Gang: 21. April – Mobilmachung der österreichischen Südarmee; 26. April – Mobilmachung der italienischen Armee; 27. April – Mobilmachung der österreichischen Nordarmee; 3. Mai – Mobilmachung der preußischen Armee.
Feldzeugmeister Ludwig Ritter von Benedek wurde vom Kaiser zum Oberbefehlshaber der gegen Preußen gerichteten Nordarmee ernannt. Der mit seinem Truppenteil am 24. Juni 1859 in Solferino erfolgreiche Benedek war beim Volk und bei den Soldaten populär und beliebt. Die Aussicht, als oberster Kommandeur gegen die Preußen zu ziehen, bereitete ihm allerdings einiges Unbehagen, denn als altgedienter Offizier im österreichischen Teil Italiens kannte er dort nach eigenem Bekunden jeden Steg und Weg, während er für den geplanten Marsch auf Berlin erst die preußische Landkarte studieren musste.
Die Tiroler wurden in diesen Tagen hellwach, »denn es unterliegt wohl gar keinem Zweifel, dass, wenn der Krieg in Italien ausbricht, welsche Freischaren sich sogleich in die Tiroler Berge werfen werden.« (Volks- und Schützen-Zeitung vom 30. April 1866). Als passendste Waffen gegen italienische Freischärler empfahl diese in Innsbruck erschienene Zeitung den Prügel, die Sense, den Dreschflegel und den Morgenstern.
Die Könige der »ruhigen Hand», die Schützen und Jäger, sollten aber auf jeden Fall zur Flintenbüchse – egal ob mit Kugel- oder Schrottlauf – greifen. Kein Schuss soll umsonst abgefeuert werden: »Anführer und Offiziere des Feindes müssen vor allen andern abgeschossen werden. Bringt der Feind Geschütz und Munitionswägen, passt sie ab und schießt die Pferde weg. Ein Gaul ist leicht zu treffen, fällt die Bespannung, so hat die Kanone ausgebrummt. Trompeter und Tambure sollen ebenfalls gleich aufs Korn genommen werden. […] Zu nächtlichen Überfällen ist die Flinte besser geeignet als der Stutzen. Eine Flinte mit grober Mücke versehen und gehackten Bleistücken oder Pfosten geladen, kann in der Hand des Schützen auch bei Nacht nicht fehlen. Auf ein größeres oder kleineres Loch in der Haut kommt es ohnedies nicht an.«
Dass die Preußen, die angeblich Deutsche sein wollten, ausgerechnet mit den Italienern gemeinsame Sache machten, das konnte im kerndeutschen Tirol absolut niemand verstehen. Deshalb richteten sich die Blicke eher noch zorniger gegen Norden als gegen Süden: »Und wenn wir diesen Krieg führen müssen, so wollen wir ihn nicht aufgeben, als bis die Zustände, aus denen er entsprungen, gründlich vernichtet worden, bis unser Feind im Norden auf ein Jahrhundert hinaus die Fähigkeit verloren haben wird, einen Bürgerkrieg anzufachen und deutsches Land an den Fremden zu verraten.« (Volks- und Schützenzeitung, 2. Mai).
Tirol, das seit 1797 wiederholt aus dem Süden bedroht war, sah sich durch die ungesättigte italienische Eroberungslust nun neuerlich in unmittelbarer Gefahr. Es waren erst 18 Jahre vergangen, seit am 18. März 1848 in Mailand der Aufstand gegen die österreichische Herrschaft ausbrach und lombardische Freischärler vom Südwesten her in Tirol einbrachen. Schon damals forderte der radikale Erneuerungspolitiker Giuseppe Mazzini die Brennergrenze für Italien. Gemeinsam konnten die österreichische Armee und die Tiroler Schützen den frechen Landnahme-Versuch der Italiener abwehren. 1859 galt es neuerlich, die Grenzen gegen die Welschen, gegen Garibaldis Freischaren zu schützen.
Das Tiroler Verteidigungswesen war seit dem Beginn der Neuzeit in Europa einzigartig. Mit dem »Landlibell« vom 23. Juni 1511 wurde die überkommene Ordnung des Tiroler Wehrwesens zusammengefasst und zeitgemäß adaptiert. Diese Wehrverfassung, ausgehandelt zwischen dem römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. und den Tiroler Landständen, sah vor, dass die Tiroler für die Verteidigung ihres Landes eigenverantwortlich sind, dass sie einfallende Feinde aus eigener Kraft und eigenen Stücken abwehren müssen. Als Gegenleistung für diese Pflicht waren sie fürderhin von jeglichem Kriegsdienst außer Landes befreit. Das Fundament für diese Regelung war der Patriotismus, die Liebe und Hingebung für das eigene Land. Maximilian wusste, dass Heimatverteidiger eine völlig andere Qualität besitzen als die zur damaligen Zeit üblichen Söldner, die ohne Skrupel zu jener Streitpartei überliefen, die mehr bezahlte. Das Tiroler System mit seinen Schützenkompanien in jedem Dorf bewährte sich auch noch im Kriegssommer 1866, als der italienische Feind erneut mit Waffengewalt an die Felsenpforten des Landes klopfte.
Am 8. Mai, als sich die Gebirgler schon eifrig auf den Waffengang vorbereiteten, sagte Graf Bismarck gegenüber einer ihn huldigenden großen Volksmenge in Berlin in seiner markigen Dankesrede: »Ich glaube, dass wir Alle gern bereit sind, für König und Vaterland zu sterben, sei es auf dem Straßenpflaster oder auf dem Schlachtfelde.« Mit dem »Straßenpflaster« dachte er vermutlich an jenen Anschlag auf ihn, als der Student Cohen-Blind nur wenige Tage zuvor auf offener Straße und aus direkter Nähe mehrere Revolverschüsse auf Bismarck abfeuerte. Der Ministerpräsident blieb (vermutlich zum Bedauern vieler seiner Gegner) unverletzt, da die Kugeln in seiner dicken Kleidung stecken blieben.
Am 7. Mai ließ der Preußenkönig in einer Ansprache an die Offiziere des ersten Garderegimentes in Potsdam schon deutlich erkennen, dass der Krieg gegen Österreich vor der Tür steht: »Die Aufgabe der Diplomatie sei erschöpft und der Augenblick gekommen, wo dem Schwerte die Entscheidung zufalle.« Der König versprach seinen Offizieren, dass er selbst an der Spitze der Armee deren Gefahren teilen werde.
Preußische Blätter echauffierten sich derweil über die auf der »allerniedrigsten Stufe der Kultur« stehende österreichische Zeitungspresse, die mit »abscheulichen Schmähungen« gegen das arme Preußen hetzt und sich im »Schlamm der Gemeinheit« wälzt. Es überrascht nicht, dass die österreichischen Blätter mit ähnlichen Wortkalibern konterten. Der erbittert geführte Krieg der Worte war schon Wochen vor den ersten Schüssen entbrannt. Die tagtäglich schärfer werdenden Töne aus dem Norden waren nicht nur auf die Österreicher gemünzt, sondern auch gegen die Sachsen. Berlin nahm diesen besonders übel, dass sie sich offen und von allen deutschen Staaten am klarsten auf die Seite Österreichs stellten. Der sächsische Ministerpräsident v. Beust wurde von der preußischen Presse permanent und vehement als Kriegstreiber und willfähriger Handlanger der Wiener Politik diffamiert, der die österreichischen Ziele – Preußen verkleinern, Sachsen vergrößern und Schlesien wiedergewinnen – bedingungslos unterstütze.
Als Beispiel für Österreichs Gier auf Schlesien erwähnte die »Lokomotive an der Oder« am 18. Mai die Karikatur in einer Wiener Zeitung, die zwei Tiroler Väter zeigt, die sich von ihren einrückenden Söhnen mit den richtungsweisenden Worten verabschieden: »Habt’s Acht, Ihr Buben, dös sag ich euch, dass Ihr mir nit heimkommt, ohne diesen malefiz Preußen Schlesien abgenommen zu haben.«
Das einhundert Jahre zuvor an Preußen verlorene Schlesien zurück zu gewinnen, davon war in Österreich offiziell keine Rede. Die in patriotischer Hochstimmung badende Presse zwischen Bregenz, Wien und Krakau hatte in dieser Besitzangelegenheit schon weniger Scheu, mit der Rückholung des einst von Preußen geraubten Landes zu liebäugeln.
Dem Bismarck wurde von seinen Gegnern gerne die Vorhaltung gemacht, dass er vielleicht »tatarisch«, aber keinesfalls deutsch handelte und dachte. Die Replik aus Preußen war in einer ähnlichen Preisklasse: »Was wird jetzt nicht alles getan, um den Fanatismus, ich will absichtlich nicht das andere Wort Patriotismus gebrauchen, der österreichischen Soldaten zu entflammen? Es werden bei den polnischen und böhmischen Regimentern eigens jetzt gedruckte Volkslieder verteilt, in denen die Soldaten aufgefordert werden, gegen die Preußen, welche die Mutter Gottes schmähen wollten, in das Feld zu ziehen und alle deutschen Hunde schonungslos zusammen zu schlagen. Gott gnade unserem Deutschland, wenn diese wilden, rohen fanatisierten slawischen Massen, die Österreich jetzt gegen uns in Bewegung setzt, wirklich bei uns einbrechen sollten!« (Lokomotive an der Oder, 19. Mai).
Ende Mai sanken die Aktienkurse an den Börsen in Frankfurt und Wien ins Bodenlose. Deutlich anders wirkte sich die Kriegsgefahr für das gewerbliche Handwerk aus. Die Auftragsbücher der Gewehrfabrikanten, Büchsenmacher, Riemer, Sattler und Wagner waren bis zur letzten Seite voll. Die Lieferzeiten wurden von Tag zu Tag länger. Der Lederpreis stieg um 25 Prozent und der Hafer verteuerte sich innerhalb weniger Wochen sogar um 100 Prozent. Die österreichische Armee kaufte in einer ersten Tranche 60.000 Pferde an.
In Bayern wunderten sich die Leute einmal mehr über ihren König Ludwig, der in einer Zeit der fieberhaften Rüstung und des Mobilisierens, als auch vom Mittelstaat Bayern eine klare Position in der »deutschen Frage« erwartet wurde, wenig Interesse an seinem eigenen Heer zeigte, und der statt dessen lieber mit einem Extrazug ins schweizerische Luzern zu seinem Freund Richard Wagner fuhr, um mit diesem in künstlerischen Visionen zu schwelgen.
Währenddessen begannen Tausende unzufriedene Untertanen des bayerischen Königs einen »Volkskrieg« wegen einer als Frevel empfundenen Bierpreiserhöhung. Zahlreiche Münchner Brauhäuser, insbesondere in der Sendlingerstraße und Neuhausergasse, wurden am Abend des 1. Juni vom Mob gestürmt und demoliert. Erst mehreren Kompanien Soldaten gelang es nach Stunden des Radaus, die Ruhe und Ordnung in der Isarstadt wieder herzustellen.
Der Advokat Dr. Hundegger im steirischen Murau lobte 100 Gulden für denjenigen österreichischen Krieger aus, »der den Grafen Bismarck ergreift, und sei es allein oder mit Hilfe Anderer, sei es mit ganzem oder durchlöchertem Fell, sei es tot oder lebendig zum Gefangenen macht«. (Innsbrucker Nachrichten, 4. Juni).
An jenem 4. Juni, einem Montag, als diese kuriose Kopfgeld-Auslobung zu lesen war, wurde das Publikum auch darüber informiert, dass Österreich – laut offizieller Erklärung – die Rüstungen gegen Preußen »abbestellen« werde, sobald es wieder Sicherheit gegen die Kriegsgefahr erlange. Gleichzeitig erklärte sich auch Preußen bereit, auf den »Friedensfuß« zurückzukehren, wenn der Deutsche Bund Österreich und Sachsen zur »Abstellung« der Rüstungen bewegen kann.
Am gleichen Tag rückte der Gefreite Theodor Vatke mit seiner Truppe von Berlin an die einige hundert Kilometer entfernte preußisch-österreichische Grenze in Niederschlesien ab. Der Bahntransport bis Brieg erfolgte erst ab der Stadt Sommerfeld in der Niederlausitz, bis dorthin wurde marschiert. Schon auf den ersten Kilometern außerhalb Berlins entwickelte sich der Marsch in Richtung Krieg zur Tortur, wie der preußische Gefreite in seinen 1867 erschienenen Erinnerungen »Mein Sommer unter Waffen« schrieb:
»Immer wieder hinausgeschoben, war der Tag unseres Ausrückens aus Berlin mit dem 4. Juni nunmehr herbeigekommen. Seit dem 9. Mai waren wir Reservisten wieder bei unserm Kaiser-Franz-Regiment eingezogen worden. Mehr als drei Wochen militärischer Übungen lagen hinter uns. Der Vorabend unseres Abmarsches war bei Vielen in übermütiger Ausgelassenheit verstrichen, während Andere, Abschiedslieder, oft weicher Art, zu singen, bei einander saßen: ich hatte es vermieden, dabei zugegen zu sein; der noch heiteren Stimmung glaubte ich nicht recht Herr zu bleiben unter solchen Klängen. Die Nacht in der Kaserne, auf ungewohntem Strohlager zugebracht, hatte nicht viel Ruhe und Schlaf bringen können. Und so standen wir denn in früher Morgenstunde des 4. Juni, nur wenig gestärkt, in Reih und Glied. Der Kasernenhof füllte sich allmählich mit Angehörigen der Soldaten. Die Offiziere sahen sich genötigt, die Damen zu ersuchen, die militärische Ordnung nicht zu stören. Die »Vergatterung« war geschlagen: wir standen unter Kriegsartikeln; die in ganz neuen Uniformen glänzende Kolonne setzte sich in Bewegung, während besonders der weibliche Teil der Begleitenden doch nicht überall den Tränen Einhalt zu gebieten vermochte.
Von der Hasenheide bis zum Frankfurter Tor war bereits eine heiße Strecke; die beträchtliche Last des marschmäßig beschwerten Tornisters erhöhte nicht wenig der gerollte Mantel: die Brust ist gedrückt, das Atmen erschwert. Am Tore hielt um 6 Uhr Se. Majestät Revue über uns ab. Berlin lag hinter uns, die sandige Mark, eine ungewisse Zukunft tat sich vor uns auf. Allmählich waren die uns Begleitenden umgekehrt, die Gespräche wurden sparsamer, immer unbehaglicher fühlte man sich – wir hatten 23 Grad im Schatten – auf der schattenlosen Chaussee, deren aufgewirbelten, heißen Staub wir in beengtem Atem fast ununterbrochen zu uns nehmen mussten. »Welche Wonne jetzt eine Kugel!« hörte ich jemand sagen. Nach mehrstündigem Marsche, der schon Manchen in den Chausseegraben geworfen, ward, beinahe mitten im Sonnenbrande, ein Halt von wenigen Minuten gemacht, welches nicht sehr dazu beitragen konnte, der Erschöpfung wieder Herr zu werden. Doch wurde in Mützen weitermarschiert, die Helme an den Mantel gehängt: eine bedeutende Erleichterung! Mir und vielen Anderen konnte dieselbe indes nicht mehr helfen: das Blut drang so stark zum Herzen hinauf, dass ich einen Blutsturz nahe glaubte, auf der Brust fühlte ich so heftige Schmerzen, wie ich dieselben niemals gekannt hatte. Mehr und mehr füllten sich rechts und links die Chausseegräben; man sah die Lazarettgehilfen herbeieilen, den Ohnmächtigen den Kragen zu öffnen, die Brust vom Tornister zu befreien, die Stirn mit Salmiakgeist zu reiben. In seiner 16jährigen Dienstzeit, sagte ein Offizier, habe er eine so allgemeine Ermattung nicht erlebt. Auch ich unterlag der Beschwerde und hunderte gleich mir. Viele Gespanne wurden teils aus Berlin, teils aus den Dörfern requiriert. In Kurzem hatte ich mich indes soweit erholt, den Wagen wieder zu verlassen, den Fußkranken den Platz einzuräumen: doch ließ ich den Tornister auf dem Wagen zurück, da mir nur die furchtbare Spannung auf der Brust, die derselbe erzeugte, nicht das Marschieren schmerzlich war. Und so erreichte ich das Bataillon denn kurz vor dem Einmarsch in Rüdersdorf, unserem Ziele am 4. Juni. Als wir um die letzten Sand- und Kalkhügel in den ausgedehnten Ort einbogen, so stürzte wieder Einer zusammen: man trug ihn für tot fort. So verlief der erste Marsch: wenig einladende Pforten zu niederschlagenden Aussichten hatten sich vor uns eröffnet. Die heißen, ungewohnten und eintönigen Märsche durch die Mark waren die trübsten des ganzen Feldzuges: nicht durch hervorragende Naturschönheiten oder das Bewusstsein der Teilnahme an großen Dingen wurden diese Mühen gemindert, welche doch andererseits das Gute hatten, die geistige Frische zu nehmen, uns mit den immer wieder anders lautenden Gerüchten über Krieg und Frieden zu beunruhigen.«
HOLSTEIN – DER ZÜNDFUNKE IM PULVERFASS
Um »gut Wetter« bei den deutschen Klein- und Mittelstaaten zu machen und um diese (zumindest die meisten) in der vor der Tür stehenden »heißen« Phase im Machtkampf zwischen Österreich und Preußen an der eigenen Seite zu wissen (und vor allem auch, da Österreich infolge einer Reihe von preußischen Provokationen an den Grenzen Holsteins die Geduld verlor), widerrief die österreichische Regierung die im Vorjahr vereinbarte Teilung und übertrug die schleswig-holsteinische Frage am 1. Juni an den Bundestag in Frankfurt. Die Klein- und Mittelstaaten waren ja schon immer gegen den aus der Arroganz von Großmächten heraus praktizierten preußischösterreichischen Alleingang in der Frage der Elbherzogtümer. Für den 11. Juni berief Österreich die Landstände Holsteins nach Itzehoe ein, um deren Wünsche zu hören. Die Landstände sollten möglichst auch den »Augustenburger« zum Herzog ihres Landes ausrufen (mit entsprechender machtpolitischer Sogwirkung natürlich auch für Schleswig). Durch Österreichs – aus Berliner Sicht – perfiden Akt sah Preußen an der Eider und an der Schlei seine Felle davonschwimmen und klagte de jure zu Recht, dass Österreichs Vorgehen in Frankfurt einen Bruch des Vertrages von Gastein darstellt, der vorgesehen hatte, dass die schleswig-holsteinische Frage nur von Preußen und Österreich einvernehmlich und unter Ausschaltung sonstiger Beteiligter gelöst werden dürfe.
Insgeheim freute man sich in Berlin über den einseitigen Schritt Österreichs, denn nun konnte man den Beleidigten und Betrogenen spielen und die ungeliebte »Gasteiner Konvention« war auch wieder vom Hals. Ohne Umschweife machte Preußen nun »Nägel mit Köpfen« und ließ am 7. Juni seine Truppen in Holstein einmarschieren. Die 3000 österreichischen Soldaten dort waren von 20.000 preußischen förmlich umstellt. Durch eine Depesche erfuhr der »Tiroler Bothe« noch am selben Abend von dieser ernsten Sache, die als Brandbeschleuniger in der preußisch-österreichischen Konfrontation wirken wird: »Die Preußen sind heute in Holstein eingerückt. Die Österreicher haben sich unter Protest nach Altona zurückgezogen. Daselbst befindet sich auch die Landesregierung und der Herzog von Augustenburg.«
In Tirol und auch anderswo waren sich die Leute sicher, dass durch diesen rigorosen Schritt Preußens – sozusagen durch das Überschreiten des Rubikon – die österreichische Nordarmee unter Feldzeugmeister Ludwig August Ritter von Benedek sofort vorrücken und sich das »im Riesengebirge an den Quellen der Oder angesammelte Ungewitter nach Preußen hinüberwälzen würde«. Zur Enttäuschung vieler, regte sich in Böhmen jedoch nichts. Die aus Holstein abgerückten 3000 Mann wurden mit der Bahn über die Territorien der Königreiche Hannover und Sachsen zur Nordarmee in Böhmen transportiert. Jedenfalls hatten nun beide Streitparteien den Gasteiner Vertrag des Vorjahres zu Makulatur gemacht.
Der zu sonstigen Zeiten eher träge Bundestag in Frankfurt wurde in diesen Tagen von allen Seiten aufgescheucht. Durch den preußischen Gesandten ließ Bismarck dort am 10. Juni einen neuen Verfassungsentwurf für den (schon ziemlich maroden) Bund präsentieren, der einen erneuerten Deutschen Bund unter Ausschluss Österreichs vorsah.
Der damals 26-jährige Vorsitzende des Leipziger Arbeiterbildungsvereins (und spätere Mitbegründer und Führer der sozialdemokratischen Arbeiterpartei) August Bebel hielt in Frankfurt eine flammende Rede gegen Bismarck und die Politik Preußens, das er des Wortbruches und der Sucht nach Landraub zieh: »Ist das Preußen des Herrn von Bismarck mit seiner Missachtung von Recht und Verfassung der Staat, zu dem das deutsche Volk Vertrauen haben kann? Sicher nicht! Und dieses Preußen will man jetzt an die Spitze Deutschlands stellen, den Staat, der nach seiner ganzen Geschichte mit Ausnahme jener Periode von 1807 bis 1810, wo er zerschmettert am Boden lag, nie ein liberaler Staat gewesen ist und nie ein solcher sein wird! Wer anders darüber urteilt, kennt Preußen nicht!«