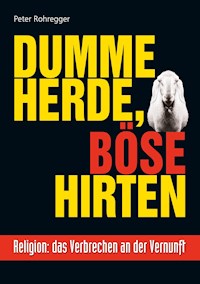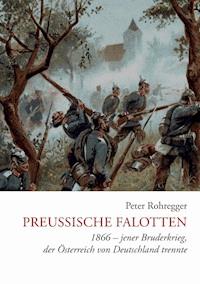Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein abwechslungsreicher geschichtlicher Report des Historikers Peter Rohregger, der den "Zeitgeist" und die gesellschaftliche Befindlichkeit vor 100 Jahren am Beispiel der Kriegsstimmung im Tiroler Unterinntal sehr nahe bringt. Nicht die Chronologie der schon ausreichend dokumentierten militärischen Vorgänge während des Ersten Weltkrieges steht im Vordergrund dieses Buches, sondern der damalige Blick auf regionale und ferne Ereignisse aus der heimatlichen Perspektive. Die lokale Presse gefiel sich als Taktgeber der patriotisch gefärbten Meinungsbildung und beschäftigte sich mit dem kriegswichtigen Sammeln von Maikäfern als Hühnerfutter ebenso journalistisch pflichtbewusst wie mit jenen ehrlosen "Schandweibern", die sich gegenüber kriegsgefangenen Russen allzu freundlich benahmen. Den "internationalen" Rahmen der medialen Berichterstattung bildete naturgemäß das Kriegsgeschehen und hier vor allem der gerechte Kampf gegen das "welsche Gesindel" und die "slawischen Barbaren". Dieses Buch ermöglicht eine aufschlussreiche Begegnung mit jener Zeit, als das Kriegsfieber die Heimat, Europa und einen großen Teil der Welt erfasste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. k. 56. Standschützendivisionskommando, Divisionskommandobefehl Nr. 163, Feldpost 486, am 14. Juni 1918:
»Der [Kramsacher] Standschütze Josef Moser der Standschützenkompanie Rattenberg hat eine Brieftaube des Feindes, die sich im Fluge von Sotto Castello gegen die Zugna befand, mit der Kugel abgeschossen. Die Taube wurde samt Meldehülse erbeutet. Ich spreche dem Standschützen Josef Moser für diesen Meisterschuß meine vollste Anerkennung aus. Eine Prämie von 10 Kronen wird ihm ausgezahlt.«
v. Kroupa, FML
***
Eine französische Brieftaube, die unter schwierigsten Bedingungen eine wichtige Nachricht aus dem von den Deutschen eingeschlossenen Festungswerk Fort Vaux bei Verdun ausflog und einer höheren Kommandostelle überbrachte, wurde für ihre Leistung mit dem höchsten Orden belohnt, den die Republik Frankreich zu vergeben hatte. Die Ehrung musste posthum erfolgen, da die tapfere Taube noch am Tag ihres Kurierfluges den Einwirkungen deutschen Giftgases erlag.
Amtliche Definition einer Brieftaube durch das Schweizer Militär:
»Ein sich selbst reproduzierender Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter Rückkehr aus beliebigen Richtungen und Distanzen.«
Um die Authentizität der verwendeten Originaltexte zu bewahren, wurde hier die alte Rechtschreibung weitgehend übernommen.
Inhalt
Vorbemerkung
Slawische Barbaren
Welsches Gesindel • Wetterleuchten • Der Deutsche Geist
Brennender Balkan
Rauflustige Völker • Der nächste Krieg • Den schlafenden Löwen reizen
Ein freisinniges Blatt
Der »Tiroler Grenzbote« • Überfremdung • Lokalnachrichten
Jener Sonntag in Sarajewo
Kufstein trauert um den Thronfolger • Hoffentlich Krieg • Wann donnern endlich die Kanonen?
Jetzt doch ein Weltkrieg?
Serbien wird zweitrangig • Abschiednehmen im Unterinntal • Hochbetrieb in der Sparkasse
Spionagehysterie
Ein Russe auf der Kragenalm • Franzosengold • Jeder Hausknecht ein Spitzel
Die Verteidigung des Guten
Reichlich »Weihbrunn« spritzen • Schlecht gerüstet • Ausrotten und vernichten
Die Fratze des Krieges
Blamabler Rückzug • Bitterböses aus Serbien • Feuertaufe der »Blumenteufel«
Finsteres Russland
Großdiebe und dumme Bauern • Rote Patrioten • Der »Iwan« in Schwaz
Jeder Stoß – ein Franzos!
Den »Erbfeind« besiegen • Paris in Sicht • Fort mit der Franzosenmode
»Suppe sährr gutt!«
Die Festung Kufstein als Internierungslager
Meldungen von der Front und aus der Heimat
Tabula rasa in Ostpreußen • Länderkunde in der Wohnstube • Tratschweiber und Kleinanzeigen
Die »Journaille« im Krieg
Das schreckliche Johlen der Tiroler • Schaumwein statt Champagner
Sturzbäche aus Eisen und Blut
Am Rand der Niederlage in Galizien • Ein Zillertaler im Kampfgetümmel • Würdelose Zivilisten
Der Kaiser braucht Geld
Die hochverzinste Kriegsanleihe
Belgrad erobert
Verfrühter Jubel • Ein Held aus Brandenberg • Flaggenärger in Kufstein
Kriegsweihnacht
Reger Besuch der Gaststätten • Flugpost aus Przemysl
Karpatenwinter
Die Stunde der Wölfe • Kufstein feiert Hindenburg
Gut zu wissen
Hinrichtungen • Trickbetrüger • Rodelverbot
Morgenröte in Galizien
Ausgehungert • Schlappe Österreicher • Tapfere Tiroler
Räuberisches Italien
Der neue Krieg • Kampfbereitschaft der Standschützen • Besuch aus Kufstein an der Front
Siegeszug im Osten
Lemberg ist wieder unser • Ein letzter Versuch der Russen • Vor einem Jahr
Das Strafgericht Gottes
Der Kriegseifer des Klerus • Die gute Seite des Krieges • Freier Zutritt in den Himmel
Unmoral in Zeiten des Krieges
Gewisse Frauen in Kufstein • Kriegsgefangene und »Schandweiber« • Für einige Zigaretten
»Reicht die Hände euch, Germanen …«
Der Anschlusswille der Tiroler
Anhang
Erinnerungen eines jungen Österreichers an den Kriegsbeginn
Standschütze Bruggler
Toblach im Pustertal, Mai 1915
Chronik des Ersten Weltkrieges mit besonderer Berücksichtigung Österreich-Ungarns
Anmerkungen
Bibliographie
Vorbemerkung
»Wenn sich die Zillertaler Bauern auf die Juden berufen (wie man zuweilen hört), die ebenfalls wuchern, so ist dies in keiner Weise begründet. Die Juden sind eben Juden und daß sie die Völker, bei denen sie Gastfreundschaft genießen, beschummeln und ausbeuten, das ist in ihrer Rasse und in ihren talmudistischen Sittenregeln begründet. Die Zillertaler sind aber doch Tiroler, sind Christen und wollen als fromme Leute gelten!«
Am 23. Februar 1918 konnten die Leser des in Kufstein erschienenen Tiroler Grenzboten etwas über den wucherischen Charakter der Zillertaler erfahren. Der Erste Weltkrieg quälte Europa seit dreieinhalb Jahren und von der zu Kriegsbeginn so oft beschworenen und gefeierten Volksgemeinschaft und Solidarität war auch in Tirol nur mehr wenig zu spüren. Insbesondere der Mangel an Grundnahrungsmitteln und die rasant nach oben schnellenden Preise ließen sowohl den individuellen als auch den kollektiven Egoismus erblühen. Die Bauern wollten ihre Produkte nicht mehr nach Innsbruck und andere urbane Zentren liefern, denn deutlich höhere Gewinnspannen ließen sich erzielen, wenn die hungernden Stadtleute als Bittsteller in die Dörfer kamen. Im Zillertal wurde die Notlage der nichtbäuerlichen Bevölkerung offenbar besonders schamlos missbraucht und die Preistreiberei bei den Lebensmitteln auf die Spitze getrieben. Aber nicht nur die exzessive Geschäftstüchtigkeit der Landwirte ärgerte die Leute, auch die Schikanen der Behörden und der Exekutive gegenüber den »kleinen Leuten«, die zum Hamstern in die Dörfer gingen oder fuhren, um das Überleben der Familie zu sichern, sorgte für böses Blut und schwächte das patriotische Hochgefühl. Als publizistisches Sprachrohr des Volkes im geographischen Raum zwischen Rofan und Kaisergebirge prangerte der Tiroler Grenzbote am 13. März 1918 zum wiederholten Mal das schikanöse Verhalten der Obrigkeit gegenüber den hungernden »Untertanen« an:
»Es gibt bekanntlich ein Sprichwort, das besagt: Die kleinen Diebe hängt man, die großen läßt man laufen. Noch nie ist es so zur Wahrheit geworden, als während der Kriegszeit, da man behördlicherseits versucht, den Schleichhandel und das Hamstern von Lebensmitteln zu verhindern. Die großen Spitzbuben und jüdischen Kettenhändler, die die Ware zentnerweise verschleppen und gewerbsmäßig zu Wucherpreisen verkaufen, werden höchst selten von dem Auge des Gesetzes erblickt; dafür wacht es aber um so schärfer über den kleinen Leuten, die tatsächlich am Hungertuche nagen und ab und zu das Glück haben, ein Bröcklein Butter, ein paar Eier oder eine Flasche Milch gegen Geld und hundert gute Worte zu erwischen, um der Familie daheim, besonders den bekanntlich immer hungrigen Kindern, das schwierige Durchhalten zu erleichtern.«
Die »Lebensmittelabweidung« durch nicht ortsansässige Personen wurde während des Krieges ein zunehmend brisanteres Thema. So ärgerten sich die Kufsteiner im Sommer 1917, dass »vier ziemlich beleibte Damen aus Wien, die hier in Privat wohnen, täglich zusammen 8 Liter Milch bekommen!«
Die tagtägliche Sorge um das nächste Stück Brot verschob die gesellschaftspolitischen Prioritäten in den späteren Kriegsjahren. Der patriotische Fiebertaumel und die überschwängliche Kriegsbegeisterung des Sommers 1914 waren unter dem Druck des realen Erlebens nun deutlich abgekühlt. Das im Angesicht der kriegerischen Herausforderungen vorerst triumphierende WIR-Gefühl löste sich im Morast der Egoismen auf. Gleichzeitig wurde die Sprache gegenüber der Obrigkeit und den Behörden aufmüpfiger.
In den Seiten der heimischen Presse spiegeln sich diese Veränderungen sowie die Hoffnungen und Enttäuschungen während der Kriegsjahre wider. Gegenüber den Feinden war die Sprache anfänglich vollgepackt mit siegesgewisser Überheblichkeit. Als der Krieg nach einem Jahr immer noch nicht gewonnen war und das treulose Italien als neuer Gegner das Schlachtfeld betrat, färbte sich die öffentliche, mediale und auch private Sprache mit verbissenem Trotz, nach dem Motto: »Jetzt erst recht!« Ab 1916, als die inneren und äußeren Schwächen der österreichisch-ungarischen Monarchie für jedermann zunehmend erkennbarer wurden, galt der Zorn des Volkes und der Presse nicht mehr nur dem ausländischen Feind, sondern in etwas geringer dosierter Form (die Zensur war zu beachten) auch den Eliten und Verantwortlichen des eigenen Staates. Das Spannungsfeld zwischen Staatstreue und Staatsver druss zeigte sich nicht zuletzt auch auf der regionalen Ebene. Das »Lokalkolorit« – die unterschiedlichsten Ereignisse und Herausforderungen des Kriegsalltages – bildet neben dem Kriegsgeschehen (insbesondere jenem der ersten zwölf Monate) ein tragendes Fundament des Inhaltes dieses Buches, um dadurch verschiedene Elemente des Ersten Weltkrieges aus einem lebensnahen und somit sehr direkten Blickwinkel zu be schreiben. Die Darstellung der Geschehnisse sowohl im heimatlichen Bereich als auch draußen an den Fronten ist durch ausgewählte Textpassagen aus dem Tiroler Grenzboten (Halbwochenschrift für Stadt und Land) informativ und unterhaltsam angereichert. Zum Krieg, dieser »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«, wird dadurch ein Zugang geöffnet, der nun 100 Jahre später einen schon nahezu indiskreten Einblick in das Geschehen erlaubt.
Als Italien am 23. Mai 1915 an Österreich-Ungarn den Krieg erklärte, bedeutete dies für das direkt bedrohte Tirol eine besondere Zäsur. Der Kriegsausbruch wiederholte sich, allerdings ohne die überbordende Begeisterung vom Sommer 1914. Auch die Standschützen-Bataillone Rattenberg und Kufstein wurden rasch mobilisiert und an die Tiroler Süd grenze befördert, um dem welschen Feind das Eindringen in die Heimat zu verwehren. Die Zeitungsberichte aus diesen dramatischen Tagen, als der Tiroler Heldenmythos eine neue Qualität erhielt, erweitern das originalgetreue Stimmungsbild jener Zeit und ermöglichen uns eine aufklärende Annäherung an die Zeit des großen »Weltenbrandes«.
Mag. Peter Rohregger
Slawische Barbaren
Welsches Gesindel • Wetterleuchten • Der Deutsche Geist
Im »tiefsten Negligé« wurde Draga Maschin von ihren Mördern überrascht. Diese Schreckensnachricht, die Erstaunen, Sensationsgier und Entsetzen auslöste, konnten die Leser des Tiroler Grenzboten am 14. Juni 1903 auf der Titelseite ihres Heimatblattes finden. Während die Sensationsgier sich am Fast-Nacktsein der serbischen Königin delektierte, bot die außergewöhnliche Brutalität dieses politisch motivierten Ver brechens dem Entsetzen reichlich Nahrung. Durch die »Blutnacht« von Belgrad wurde schon elf Jahre vor den Schüssen in Sarajewo einer jener Meilensteine des Schicksals gemeißelt, die den Weg zum Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien in zunehmend kürzeren Abständen säumten.
In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1903 stürmte eine Horde ultranationalistischer serbischer Offiziere in die Wohnräume des 27-jährigen serbischen Königs Alexander und dessen zehn Jahre älteren Gattin Draga und ermordete die beiden auf bestialische Weise. Die Leichen des Königspaares, die Mitarbeiter der russischen Botschaft am Morgen des 11. Juni auf dem Rasen der Residenz (dem Konak) fanden, waren durch unzählige Säbelhiebe und Pistolenschüsse nahezu bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt und entstellt. Der Blutrausch, der an dieser Mordorgie beteiligten annähernd 50 Offiziere, ließ für die künf tigen serbischen Humanitätsideale nichts Gutes erhoffen.
Die Mehrheit der Serben begrüßte und feierte dieses grässliche Verbrechen, durch das die Macht der Obrenovic ein jähes und dramatisches Ende fand und Peter Karadjordjevic aus dem Schweizer Exil zurückgerufen und umgehend vom Parlament als Peter (Petar) I. zum neuen König gewählt wurde. Am Tag nach den Morden waren die Straßen Belgrads mit Flaggen geschmückt.
Einig war sich die österreichische Presse über den geringen Zivilisationsgrad der Serben, einer »herzlosen« Nation mit einer langen Tradition der Gewalt: »Bei dieser Gelegenheit ist, wie zu erwarten war, die slawische Grausamkeit und Barbarei wieder einmal zum vollen Durchbruch gekommen.«1
Die meisten Serben hassten Draga Maschin. Das Volk gab ihrem angeblich schlechten Einfluss auf Alexander die Schuld, dass der König allmählich zum autoritär und selbstherrlich herrschenden Despoten wurde. Die Bergingenieurswitwe Draga war in Belgrad als Lebedame und (in einer weiteren rhetorischen Eskalationsstufe) als »Hure« ver schrien. Der frühere serbische Ministerpräsident Georgevic lästerte: »Draga Maschin! Ihr Leib war Gemeingut, ihre Vergangenheit stadtbekannt, von beiden Elternseiten her belastet – denn der Vater starb im Belgrader Irrenhaus, die Mutter war eine Trinkerin – jeder wusste: eine hitzige Dirne.«2
Auch große historische Ereignisse, wie der Erste Weltkrieg, gründen sich aus einem Quantum Absichten sowie einem Bündel Zufälligkeiten und Banalitäten. Durch den Doppelmord in Belgrad wurden die poli tischen Karten auf dem Balkan zu Ungunsten Österreichs neu gemischt. Die Weichenstellung der serbischen Außenpolitik führte ab nun definitiv weg von Österreich-Ungarn – hin zu Russland. Fortan liebäugelten die Serben mit den mächtigen Russen, und diese spielten sich zunehmend grimmiger als die Schutzherren der christlichen Slawen auf der Balkanhalbinsel auf. Österreich und das imperial sich gebende Zarenreich konkurrierten um das Erbe des maroden Osmanenreiches auf dem permanent brodelnden Balkan.
Bis zur Belgrader »Blutnacht« leitete die eher österreichfreundliche Dynastie der Obrenovic die machtpolitischen Geschicke in dem noch kleinen Balkanland. Diese hatten noch nicht vergessen, dass sich Serbien im 19. Jahrhundert nur deshalb etappenweise von den Osmanen emanzipieren und befreien konnte, weil das große und starke Österreich seit der Befreiung Wiens von den Türken im Jahr 1683 diesen muslimischen Aggressor Schritt für Schritt wieder in Richtung Orient zurück trieb. Österreich war aktiv daran beteiligt, dass das erst seit dem »Berliner Kongress« wirklich freie und selbständige Fürstentum Serbien von der Staatengemeinschaft ab dem Jahr 1882 als Königreich anerkannt wurde.
Nicht nur Belgrad zog am Beginn des 20. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der europäischen Öffentlichkeit auf sich. Einige hundert Kilometer weiter südlich flossen Ströme von Blut, als sich die Mazedonier (Makedonier) am Sankt-Elias-Tag des Jahres 1903, dem 2. August, mit Waffengewalt gegen ihre türkischen Herren erhoben. Russland wagte es (noch) nicht, die Aufständischen nennenswert zu unterstützen, da Österreich dagegen war, dass der russische Bär zu weit in den Balkan, dem Interessensgebiet (den Hinterhof) des Habsburgerreiches, hinein schnüffelte. Die Türken, deren Großreich zunehmend an Auszehrung litt, schlugen den Aufstand der christlichen Mazedonier (deren ethnische Herkunft vielfach bulgarisch war) mit bemerkenswerter Brutalität nieder. Nur so nebenbei kamen annähernd 5000 Zivilisten ums Leben und etwas mehr als 3000 Frauen und Mädchen wurden von der tollwütigen Soldateska vergewaltigt. Wie der Washingtoner Journalist Robert D. Kaplan in seinem Buch Die Geister des Balkans schrieb, vergewaltigten im Norden Mazedoniens fünfzig türkische Soldaten »ein und dasselbe Mädchen, bevor sie es töteten«.
Wer wollte, konnte in den heimischen Zeitungen viel über die Raufhändel auf dem Balkan lesen. Dass eine starke Hand (natürlich Österreich) da unten – wie vormals 1878 in Bosnien – ordentlich aufräumen und Ruhe schaffen sollte, diese Forderung wurde von den Schreiberlingen in den Redaktionsstuben gerne und oft gestellt. Gleichzeitig musste sich vor allem die Tiroler Presse mit einem ärgerlichen Volkstumsproblem im heimatlichen Umfeld beschäftigen. Zur gleichen Zeit, als der serbische König Alexander in seinem Blut lag und Mazedonien (Makedonien) brannte, fühlten sich die Tiroler vom Ansturm der angeblich allzu vielen hier arbeitenden und studierenden Italiener bedroht. Die meisten dieser ungeliebten und unwillkommenen »Welschen« (Walischen) waren österreichische Staatsbürger und somit Landsleute, da sie aus dem südlichen Teil Tirols kamen. Als nichtdeutsche Tiroler (Welschtiroler) waren sie der Bevölkerung nördlich der Salurner Klause von vornherein suspekt. In den Alltagsgesprächen fehlte meist die Klage nicht, dass die Katzelmacher (Gatzelmacher) die »Deutschen« aus den guten Arbeitsplätzen drängen, dass diese Schufte die gleiche Arbeit für eine deutlich geringere Löhnung machen. Die Unternehmer wurden von der Presse und der Allgemeinheit gerügt, dass sie aus Profitgier sehr unpatriotisch dieses böse Spiel mitmachen. Viele italienische Österreicher, aber auch Männer aus Reichsitalien verdienten sich ihr Brot mit gefährlichen und überaus strapaziösen Arbeiten, die für andere Stellensuchende wenig attraktiv waren, etwa bei der Verbauung von Wildbächen oder beim unfallträchtigen Bau der Arlbergbahn. Jedenfalls wurden diese romanischstämmigen in- und ausländischen »Gastarbeiter« von der einheimischen Bevölkerung in der Regel misstrauisch beäugt. Im Frühjahr 1902 fanden es die Zillertaler »befremdend«, dass für die Verbauungsarbeiten am Märzenbach in Stumm hauptsächlich Welsche angestellt wurden, dabei schleppten diese ja das Verbrechen ins Tal, wie aus einer Zeitungsmeldung vom 9. März 1902 für jedermann erkennbar war: »In der vergangenen Woche hat ein in den 30er Jahren stehender, vacierender italienischer Malergehilfe in Stummerberg an drei Kindern im Alter von 4, 5 und 9 Jahren unzüchtige Handlungen vorgenommen. Der ruchlose Mensch, dem, wie es scheint, ähnliche Delicte, begangen in Zell und Uderns, nachgewiesen werden, wurde dem k. k. Bezirks-Gerichte in Zell am Ziller eingeliefert.«4
Als im Jahr 1904 durch die geplante Errichtung einer italienischsprachigen Fakultät an der deutschen Universität Innsbruck im ganzen Land ein wütender Sturm der Entrüstung aufbrandete, zeigten sich viele Gemeinden und Kommunen hinsichtlich der Sorge der deutschen Stadt Innsbruck vor der »Verwelschung« solidarisch. In der Rattenberger Gemeindesitzung am 18. November 1904 wurde folgende Resolution einstimmig angenommen:
»Die Stadt Rattenberg, in deren Festungsmauern durch welsche Tücke das deutsche Haupt des Kanzlers Dr. Wilhelm Bienner unter Henkershänden fiel, ist eingedenk des alten Kampfes zwischen Deutschen und Welschen in Tirol und erklärt sich in der heute stattgefundenen Gemeinde-Ausschußsitzung einig mit der Landeshauptstadt Innsbruck und der hochverehrten Stadtvertretung, den Bürgern und deutschen Studenten im Kampfe gegen das Welschtum.«5
Die deutschtiroler und italienischen Studenten in Innsbruck prügelten sich immer öfter. Auf der Straße und in der Universität sangen die einen die »Wacht am Rhein« und die anderen stimmten die »Garibaldi-Hymne« an. Innsbruck fieberte im Nationalitätenstreit, und nicht nur in der Landeshauptstadt fürchtete man sich vor der »Verwelschung« Tirols: »Nach dem Herzen Tirols lüstet es ihn [dem welschen Nationalismus] und wahrlich wunderlich sind die Wege, die er sich zur Erreichung seines Zieles gezeichnet hat. Als demutsvoller, unterwürfigster Gast betrat er die deutschen Gaue und nun er sich erstarkt sieht, wirft er die Maske ab und zeigt sich in seiner wahren Gestalt.«6
Der seit Wochen die Zeitungsschlagzeilen beherrschende russisch-japanische Krieg wurde im Spätherbst 1904 notwendigerweise auf kleinerer publizistischer Flamme gekocht, da in der Nacht vom 3. zum 4. November die Krawalle in Innsbruck einen blutigen Höhepunkt erreichten:
»Abends kam es in der Herzog-Friedrich-Straße zwischen den wie immer in herausforderndster Weise auftretenden Welschen und den Deutschen zu Reibungen. Die feindlichen Parteien standen sich gegenüber und Schimpfworte flogen herüber und hinüber. Da plötzlich krachten aus dem Haufen der Welschen Revolverschüsse (es sollen gegen 200 Schüsse abgefeuert worden sein). Ein Wachmann und neun andere Personen wurden verwundet. Nun gabs kein Halten mehr. Die Deutschen stürzten sich auf die feigen Mordbuben, die natürlicherweise sofort zu flüchten versuchten. Ein Teil warf sich in die Gasthäuser »zur goldenen Rose« und »zum weißen Kreuz«, ihre gewöhnlichen Zufluchtsstätten, ein Teil wurde unter dem Schutze von Polizeimannschaften nach dem Rathaus und dem Oberlandesgerichte geführt. Aber dem Ansturm der erbitterten Menge und der jetzt mobilisierten deutschen Studentenschaft waren die Wachmannschaften nicht gewachsen, so kam es, daß die Italiener, wo sie auch hinflüchteten, ausgiebige deutsche Hiebe erhielten. Plötzlich rückten in diesem Tumult zwei Kompagnien Militär an, eine Kaiserjägerkompagnie und eine Kompagnie des 14. Infanterie-Regiments. Die Kaiserjägerkompagnie hat sich dabei traurigen Ruhm erworben. Ohne jeden Anlaß ging sie im Sturmschritt mit gefälltem Bajonett gegen die entsetzt flüchtende Menge vor. Der bekannte jugendliche Maler August Pezzey erhielt dabei einen tödlichen Bajonettstich in den Rücken, dem er nach wenigen Minuten erlag, ein anderer Herr wurde ebenfalls durch einen Bajonettstich schwer verwundet. Außerdem kamen zahlreiche leichtere Verwundungen durch Bajonettstiche von hinten vor. Dieser unerhörte Vorgang, diese Brutalität hat die Empörung aufs Höchste gesteigert. […] Jetzt herrscht in Innsbruck nur eine Meinung: Nieder mit den Welschen, fort mit ihnen aus dem deutschen Innsbruck. Rechenschaft für das frivol vergossene deutsche Blut.«7
Nicht wenige deutschsprachige Österreicher (die »Deutschen« des Vielvölkerstaates) fühlten sich von der Regierung in Wien schon seit langem verraten und verkauft. Die Deutschen waren in diesem Staat in der Minderheit. Im Parlament zu Wien saßen die Vertreter aller Völker Cisleithaniens (der nichtungarische Teil Österreich-Ungarns): Polen, Ruthenen (Ukrainer), Rumänen (Bukowina), Tschechen, Slowenen, Italiener und schließlich die Deutschen. Diese glaubten, dass sie als das vorrangige Kulturvolk der Vielvölkermonarchie und Stützen des Staates ein permanentes Anrecht auf die politische Entscheidungshoheit hätten. Die Chefambitionen der Deutschösterreicher wurden durch die quotenmäßige Sitzverteilung für die einzelnen Völker Österreichs im Reichsrat allerdings gehörig gebremst. Die deutschsprachige Presse klagte von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an bis zum Ende des Habsburgerreiches über die Verhätschelung und Bevorzugung der slawischen und romanischen Österreicher durch die Regierung, während »Mutter Austria« ihre fleißigeren, disziplinierteren, kultivierteren und treueren deutschen Söhne und Töchter vermeintlich ungerecht und stiefmütterlich behandelte. Mit einer großen Portion Neid wurde in die ungarische Reichshälfte geblickt, denn im Parlament zu Budapest hatten eindeutig die magyarischen Herrenmenschen das Sagen und diese nahmen wenig Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse der anderen Nationalitäten im ungarischen Königreich, wie Slowaken, Rumänen, Serben, Kroaten und Deutsche.
Zur Beerdigung des Malers Pezzey, »des Opfers für die deutsche Sache in Innsbruck«, kamen 15 000 Menschen. Angeblich wurde auch der große schwarze Hund des Verblichenen im Trauerkondukt ganz vorne mitgeführt.
Den tödlichen Bajonettstoß führte der Unterjäger Luigi Matteo Menato aus. Dieser gab zu, dabei das Schimpfwort »porchi« (Schwein) gebraucht zu haben.
Die »welschen Frechheiten« in Innsbruck entfachten auch in Kufstein einen heiligen Zorn. Während einer außerordentlichen »Bürgerausschußsitzung« am 5. November 1904 ärgerte sich der Bürgermeister-Stellvertreter Dillersberger über die staatliche Nachgiebigkeit gegenüber »welscher Anmaßung und Begehrlichkeit« und verwies auf die Vorgänge in Innsbruck, die bezeugen, »daß der Deutsche seines eigenen Heimes vor dem welschen Eindringling nicht mehr sicher ist«.8
Einstimmig nahm der Bürgerausschuss eine Entschließung an, in der die Bürger Kufsteins »ihrer tiefsten Empörung und Entrüstung über die welschen Frechheiten und Uebergriffe Ausdruck verleihen und flammenden Protest gegen die Verletzung und Vergewaltigung der deutschen Bewohnerschaft Innsbrucks erheben. Die Bewohnerschaft Kufsteins weiß und fühlt sich eins mit der Bewohnerschaft Innsbrucks, sie wird treu an der Seite derselben im Kampf für deutsches Recht und Volkstum verharren«.9
Während der gleichen Sitzung wurde ebenso einstimmig beschlossen, die Anbringung »welscher Geschäftsaufschriften« an den Häusern und Läden der Stadt zu verbieten.
Auch in Kufstein ist ein »Welscher« schon frech geworden. Der in der Festungsstadt ansässige Früchtehändler P. D. fiel durch welsches Fluchen unangenehm auf, als er vor dem Gasthaus »Dreikönig« – halbbetrunken – mehrmals laut »cani tedeschi!« (Deutsche Hunde!) rief. Diese Missetat blieb von der Heimatzeitung nicht unkommentiert: »Soweit kommt es, wenn man die Welschen in deutschen Landen groß werden läßt. […] Solange die deutsche Gutmütigkeit und die welschen Ansiedelungen und ihr wanzenartiges Gedeihen auf deutschem Boden nicht aufhört, so lange wird sie fortbestehen – die welsche Impertinenz.«10
Wenn der italienische Arbeiter oder Händler erst einmal sein Weib nachgeholt hat, ist er nicht mehr hinaus zu bringen, so das Klagelied der deutschen Tiroler. Auch der größere Kinderreichtum der Italiener wurde als Menetekel für die rasche »Verwelschung« Tirols an die imaginäre Wand gemalt. Der heimische Handel wird von diesem einseitigen Bevölkerungswachstum kaum profitieren, denn: »Sind erst ein paar Familien da, so folgt bald der oder jener Handwerker (und Händler), bei dem dann alle Italiener ausschließlich kaufen, ganz anders wie die deutschen Hausfrauen, die wegen ein paar Hellern Preisunterschied ruhig zum Welschen gehen.«11
Dass die Zivilisation der Italiener auf einer merkbar niedrigeren Stufe steht, das brachte der Kufsteiner Grenzbote seinen Lesern unter dem Titel: »Frühlingslust, Vogelsang und die hiesigen italienischen Arbeiter« näher:
»Wenn die entzückend milden Frühlingslüfte über unsere deutschen Gaue ziehen, erwacht im Walde neues Leben. Allerorts strecken die wohlbekannten Blümlein ihre Köpfe hervor, in den Zweigen der Bäume aber regt es sich. Minneleben und Hochzeitsreigen treten in ihre Rechte.
Hier trommelt der Specht seinen Hochzeitsmarsch, dort sitzen Roth kelchen, Zeisige und Stiglitze auf ihren zierlichen Eiern, die Amsel baut ihr Nest und die lustige muntere Schar Stare schmettert in die Welt hinein. Diesen gefiederten Sängern droht aber große Gefahr! Die italienischen Arbeiter, wenn sie nicht schon in unseren gepflegten Anlagen herumlungern und uns und den Fremden den Aufenthalt auf den Bänken unmöglich machen, treten den Vögeln an ihren freien Sonntagen – wie wir leider bedauernd beobachten mußten – entgegen, indem sie ihre Nester plündern und ihnen nachstellen, da sie zu ihrem trockenen Polenta eine Zuspeise haben wollen. Dies ist wirklich empörend und möchten wir an unsere verehrlichen Leser appellieren, solche Fälle ungesäumt der Gendarmerie oder Polizei zur Anzeige zu bringen, daß diese Mörder unserer lieben Sänger empfindlich gestraft werden.«12
Im Jahr 1906 erregte der »Schweinekrieg« die alpen- und donauländischen Gemüter. Irgendwie sollte Serbien doch noch bestraft werden dafür, dass es sich für die österreichischen Wohltaten im 19. Jahrhundert nicht dankbar zeigte und seit drei Jahren einen provokativ antiösterreichischen und prorussischen Kurs einschlug. Österreich-Ungarn versetzte Serbien nun einen empfindlichen ökonomischen Schlag, als ab 7. Juli 1906 die Einfuhr und der Transit von serbischem Vieh, Geflügel und Agrarprodukten verweigert und verboten wurde. Österreich-Ungarn war bisher Hauptabnehmer der serbischen Ausfuhren. Für das kleine slawische Königreich bedeutete dieser Handelsboykott eine einschneidende wirtschaftliche Katastrophe. Als Hauptstütze des serbischen Exports galt bis dahin der Verkauf von Schweinefleisch hinüber in die Donaumonarchie. Besonders die Ungarn zeigten sich als unnachgiebige Einpeitscher in diesem Schweinekrieg, da sie als Ergebnis dieses Konfliktes einen Vorteil für die eigene Landwirtschaft erhofften. Der erwartete Kniefall Serbiens vor dem mächtigen Nachbarn und die außenpolitische »Rückkehr« blieb aus, und Österreichs wirtschaftspolitischer Schuss ging eher nach hinten los. Belgrad reagierte mit einem Maximalzoll, und der in dieser Sache mit Österreich nicht solidarische deutsche
Bruder trat nun als kräftiger Abnehmer der serbischen Agrarprodukte auf. Viel Kapital floss aus Frankreich in das trotzige Balkanland – die Serben forcierten damit nun den Aufbau einer die bisherigen Abhängigkeiten deutlich verkleinernden Industrie.
Der »Schweinekrieg« trieb einen weiteren Keil zwischen die beiden benachbarten Donauanrainer und entfremdete Österreich und Serbien um ein vernehmliches Stück mehr.
Nun ist es (fast) soweit! Der Kriegsausbruch ist nur mehr eine Frage von wenigen Tagen! Endlich kann Österreich den serbischen Wurm mit seinen blank geputzten Militärstiefeln zertreten. Jetzt kann das »serbische Schandmaul« mit einem Bleihagel aus österreichischen Mannlicher-Gewehren zugestopft werden. In dieser Tonart präsentierte sich die öffentliche und veröffentlichte Meinung in Österreich in den Tagen nach der offiziellen Annexion Bosniens und der Herzegowina durch die k. u. k. Monarchie am 5. Oktober 1908. An diesem Tag zeigte Österreich-Ungarn den Signatarmächten des »Berliner Kongresses« (1878) die Annexion Bosniens und der Herzegowina an. Wohl oder übel stimmte Russland dem österreichischen Annexions-Vorhaben zu, da es außenpolitisch durch seine Niederlage im Krieg mit Japan (1904) und innenpolitisch durch die revolutionären Ereignisse in St. Petersburg (1905) immer noch geschwächt war. Die offiziellen russischen Äußerungen waren diplomatisch verhalten, umso heftiger schlug die russische Presse mit wilder Rhetorik auf Österreich ein.
30 Jahre waren diese türkischen Territorien nun von Österreich-Ungarn im Auftrag und mit dem Segen Europas verwaltet worden. Dem Einmarsch österreichischer Truppen im Sommer 1878 widersetzten sich die Muslime in Bosnien und der Herzegowina mit Waffengewalt, während die dortigen Serben und Kroaten die Österreicher als Befreier vom türkischen Joch und der muslimischen Dominanz begrüßten. Nun, ein Vierteljahrhundert später, ist die Verteilung der Sympathien und des Hasses eine ganz andere: Die Muslime dieser zwei Landesteile haben sich zu treuen und braven Untertanen des Habsburgerreiches gewandelt, die Serben (mehrheitlich) und viele Kroaten waren zwischenzeitlich vom panslawistischen Virus befallen und stellten eine zunehmend feindlichere Gesinnung gegenüber Österreich-Ungarn und gleichzeitig dem Germanen- und Magyarentum zur Schau.
Der Lebensstandard der bosnischen Bevölkerung wurde in diesen drei Jahrzehnten deutlich gehoben. Die Bewohner des Landes konnten sich einer verbesserten Schulbildung mit leichterem Zugang für alle und zahlreicher neuer Straßen und Eisenbahnlinien erfreuen. Durch die unbestechliche k. u. k. Justiz und Verwaltung war auf diesem Flecken Balkan nun auch eine relativ stabile Rechtssicherheit auf mitteleuropäischem Niveau etabliert. Die österreichischen Bemühungen schienen plötzlich gefährdet, als die »Jungtürken« (eine Gruppe engagierter nationalistischer Offiziere, zu denen auch Mustafa Kemal – nachmaliger Zusatz: Atatürk –, der spätere Begründer der modernen Türkei und Gesinnungsgenosse Enver Paschas gehörte) erfolgreich gegen den Sultan und dessen Regierung putschten. Durch militärische und zivile Reformen und durch eine selbstbewusste und energische Außenpolitik wollten die Putschisten dem maroden Osmanischen Reich frische Energie einhauchen. Durch die neuen Machtverhältnisse in Stambul (Istanbul/Konstantinopel) drohte Österreich die Gefahr, dass sich die forschen »Jungtürken«, die das Nationalgefühl der Türken neu entflammten, wieder an ihre Gebiete erinnern und die nominell immer noch türkischen und von Österreich nur verwalteten Provinzen Bosnien und Herzegowina zurückfordern würden. Dem wollte und musste die Habsburgermonarchie durch die dem Ausland verkündete und völkerrechtlich verbindliche Annexion dieser Territorien zuvorkommen. Den meisten Österreichern gefiel es, dass der Kaiser und die Regierung hier endlich »Nägel mit Köpfen« machten. Der Thronfolger Franz Ferdinand wich dieser allgemeinen Zustimmung aus, er murrte: »Im allgemeinen bin ich überhaupt bei unseren desolaten inneren Verhältnissen gegen alle solche Kraftstückeln.«13
Österreichs Schritt, der nun vollendete Tatsachen schuf, führte in Serbien zu einer antiösterreichischen Massenhysterie.14 Der serbische Gesandte in Stambul beschwor ein Endzeitszenario: »Die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich-Ungarn ist der Tod Serbiens. Sie ist der Vorläufer der Annexion Serbiens durch Österreich-Ungarn oder durch Bulgarien, mit dem das Wiener Kabinett konspiriert hat, um uns zu vernichten. Aber wir haben bereits mobilisiert und werden den letzten Blutstropfen vergießen, um unser Land zu retten oder doch mit Ehren unterzugehen.«
Der Tiroler Grenzbote informierte seine Leser am 10. Oktober 1908 über den serbischen Radau:
»Im Lande der Königsmörder, Serbien, hat die Annexion Bosniens zu rein wahnwitzigen Ausbrüchen des Hasses gegen Oesterreich geführt. In den Städten durchzieht die wütende Volksmenge die Straßen mit den Rufen: ›Krieg! Nieder mit Österreich.‹ Die Erregung der Serben ist verständlich, denn die Annexion Bosniens durch Oesterreich macht ihren Träumen von der Errichtung eines großserbischen Reiches für immer ein Ende. Immerhin könnte Oesterreich genötigt werden, mit Serbien noch ein ernstes Wort zu reden.«15
Wo ein Serbe sein Herdfeuer schürt, dort ist Serbien. Der serbische Chauvinismus verlangte den ungenierten Anspruch auf Territorien, in denen der Bevölkerungsanteil mit serbischer Nationalität eindeutig in der Minderheit war. Diese unselige Tradition wurde unter Milosevic in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts neu belebt. Ein kroatischer Spottspruch nahm den nationalen Rausch der Serben schon vor mehr als hundert Jahren aufs Korn: »Srpsko nebo, srbska boja, u njem stanuje srbin bog, srpski mu andjeli sulze i srpska mu glasba svira« – »ein serbischer Himmel in serbischer Farbe, in ihm wohnt ein serbischer Gott, serbische Engel dienen ihm und serbische Musik spielt ihm auf.«16
Die muslimischen Bosnier (»Bosniaken«), die 30 Jahre zuvor noch gegen die österreichische Okkupation zu den Waffen griffen, erklärten nun in ihrer Mehrheit, dass sie hundertmal lieber Österreich angehören wollen, als Serbien.17
56 Millionen Goldkronen aus Österreich und eine kleine Gebietskompensation stellen die türkische Regierung ruhig. Ansonsten regt sich bei den Osmanen ein kurzer, eher harmloser Protest gegen die Annexion. Türkische Zeitungen predigten den Boykott gegen österreichische Waren.18
In den Tagen und Wochen nach der Annexion zündelte Serbien an den Grenzen zum Habsburgerstaat. Bewaffnete Banden, vermutlich serbische Soldaten ohne militärische Uniformen und Hoheitsabzeichen (ähnliches kennt man auch von russischen Soldaten auf der Krim im Jahr 2014) drangen immer wieder provozierend in österreichisch-ungarisches Territorium ein. Wien stellte Belgrad ein Ultimatum, diese Banden umgehend zurück zu beordern, ansonsten würden österreichische Truppen die Grenze nach Serbien überschreiten. Der Kriegsausbruch hätte kaum jemand überrascht. Den Ernst der Stunde hielt der Tiroler Grenzbote seinen Lesern nicht vor:
»Oesterreich geht also einer ernsten Entscheidung entgegen und wenn auch Serbien unserer Macht in keiner Weise gewachsen ist, so liegt doch die Gefahr vor, daß sich irgend eine Weltmacht in den Handel einmischt und weitere Komplikationen eintreten. Eine ernste Züchtigung wünscht man den Serben, die haben sie durch ihr wahnwitziges Gebaren verdient, es ist aber schade um jeden Tropfen österreichischen Blutes, der wegen des serbischen Gesindels vergossen werden sollte.«19
Belgrad pfiff die bewaffneten Störenfriede, die mit dem offiziellen Serbien angeblich nichts zu tun hatten, zurück und gab sich aber auch in den folgenden Wochen und Monaten mit der neuen Situation nicht zufrieden. Die Kriegsgefahr war noch nicht gebannt, ganz im Gegenteil. Im März 1909 stieß der »serbische Zwerg« neuerlich gegen das Schienbein seines mächtigen Nachbarn. Wieder wurden von der serbischen Regierung befriedigende Antworten verlangt. »Verschlimmerung der auswärtigen Lage« schlug den heimischen Zeitungslesern am 17. März 1909 als Schlagzeile entgegen:
»In Wien war am Abend das Gerücht verbreitet, daß an der serbischen Grenze wieder ein österreichischer Offizier und 6 Mann erschossen worden sind. Die Wiener Blätter haben ihre Kriegskorrespondenten am Montag nach der Grenze abgesandt. Die Lage gilt als im hohen Grade kritisch.«
Die Münchner Neuesten Nachrichten schrieben vom deutschen Standpunkt aus über die Lage: »Der provokatorische Ton der serbischen Note hat die Aussichten auf die Erhaltung des Friedens auf ein Minimum herabgedrückt. Die einzige Hoffnung bleibt noch, daß ein Krieg zwischen Oesterreich und Serbien lokalisiert bleiben möge. Falls aber Rußland an Oesterreich den Krieg erklären sollte, so läßt man an maßgeblicher Stelle in Berlin keinen Zweifel darüber bestehen, daß Deutsch land dem verbündeten Oesterreich mit seiner vollen Heeresmacht zur Seite stehen würde, auch wenn dadurch der Casus foederis für Frankreich einträte.«20
Schon drei Tage später war der Krieg – zumindest auf dem Zeitungspapier – noch näher gerückt:
»Die Völker Oesterreichs ebenso wie die Bevölkerung des Deutschen Reiches durchleben jetzt schwere Tage der Beängstigung und Spannung vor dem Ausbruch des schier unvermeidlichen Krieges mit dem kläglichen Halbbarbarenstaate Serbien, der den Anstoß zu einem Weltkrieg geben kann, wie er noch nie auf Europas altem, blutdurchtränkten Boden ausgefochten worden ist. Und warum? Weil ein kleines, bankrottes, zügelloses Volk, eine degenerierte Dynastie, ein wahnwitziger, unreifer Knabe [der serbische Kronprinz Georg, der seinen Diener Stefan Kolakowitsch durch Hiebe und Fußtritte so misshandelte, dass dieser nach wenigen Tagen starb], aufgestachelt durch das geheime Schüren und offene Hetzen der heuchlerisch immer die Erhaltung des Friedens im Munde führenden Ententemächte [England, Russland, Frankreich], in ihrer grenzenlosen Selbstüberschätzung uns zum Kriege zwingen wollen, uns seit Monaten in jeder Weise provozieren und unsere Grenzen bedrohen.«21
Die Regierung sollte nicht so kriegsscheu sein, wünschte sich das Blatt aus Kufstein und glaubte, in dieser Frage mit seinen bürgerlichen und auch bäuerlichen Lesern in der Stadt und draußen im Bezirk einig zu sein: »Der beschränkte Untertanenverstand sieht nicht ein, warum die Großmacht Oesterreich so willig auf die Absicht des skrupellosen Gegners eingeht, die gewollte Entscheidung mit den Waffen hinauszuziehen, bis dieser Gegner mit seinen Rüstungen fertig ist, anstatt durch ein ›Quo usque Tandem‹ ihm klipp und klar den Ernst der Situation darzulegen.«22
Das Abkommen vom 26. Februar 1909 zwischen Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich betreffend der Annexion Bosniens und der Herzegowina erkennt Russland am 31. März an. Russland war zu diesem Zeitpunkt für einen Krieg mit Österreich und dessen Verbündeten Deutschland noch zu wenig gerüstet. Die absolute Unfähigkeit Russlands, jetzt einen Krieg zu führen, wurde erstaunlicherweise in der Staatsduma zu St. Petersburg offen erklärt.23 Durch den Rückzieher Russlands musste nun auch Serbien zähneknirschend zurückrudern und seine Ansprüche gegenüber Österreich-Ungarn (vorläufig) ad acta legen. Das Gezeter des serbischen Geschäftsträgers in St. Petersburg (und früheren serbischen Ministerpräsidenten) Novakovic lief ins Leere: »Es sind nicht die drei Millionen Serben Serbiens und Montenegros, welche die ser bische Nation bilden, nein, sie bilden nur den dritten Teil der Nation, die anderen zwei Drittel, sieben Millionen, sind in Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Bosnien und der Herzegowina, die man annektieren will. Diese zwei Drittel wurden gegen ihren Willen vollständig dem habsburgischen Regiment unterworfen.«24
Das Ende dieses österreichisch-serbischen Konflikts (Oktober 1908 bis März 1909) wurde im Tiroler Grenzboten auch dem starken germanischen Willen zugeschrieben:
»Oesterreich-Ungarns Forderungen sind also ohne Abschwächung durchgesetzt worden, während es selbst Serbien nicht die geringste Zusage gemacht hat. Serbien aber war nur die Marionette in Russlands Händen, der eigentliche Besiegte ist Rußland und seine Hintermänner. Daher auch das Wehegeschrei und Gezeter der russischen und englischen Presse, weil das Ränkespiel gegen Oesterreich und die Verhetzung der Balkanstaaten nichts weiter erreicht hat, als auf einmal den deutschen Michel in seiner ganzen gewaltigen Stärke und Größe vor Europa und vor der ganzen Welt sich aufrichten zu sehen, bereit, mit seinen derben Fäusten sein Recht zu wahren. Deutschland und Oesterreich, vereint im festen Bündnis, das ist eben doch das Germanentum, das dem Slaventum eine unblutige, aber umso empfindlichere Schlappe beigebracht hat.«25
Für etwas mehr als drei Jahre verzog sich das Kriegsgewölk auf dem Balkan zumindest ein bisschen.
Als Ende August 1909 der nun 79-jährige Kaiser Franz Josef I. Tirol besuchte, um an der »Jahrhundertfeier 1809–1909« in Innsbruck teilzunehmen, waren alle Ärgernisse für einige Tage vergessen. Eine Welle der patriotischen Begeisterung fegte durch das Land. Von Wien über die Giselabahnstrecke kommend, machte der kaiserliche Hofzug am Samstag, den 28. August in Wörgl kurz Halt. Die Honoratioren Wörgls und Kufsteins konnten den Kaiser als erste auf Tiroler Boden begrüßen. Der Grenzbote war bei diesem bedeutsamen Erlebnis natürlich dabei:
»Pünktlich um 4 Uhr 10 fuhr der aus 10 Wagen bestehende kaiserliche Hofzug in die Station ein. Der Kaiser entstieg dem dritten Wagen und nahm die Meldung des Bezirkshauptmannes Bruder entgegen. Gefolgt von diesem, dem Herrn Statthalter Freiherrn von Spiegelfeld, seinem Flügeladjutanten Grafen Paar und mehreren Generalstabsoffizieren schritt der Kaiser, während die Nationalhymne ertönte, die Front der Ehrenkompagnie ab und ging leichten, elastischen Schrittes geradewegs auf die Kufsteiner Gemeindevertretung zu. Herr Bezirkshauptmann Bruder stellte Herrn Bürgermeister Egger vor, der an den Monarchen folgende Worte richtete:
›Eure kaiserliche und königliche apostolische Majestät, Allergnädigster Kaiser und Herr!
Als derzeitiger Bürgermeister der Stadt Kufstein, des Hauptortes des politischen Bezirkes, ist mir die allerhöchste Ehre zuteil geworden, an der Spitze der Stadtvertretung Euere Majestät auf dem heimatlichen Boden des schönen Unterinntales ehrfurchtsvoll zu begrüßen und den alleruntertänigsten Dank dafür auszudrücken, daß durch die Gnade Euerer Majestät der Stadt Kufstein und dem ganzen Bezirke die Gelegenheit geboten wurde, die Liebe und Anhänglichkeit zu Euerer Majestät und zum angestammten Herrscherhause zu beteuern.
Geruhen Euere Majestät allergnädigst die Versicherung entgegenzunehmen, daß die Bürgerschaft von Kufstein und mit ihr die Bürger und Bewohner des ganzen Bezirkes an der Grenze des treu verbündeten deutschen Reiches heute wie immer unter Habsburgs Szepter und eingedenk des erhabenen Vorbildes Euerer Majestät im Frieden an der wirtschaftlichen Erstarkung der Gemeinden, der Grundfesten des Staates, stets freudig schaffen und den Traditionen der Vorfahren folgend, im Ernstfalle ebenso freudig Gut und Blut für Kaiser und Reich opfern werden. Gott beschütze und erhalte Euere Majestät unseren allgeliebten Kaiser und Herrn.‹
Der Kaiser sagte hierauf: ›Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister, für die warme Ansprache, es hat mich sehr gefreut, daß die Kufsteiner heraufgekommen sind. Wie entwickelt sich Kufstein, wird viel gebaut?‹
›Ja,‹ sagte Bürgermeister Egger, ›es wird viel gebaut, die Entwicklung ist eine gute, der Fremdenverkehr ist bedeutend, wir sind zufrieden.‹«26
In Innsbruck defilierten 33 000 Schützen, Landsturmmänner und Veteranen aus Deutschtirol, Welschtirol und Ladinien am immer noch rüstigen Kaiser vorbei, der so »leutselig und freundlich mit seinen Tirolern spricht und verkehrt«.
Sowohl die ältere als auch die neue Literatur zum Ersten Weltkrieg und zum Schicksalssommer 1914 zeichnet mehrheitlich jenes liebgewonnene Geschichtsbild, nachdem die Österreicher und die europäischen Völker völlig ahnungslos und überrascht in diese »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« hinein gestolpert waren. Das Schreckenswort »Weltkrieg« soll im Sprachschatz der Menschen erstmals im August 1914 aufgetaucht sein. Die Sache mit der »Ahnungslosigkeit« und Überraschung kann so nicht stimmen, denn zumindest das zeitungslesende Volk (vor hundert Jahren gab es wesentlich mehr Zeitungen der unterschiedlichsten Weltanschauungen als heute – allerdings mit kleineren Auflagen) wurde von der Presse schon seit Jahren auf den unausweichlich kommenden großen Krieg eingestimmt. Selbst eine nur regional verbreitete Provinzzeitung wie der im Städtchen Kufstein hergestellte Tiroler Grenzbote schrieb schon zu Jahresbeginn 1904 von einem »drohenden Weltenbrand«, und zum Zeitpunkt der »Annexionskrise« konnten all jene, die sich für die Geschehnisse außerhalb des eigenen Kirchspieles interessierten, im selben Blatt am 9. Jänner 1909 lesen: »Heute sind wir gefaßt, jeden Tag gefaßt, in einen furchtbaren Krieg verwickelt zu werden, aus dem sich ein Weltkrieg entwickeln müßte.«27
Der politisch interessierte Bürger kannte die unterschiedlichen Bündnisverflechtungen und Bündnisverpflichtungen zwischen den europäischen Staaten (darüber wurde oft genug in den Zeitungen geschrieben) und konnte daraus erahnen, dass im »Ernstfall« der Konflikt nicht allein auf zwei Streitparteien beschränkt bleiben würde. Die Leute wussten schon lange vor dem Kriegsbeginn im Sommer 1914, dass die Russen mit den Serben …, die Franzosen mit den Russen die Engländer (höchstwahrscheinlich) mit den Franzosen und Russen …, die Deutschen mit den Österreichern …
In der ersten Nummer des neuen Jahres 1912 sah man in der Redaktionsstube des Grenzboten sehr düster in die nahe Zukunft: »Weit entfernt davon, den finster dräuenden Propheten spielen zu wollen, dürfen wir uns nicht verhehlen, daß sich schweres Gewölk am konti nentalen Firmament zusammengezogen hat, das nach Entladung in nicht zu ferner Zeit drängt.« Im selben Artikel wurden die Leser an die Möglichkeit eines »entsetzlichen, noch nie geschauten Weltendrama« herangeführt.28 Drei Monate später findet sich die Schlagzeile: »Stehen wir vor einem Weltkrieg?«29 Die Italiener sind in das zum Osmanischen Reich gehörende Libyen eingerückt. Hierzulande wird die Möglichkeit diskutiert, dass im »allgemeinen Kriegsgetümmel« zwei oder drei Balkanstaaten über Österreich herfallen und dadurch die diversen Bündnisverpflichtungen aktiviert werden könnten. Graf Berchtold, der Außenminister, wird aufgefordert, sofort »energische Schritte« zu tun, um »dem Schrecken eines Weltkrieges« vorzubeugen. Etwas Häme darf in diesem Text des Grenzboten auch nicht fehlen: »Mit der bekannten österreichischen Zauderpolitik wird nichts erreicht.«30
Vom Weltkrieg, vom »Weltenbrand, der einmal um die Vorherrschaft Europas entbrennen muß«31, wird bis zum tatsächlichen Ausbruch des großen Krieges im Hochsommer 1914 sehr oft gesprochen und geschrieben. Es kann ja sein, dass die drohende Kriegsgefahr im Juli 1914 deshalb nicht mit dem nötigen Gewicht in das Bewusstsein der Menschen drang, weil schon im Jahrzehnt vorher immer wieder das Schreckgespenst des anbrandenden Krieges beschworen wurde und die vermeintlichen oder tatsächlichen Bedrohungen für Österreich-Ungarn im letzten Moment doch jedes Mal entschärft werden konnten. Die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand und dessen Gattin in Sajarewo würde schon irgendwie gesühnt werden können, ohne dass sich deshalb die Völker Europas an die Gurgel gehen müssten. Der gewaltsame Tod des hohen Paares ließ in Österreich-Ungarn und im verbündeten Deutschen Reich viele Krokodilstränen fließen und nach Vergeltung rufen, aber als auslösender Funke für einen »Weltenbrand« war das tragische Ableben der beiden kaum vorstellbar. Der herrische und wenig charismatische Franz Ferdinand war weder bei den Völkern der Doppelmonarchie noch bei seinem »allerhöchsten« Onkel, Kaiser Franz Josef, besonders beliebt.
Das »Flottenwettrüsten« zwischen England und Deutschland erreichte einen neuen Höhepunkt. Der britische Löwe schielte auf Deutschlands rasant anwachsende wirtschaftliche Kraft und Macht. Der französische Historiker Lavisse schrieb über die erstaunliche Prosperität dieses Vorkriegs-Deutschland: »In keiner anderen Epoche der Geschichte, in keinem anderen Land hat man in so kurzer Zeit ein so großes Wachstum an Arbeit und Reichtum erreicht.« Deutsche Erzeugnisse galten als die besten der Welt.32
Das deutsche Volk, zu dem sich selbstredend auch die Österreicher deutscher Zunge zählten, war ob seines ökonomischen Erfolges natürlich von Neidern umringt. Deshalb, so der Tiroler Grenzbote in seinen »Ostergedanken 1911«, darf sich das deutsche Volk nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, muss wachsam sein, um seine hehre Mission zu erfüllen:
»Zu neuen Leben soll das Auferstehungsfest auch das deutsche Volk erwecken, dem noch so vieles zu erfüllen vorbehalten ist, und doch denkt so mancher Volksgenosse, seinen Winterschlaf noch weiter fortsetzen zu können, und will sich so gar nicht recht von der alles belebenden Frühlingssonne erwecken lassen. Drohende Gefahren stehen dem Deutschen Volk bevor, ringsum grinst uns von allen Seiten der Feinde große Zahl entgegen, die nur auf den Augenblick warten, wo sie sich auf den germanischen Riesen losstürzen könnten, um ihn soviel wie möglich tief zu verwunden.
Deutsches Wesen verträgt keinen Zwang und keine Knechtung, frei und ungebunden muß es sich entfalten, alle Hindernisse beiseite schiebend und alles besiegend, was sich ihm in den Weg stellt. Das deutsche Volk ist nicht zum Dienen, sondern zum Herrschen geschaffen und als Edelvolk unter den Nationen gebührt ihm auch der erste Raum gegenüber slavischer Anmaßung und Heuchelei« [hier ist der »innerösterreichische Konkurrenzkampf« zwischen den einzelnen Völkern der Monarchie gemeint].33
In der »Weihnachtsbotschaft« des Jahres 1912 erinnerte der »freiheitliche« Grenzbote seine Tiroler Leser an den deutschen Geist des Heiligen Abends: »Zauber der Weihnacht! Breite deine Fittiche über das deutsche Volk aus, umschließe es mit dem Banner der Einigkeit, schmiede es zusammen mit dem Eisen der Not, das nie rosten darf!
Und du Vater oder Mutter, pflanze wenn das Weihnachtslied ›Stille Nacht, heilige Nacht‹ verklungen, im Angesichte des hehren Julbaumes das schönste Samenkörnlein in das so leicht und warm empfängliche Gemüt deiner Lieben, erzähle ihnen von deutschen Heldensagen, von deutscher Liebe, Treue und Furchtlosigkeit und mahne sie in feierlicher Stunde daran, stets dessen zu gedenken, daß sie Deutsche sind, daß sie jenem großen Volke angehören, welches die Vorsehung zur Führung der Weltgeschichte ausersehen hat!«34
Brennender Balkan
Rauflustige Völker • Der nächste Krieg • Den schlafenden Löwen reizen
Als die vorletzte »Friedensweihnacht« vor dem Weltkrieg gefeiert wurde, war das gegenseitige Schädel einschlagen auf dem Balkan schon seit einigen Wochen wieder in vollem Gange. Der »1. Balkankrieg« begann mit der Kriegserklärung des kleinen Montenegro an die »Hohe Pforte« in Konstantinopel (Istanbul) am 8. Oktober 1912. Die Kriegserklärungen Bulgariens, Serbiens und Griechenlands an den gemeinsamen türkischen Gegner erfolgten zehn Tage später. Das erklärte Ziel dieses »Balkanbundes« war die endgültige Vertreibung der Osmanen aus Europa und die Aufteilung Mazedoniens, Thrakiens und möglicherweise Albaniens. Der Krieg zwischen den Italienern und den Türken (»Tripoliskrieg« 1911/12) hatte die Letzteren weiter geschwächt und die Mitglieder des Balkanbundes wollten diese Schwäche nun militärisch nutzen.
Die Großmächte heulten auf, weil diese kleinen rauflustigen Balkanvölker nun partout nicht an die europäische Leine wollten. Wem sollten sie auch gehorchen, wem konnten sie vertrauen? Es wurde zwar viel vom »ordnungserhaltenden und friedensstiftenden Konzert« der europäischen Mächte gesprochen und geschrieben, letztlich kochte aber jeder dieser größeren Staaten sein eigenes machtpolitisches Süppchen. In der Ausgabe 31 (28. Oktober 1912) der Münchner Satire-Zeitschrift Simplicissimus ist die europäische »Zusammenarbeit« durch die Titelzeichnung »Der Brand am Balkan« überaus treffend karikiert und zeigt einen Feuerwehr-Spritzenwagen, dessen große Handpumpe gemeinsam von einem Engländer, Franzosen, Russen, Deutschen und Österreicher bedient wird und doch kommt kein Wasser aus der Pumpe, um den »Balkanbrand« zu löschen, weil jeder einzelne dieser fünf wackeren Feuerwehrmänner die Wasserzufuhr durch allerlei Ungeschicklichkeiten sabotiert.35 – Die besten Karten bei den Mitgliedern des »Balkanbundes« besaßen die Russen. Deren »brüderliche« Hilfe wurde vor allem in Österreich-Ungarn und in Deutschland mit Argusaugen verfolgt. Folgerichtig gerieten das Zarenreich (mit Serbien im Schlepptau) und diesen gegenüber die Habsburgermonarchie schon hart an den Rand eines Krieges. Doch Deutschlands demonstrativer Schulterschluss mit Österreich und Truppenverlegungen an die Ostgrenze ließ die Russen noch einmal zögern.
Vom Balkan-Kriegsschauplatz drangen zahlreiche Nachrichten über gegenseitige Massaker bis in die europäischen Zeitungsspalten vor. Vor allem die serbischen Übeltaten sind für die Österreicher interessant: »Weiters kommen Meldungen von fürchterlichen Grausamkeiten, die die Serben an den Albanesen begangen haben. Die Berichte hierüber sind haarsträubend. Albanien soll geradezu künstlich entvölkert werden. Männer, Greise, Weiber, kurz alles, was nur einem menschlichen Wesen irgend ähnlich sieht, ist von den serbischen Horden hingeschlachtet worden. Wir sind nun neugierig, ob Europa, das sich mit seiner Kultur so stolz brüstet, diese Greueltaten ungestraft hinnimmt.«36
Auch die »Konsulsaffäre« hielt die alpen- und donauländischen Zeitungsleser in Bann. Es ging das Gerücht, dass sich serbische Soldaten am österreichischen Konsul Prohaska und an der österreichischen Fahne vergriffen haben. Sollte diese Ungeheuerlichkeit stimmen, so wäre mit Serbien ein »kitzliches Extrawörtchen« zu reden, und es könnte »Kraut und Rüben absetzen«, wenn Serbien nicht sofort Genugtuung ableistet:
»Es ist nicht zu verwundern, wenn wir Österreicher immer mehr in eine wirsche Stimmung hineingeraten. Die Krise mit Serbien wird uns nachgerade zu dumm. Woche um Woche zieht sich jetzt die Sache hin, jede Gemeinheit müssen wir von diesem russischen Prokuristen am Balkan einstecken – aber wir sind doch keine Eskimos, daß wir etwa gefrorenes Blut in unseren Adern hätten. Unsere Gemütlichkeit hat man uns jetzt hinlänglich abgezapft, also gehen wir endlich einmal zum Ernst über. Weg mit dem Zuwarten! Frisch Tabula rasa! Fahren wir einmal hinein in diese Gesellschaft von Russen und Serben. Wollen wir doch sehen, ob diese Kerle nicht auseinanderstieben, wenn wir mit unserem scharfen Säbel dazwischenfahren. Aber ein Ende wollen wir endlich einmal sehen in dieser serbischen Bandwurmgeschichte.
Deutschland hat schon vor einigen Tagen an sein Schwert geschlagen. Und deutscher Stahl hat guten Klang, österreichischer aber auch.«37
Die vier Verbündeten dieses »1. Balkankrieges« setzen den Türken militärisch schwer zu. Bulgarische Truppen gelangen bis vor die Stadt Catalca, wenige Kilometer westlich von Istanbul. Im »Frieden von London« (Mai 1913) wird die Abtretung aller türkischen Gebiete westlich der Enos-Midia-Linie und der ägäischen Inseln vereinbart.
Die Mitglieder des »Balkanbundes« könnten zufrieden sein, doch die Teilung der Beute häuft neuen Konfliktstoff auf. Eine schon manische Kultur der Gewalt in dieser Randzone Europas ließ der Diplomatie wenig Raum. Die Basis dieser Eigenart ist in Léon Degrelles Buch »Verschwörung der Kriegstreiber 1914« in wenigen Sätzen kompakt zusammengefasst: »Die Serben, so wie die Bulgaren, die Albaner, die Makedonier und die Rumänen, standen jahrhundertelang unter türkischem Joch, verroht durch den Islam, von Natur aus ziemlich primitiv und mit größter Wonne sich gegenseitig umbringend, hatten sie sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger emanzipiert, aber nur um sofort zu versuchen, die jeweils anderen zu beherrschen.
Sie haben einander massakriert, erobert, verloren, zurückerobert mit einem barbarischen und unermüdlichen Eifer.«38
Dass durch den Machtverfall der Türken auf dem Balkan die Russen massiv in das Vakuum drängen, mit all ihrem Sympathie-Vorschuss und Einfluss bei den slawischen Brüdern, gefällt der österreichischen Politik absolut nicht. Das Volk weiß nicht so recht, ob man in dieser Situation für die bedrängten Osmanen, die immerhin vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Österreichs Erbfeinde waren, Partei ergreifen sollte oder nicht. Einerseits hatte man doch vor allem in den Russen und Serben einen gemeinsamen Feind. So oder so, über die Türken etwas zu lesen war immer interessant:
»Es können Siegesnachrichten sowohl als Hiobsbotschaften die Mohammedaner in den Städten zur Raserei bringen. Anzeichen für derartige Dinge sind schon da. Auf der Fahrt von Berlin nach Konstantinopel sagte ein türkischer Reisegenosse, der in modernster europäischer Reisekleidung einherging und fließend deutsch sprach: ›Wenn ich glauben müßte, daß das Ende des Ottomanischen Reiches naht, würde ich meine Frau, die eine Westeuropäerin ist, und meine zwei Kinder töten und mit dem Revolver in der Hand so lange Christen niederschießen, bis man mich selbst unschädlich macht‹. Der Krieg zerreißt den Schleier, welcher die Türkei des zwanzigsten Jahrhunderts verhüllte und die Europäer glauben ließ, es habe sich dort eine große Wandlung vollzogen. Es ist immer noch die alte Türkei, und Europa wird sie jetzt kennen lernen.«39
Bulgarien barmte, dass es die Hauptlast des eben zu Ende gegangenen Krieges gegen die Türken trug, jedoch von Mazedonien, auf das zumin dest drei Partner des »Balkanbundes« energische Ansprüche erhoben, nur einen Brosamen erhielt. Nur vier Wochen nach dem »Frieden von London« greift Bulgarien nun Serbien und Griechenland an. Der »2. Balkankrieg« entflammt, der noch um einiges grausamer und blutiger als sein Vorgänger wird. Die Begriffe »Freund« oder »Feind« besitzen ein sehr wackeliges Fundament, denn nun findet sich die eben noch bekämpfte Türkei als Waffenbruder an der Seite Serbiens, Montenegros und Griechenlands im Streit gegen Bulgarien wieder. Und auch die Rumänen mischen jetzt gegen Bulgarien mit. Österreich ist in diesen stürmischen Wochen neuerlich herausgefordert, denn die montenegrinischen Hammeldiebe hatten sich die Hafenstadt Skutari unter den Nagel gerissen. Das durfte aber nicht sein, denn dieser für Österreichs antiserbische Strategie wichtige Ort war für das neue Albanien reserviert. Serbien (Arm in Arm mit Montenegro) durfte keinen Adriazugang erhalten, folgerichtig zogen österreichische Kriegsschiffe vor Skutari auf.
Österreichs Außenpolitik ist ja bis heute von einer alten Erbkrankheit begleitet: zaudern, zögern, einen Schritt vor, wieder einen halben zurück, abwarten, was die anderen machen. Mit einer solch schwammigen Politik ist es Österreich schon während des »7. Türkisch-Russischen Krieges« (Krim-Krieg 1854/56) gut gelungen, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Eine klare, tatkräftige Außenpolitik war auch 1913 kaum umzusetzen, da der alte Kaiser und dessen hochadelige und nicht un bedingt schon im 20. Jahrhundert angekommene Entourage in Schön brunn den Konflikten eher durch ein ruhig-majestätisches Abwarten begegneten, in der Erwartung, dass allein schon der Glanz und die Herrlichkeit der Doppelmonarchie die Dinge schon ins rechte Lot rücken würde, während im Belvedere, im Umfeld des Thronfolgers, eine forschere außenpolitische Gangart als dringend umzusetzendes Ideal galt. Der Generalstabschef der k. u. k. Armee, Josef Conrad von Hötzendorf, arbeitete schon seit Jahren mit Verve daran, sich als Kriegstreiber einen guten Namen zu machen. Schon während der Annexionskrise 1908/09 wollte er gegen Serbien und Russland zu Felde ziehen, da er ja nicht ganz zu Unrecht der Meinung war, dass die militärische Auseinandersetzung mit diesen »Halunken« so oder so kommen wird, und umso früher Österreich sein Schwert zieht (bevor Russland zum Höhepunkt seiner Rüstungsanstrengungen kommt), desto besser sind die Siegeschancen. Beim Ausbruch des »2. Balkankrieges« spottete Franz Ferdinand über den überbordenden Kriegseifer seines Generalstabchefs: »Conrad von Hötzendorf wird natürlich wieder für alle möglichen Kriege und große Hurrahpolitik sein.«40
Dass ein Ministaat wie Montenegro mit wenig zimperlicher Kampfmethode während des »1. Balkankrieges« den Türken blutige Nasen verpasst und sich ohne die europäischen Großmächte um »Erlaubnis« zu fragen, die Adriastadt Skutari schnappt, lässt auch in Tirol an der Respektabilität Europas zweifeln: »Mit Hilfe der serbischen Bundestruppen schießt Nikita der Lächerliche [König Nikita I.] das letzte so tapfer verteidigte Bollwerk der europäischen Türkei, Skutari, in Grund und Boden, mordet und brennt alles nieder und in dieses blutige Gemetzel grinst die hilflose Diplomatie Europas, weil kein Staat den Mut aufbringt, hier mit eiserner Faust in dieses Läusepack hineinzuhauen.«41
Im Mai 1913 wurde Österreich von den anderen geschubst, es möge doch in Skutari (mit seinen »Marines«) nach dem Rechten sehen, um die Stadt für das neue Albanien zu »reservieren«. Diese »Hausknechtsarbeit« wurde vom Tiroler Grenzboten höhnisch kommentiert:
»So sind wir dank unserer diplomatischen Vertretung im Auslande, dank der eigenen Dummheit seit Monaten an der Nase herumgeführt, die Schergen Europas geworden, die, um nicht den Fluch der Lächerlichkeit auf sich zu laden, diesen montenegrinischen Saustall säubern dürfen. Lorbeeren in den schwarzen Bergen werden wir keine holen, denn dieses Gesindel da drunten ist keine ehrlich gezielte Mannlicher-Kugel wert, geschweige das Opfer eines Menschenlebens. Aber das Ansehen Oesterreichs verlangt’s; also hinein in dieses Räubernest!«42
Der »2. Balkankrieg« endete mit der Niederlage des ausgebluteten Bulgarien (»Friede von Bukarest«, 10. August 1913). Die Türkei erhält einen kümmerlichen Rest Land in Thrakien zurück, gerade so viel, um diesen Streifen Land als »Standbein« auf dem europäischen Kontinent nützen zu können. Griechenland freut sich über den Erwerb von Saloniki, die Dobrudscha fällt an Rumänien.
Bulgarien und die Türkei werden im Ersten Weltkrieg an der Seite der »Mittelmächte« Österreich-Ungarn und Deutschland stehen.
Auch der »2. Balkankrieg« konnte die völkisch-territorialen Unebenheiten in jenen Landstrichen nicht glätten. Die nationalen Unzufriedenheiten dort hat Gerhard Herm in seinem Geschichtswerk »Der Balkan. Das Pulverfass Europas« mit wenigen Sätzen sehr treffend formuliert:
»Nördlich und südlich der einzigen natürlichen Grenze innerhalb des kleinen Subkontinents, der Donau, gruppierten sich sechs Staaten, die alle größer waren als vor dem 1. Balkankrieg, von denen aber jeder glaubte, das, was ihm an Gebieten wirklich zustehe, habe er nicht bekommen. In erster Linie galt das für Griechenland, Serbien und Bulgarien, die alle das ganze Makedonien für sich beanspruchten, aber jetzt nur Teile davon besaßen. Aus anderen Gründen galt es jedoch auch für Rumänien und Montenegro. Aus dem einen Land schielte man immer noch nach Siebenbürgen hinüber, das andere trauerte um seine von Österreich besetzte Küste. Ob in Athen, Cetinje, Belgrad, Sofia oder Bukarest, überall scharrten Politiker und Ideologen ungeduldig mit den Füßen, bereit, bei der nächsten Gelegenheit noch entschlossener für die eigenen ›Rechte‹ zu kämpfen oder diese Gelegenheit selbst herbeizuführen.«43
Am 7. Juni 1913, ein Jahr und drei Wochen vor den Schüssen in Sajarewo, forderte der Tiroler Grenzbote einmal mehr die »geistige« Aufrüstung, die völkische Wetterfestigkeit, um gegen die Stürme der Zukunft gewappnet zu sein: