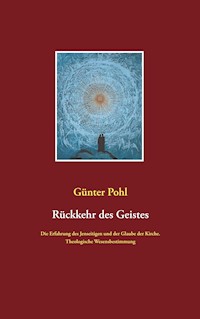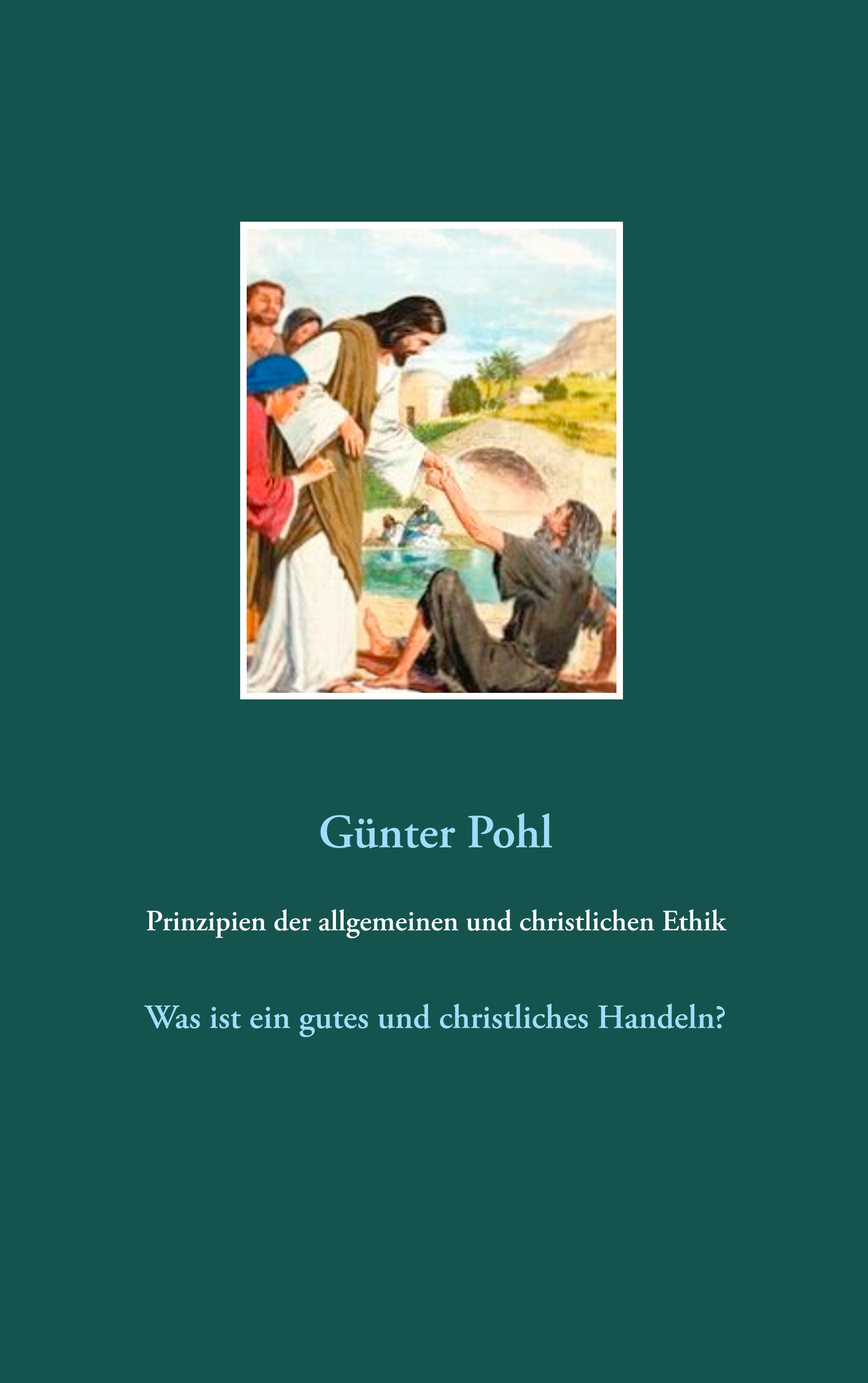
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Über Ethik findet man nur wenig Literatur und wenn, dann ist diese so sehr theoretisch, dass man sich nach der Lektüre fragt: "Ja, wie soll ich denn jetzt handeln?" Oder: "Ja, was ist denn jetzt gut und was böse, sind das nur relative Begriffe oder gibt es eine feste Begründung für eine gute Tat? " In diesem Buch wird versucht, hierüber Klarheit zu schaffen und darüber hinaus soll das besonders christliche Verhalten durch biblische Textaussagen erörtert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Wissen um das richtige
Verhalten
ist den Menschen
ins Herz geschrieben
und ihr Gewissen bezeugt es ihnen.
(frei übersetzt nach Röm.2,15)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Allgemeine Ethik
Vorüberlegung zu einer allgemeinen Ethik
Das Absolute und das Relative
Das Anerzogene Gut und Böse
Die Quintessenz der Ethik
Der „Gutmensch“
II. Religiöse Ethik
Horizontale und Vertikale gehören zusammen
Religiöse Ethik nur vom Ziel her zu begründen
Die Ebenen des Glücks
Stufen der religiösen Ethik
III. Christliche Ethik
Trinitarische und universale Ethik
Christus als Vorbild der Christlichen Ethik
Das Gottesverständnis Jesu
III.A. Die Dreifaltigkeit der Christlichen Ethik
1.Ethik gegenüber Gott
2. Ethik gegenüber dem Menschen (d. Nächsten)
Wer ist der Mensch?
Nächstenliebe in der privaten Ethik
Nächstenliebe in der politischen Ethik
Nächstenliebe in der erweiterten politischen Ethik
Nächstenliebe in der ökologischen Ethik
3. Die Ethik sich selbst gegenüber
Vorüberlegung
Sich selbst gegenüber als biologisches Wesen
Sich selbst gegenüber als seelisches Wesen
Sich selbst gegenüber als geistiges Wesen
a. Geistige Ethik
b. Krankheit und Tod
c. Empathisches Handeln
d. Das persönliche Ziel
d.α Vergottung und Heiligkeit
IV. Zusammenfassung von I.-III.A
V. Exkurs: Gottes Ethik
VI. Biblische Urkunden der Ethik
Vorüberlegung
Die Zehn Gebote
Die Bergpredigt (Ethik Jesu)
Die Gebote der Bibel insgesamt
Vom Sinn der Gebote Gottes
Abendmahl und Kreuzestod als Neuer Bund Gottes
VII: Das Neue Gebot und die Praxis
Neues Gebot und neue Ethik
Das Neue Gebot und die moderne Zeit
Beispiel „Sexuelle Befreiung“
VIII. Ethik durch den Heiligen Geist
IX. Zusammenfassendes Schlusswort
Anhang
Prinzipien der Ethik
Bibelstellen
O. Vorwort
Warum sollte man ein Buch über Ethik lesen, bzw. über die Frage nach dem richtigen Verhalten nachdenken? Wer fragt heute noch danach? Wer macht sich darüber noch Gedanken? Warum auch? Man lebt und gut! Mal sehen, was kommt. Wenn ich auf die Straße gehen würde und die jungen Leute befragte, würde ich in erstaunte Gesichter blicken und würde zur Antwort bekommen: „Was soll diese Frage? Ich mache mir darüber keine Gedanken und weiß auch nicht, wofür das gut sein soll.“ Vielleicht würde man diese Frage auch juristisch missverstehen und antworten: „Es reicht, wenn ich einen guten Anwalt habe, wenn es drauf ankommt. Soll ich etwa alle Gesetze kennen?“
Die Frage nach dem richtigen Verhalten stellt sich nur jemand, der sich einer höheren Autorität verpflichtet fühlt. Im juristischen Fall ist dieses der Staat oder das Grundgesetz. Dieser Autorität muss man sich zwangsweise beugen, ob man will oder nicht. Aber sonst erkennt man in der Regel kaum noch jemanden an, der über einem steht. Vielleicht sind es Vorgesetzte in der Arbeit oder die Eltern innerhalb einer Familie, denen man mehr oder weniger freiwillig untersteht. Aber all diesen Personen kann man die Untergebung aufkündigen.
Niemand möchte von jemandem bevormundet werden. Man will frei sein und selbstbestimmt. Also fragt man auch nicht danach, wie man leben soll, weil man sich nur sich selbst gegenüber verpflichtet weiß. In einer Gesellschaft, in der nur das Individuum das höchste Gut ist, nicht eine Gemeinschaft, auch nicht das Volk und erst recht nicht eine göttliche Macht, an der man zweifeln kann, wird deshalb auch nicht danach gefragt, wie man ethisch richtig handeln soll. Es wird meist nur danach gefragt: „Was dient mir? Was tut mir gut? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Oder: Soll ich meines nächsten Bruder sein? Wenn jeder an sich selber denkt, dann ist doch an alle gedacht. Wieso soll ich meine Nerven aufreiben für andere? Ich hab mit mir selbst genug zu tun!“ Aber man fragt oft nicht: „Was tut anderen gut?“
Nicht umsonst spricht man heute von einer „Ellenbogengesellschaft“ oder gar von „sittlicher Verrohung“. Es ist kein Wunder! Warum sollte man sich um andere kümmern? Der Nächste geht mich nichts an. In der Welt gilt eben das Gesetz des Stärkeren. Selbst ein Philosoph wie Friedrich Nietzsche hat das Mitgefühl als krankhaft bezeichnet, weil eine menschlich gesunde Entwicklung nur gewährleistet werden kann, wenn sich der Stärkere biologisch und evolutionär durchsetzt und vermehrt, so wie es halt das Gesetz der Natur sei.
Friedrich Nietzsche hat zwar einen wichtigen Gedanken gehabt in einer Zeit, als das Individuum nicht viel galt, dafür aber die Gesellschaft. Er hat mit Recht darauf verwiesen, dass man vor allem sich selbst gegenüber verantwortlich sein muss. Wie soll man denn auch anderen helfen, wenn man selbst hilflos und schwach ist? Aber Nietzsche hat den egoistischen Gedanken sehr weit übertrieben, so weit, dass er dem Ego schon göttliche Eigenschaften beimaß. Er hat dabei vergessen, dass eine altruistische (also auf den Nächsten bezogene) Haltung auch mit der eigenen Entwicklung seiner Persönlichkeit zu tun hat.
Eines Tages kam jemand zu mir mit der Aussage: „Es ist unerträglich, wie mein Gewissen reagiert, wenn ich etwas tue, was anscheinend nicht in Ordnung ist. Kann man das Gewissen nicht abschalten? Ist nicht das schlechte Gefühl dabei nur anerzogen, weil die Gesellschaft bestimmte Dinge für richtig und bestimmte Dinge für falsch hält? Und wenn das der Fall ist, dann müsste man sich doch einreden können, dass ein schlechtes Gewissen nur anerzogen ist und somit gar keine Berechtigung hat, dann müsste man es doch wegtherapieren können“.
Die Frage war sehr berechtigt. Denn sie ist sehr aktuell, politisch wie auch religiös. Wir leben heute in einer Welt, wo scheinbar alles erlaubt ist, was früher einmal als unmoralisch oder gar als Sünde galt. Vorehelicher Geschlechtsverkehr beispielsweise ist nicht mehr moralisch verwerflich, sondern geradezu normal. Wer „keusch“ in die Ehe geht, gilt heutzutage schon als abnormal, wenn nicht sogar als sonderlich. Auch ist Fremdgehen oft nur noch ein Kavaliersdelikt und ist kein Trennungsgrund mehr. Abtreibung galt früher als Mord, heute darf man sogar dafür Werbung machen.
Homosexualität galt früher und in vielen Ländern heute noch als Verbrechen oder als krankhafte Veranlagung. In den Schulen wird jetzt aber den Grundschülern und zuweilen sogar den Vorschulkindern nahegelegt, sich zu ihrer möglichen Homosexualität zu bekennen, weil es normal sei, das gleiche Geschlecht zu lieben. Diverse sexuelle Praktiken werden heute sogar beworben und Love-Paraden werden von den Landeskirchen sogar unterstützt, in der falschen Annahme, dass Liebe ja keine Sünde sei und Jesus ja auch von Liebe gesprochen habe.
Die sexuelle Aufklärung geht sogar noch weiter. Selbst die Bezeichnung Mann und Frau gilt als überholt. Jeder soll so leben dürfen, wie er sich fühlt. Wer zum Beispiel einen männlichen Körper hat und sich als Frau fühlt, der soll so leben wie eine Frau und soll sich durch Medikamente oder Operation verändern dürfen.
Als überholt gelten in manchen Bereichen auch Begriffe wie Vater und Mutter. Stattdessen sollen Bezeichnungen wie „Gender 1“ bzw. „Gender 2“ verwendet werden. Selbst wer als Mann ein Kind austragen möchte, kann sich ein Embryo unter medizinischer Aufsicht einpflanzen lassen.
Im sexuellen Verhalten hat sich also viel verändert. Die sog. 68er-Revolution hat sich voll entfalten können, bis an die Grenze des Absurden. Vor einigen Jahrzehnten hatten sogar „die Grünen“ gefordert, das Gesetz abzuschaffen, bei dem Sex mit Kindern unter Strafe gestellt wird.
Aber auch in anderen Bereichen hat sich viel verändert. Galten früher Staatsgrenzen als normal und Liebe zu seinem Land als wünschenswerte Tugenden, so gilt im „Mainstream“ das heute als gestrig und sogar als faschistoid. Hat man früher darauf geachtet, dass ein Volk mehrheitlich genuin lebt und seine Traditionen erhalten bleiben, so wird heute eine „Multikulti-Gesellschaft“ positiv bewertet, trotz aller Probleme, die sich dadurch ergeben.
War früher eine offene Debattenkultur im Sinne einer gesunden Demokratie noch vorhanden, so ist in den letzten Jahren eine Meinungsdiktatur entstanden, die in unserer Gesellschaft einen Riss hat entstehen lassen. Wer Kritik an dieser Politik der vermeintlichen Offenheit äußert, kann, wenn er eine bekannte Person ist, die Konsequenz eines Berufsverbotes spüren (z.B. die Tagesschau-Sprecherin Eva Hermann, der Sänger Xavier Naidoo oder Andreas Gabalier, bis zum CDU Politiker Hans Georg Maaßen und vielen anderen).
Es hat sich viel verändert. Die Werte von früher sind nahezu auf den Kopf gestellt worden („pervertiert“). Es hat im wahrsten Sinn eine Revolution im geistigen Bereich gegeben. Alle Veränderungen geschahen schleichend unter dem Vorwand des vermeintlichen Wohles des Menschen.
Und die Kirchen schweigen oder machen sogar mit. Die katholische Kirche bezeichnet vieles vom oben Genannten zwar als Sünde, die offiziellen Stellungnahmen dazu sind allerdings verstummt.
Bei all der Vielfalt der Meinungen kann man sich fragen, welche Ethik denn nun die richtige sei? Ist alles beliebig gleich richtig und gut? Kann jeder sich aussuchen, was er machen will und wie er leben will? Oder soll man sich einfach dem fügen, was die Politiker machen, nach dem Motto: „Die werden schon wissen, was gut ist!“?
Man könnte auch weiter fragen: Gelten heute alle Verhaltensregeln meiner Religion genauso wie früher? Sind die 10 Gebote heute noch gültig, muss man die Bibel umschreiben? Halten die Gebote Gottes heute noch einer gründlichen Überprüfung stand?
Im Folgenden wollen wir diesen Fragen nachgehen. Von der allgemeinen Ethik ausgehend, wollen wir uns zu einer religiösen vorarbeiten und anschließend die genuin christliche Ethik am Beispiel der Lehre und dem Leben Jesu betrachten.
I. Allgemeine Ethik
Vorüberlegung zu einer Allgemeinen Ethik
„Werte und Normen“ ist ein Schulfach, das anstelle des Religionsunterrichts gewählt werden kann. Darin versucht man mit den Schülern herauszufinden, wie der Mensch sich verhalten soll. Man verweist dabei gern auf den sog. Kategorischen Imperativ des deutschen Philosophen Immanuel Kant, der besagt: „Handle so, dass die Maxime deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte!“ Oder einfacher ausgedrückt: „Was du nicht willst, dass man dir tu`, das füg` auch keinem andern zu!“ Dieser Spruch wird als Goldene Regel bezeichnet. Schon bereits Jesus Christus hat in seiner Bergpredigt im 7. Kapitel, Vers 12, des Matthäus-Evangeliums gesagt: „Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch!“
Abgesehen von spitzfindigen Gegenargumenten gelten diese Regeln weltweit. Sie sind uns quasi ins Herz geschrieben. So spricht auch der Apostel Paulus (Röm. 2,15): „Sie (die Heiden, bzw. alle Menschen) beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen“.
Diese Meinung wird als „Naturrecht“ bezeichnet; sie besagt, dass es im Menschen etwas gibt, das ihm zeigt, was richtig und falsch ist.
Jeder, der in sich geht, kann also den übergeordneten Willen, der in uns gelegt ist, erkennen. Wer Falsches tut, bekommt „Gewissensbisse“, wer Gutes tut, hat ein „reines Gewissen“. Wir alle kennen das.
Für den Philosophen Kant galt das als Beweis für die Existenz Gottes. In der Neuzeit wird dieser Gedanke aber sehr in Frage gestellt. Zwar leugnet man nicht, dass es im Menschen eine Instanz namens Gewissen gibt, aber deshalb könne man noch lange nicht genau definieren, was gut und böse sei. Gut und Böse hängen scheinbar vom Weltbild eines jeden Betroffenen ab. Was für den einen gut zu sein scheint, kann möglicherweise für einen anderen böse sein. Als Beispiel sei ein Islamist genannt. Für ihn, so glaubt er, ist es gut, wenn er einen Ungläubigen tötet. Er meint, dass es eine gute Tat sei, weil er es für Allah getan habe und dass er dafür ins Paradies komme und belohnt werde.
Wir sehen also: Die ethischen Vorstellungen scheinen sehr relativ zu sein. Wenn das der Fall wäre und wir das wirklich glauben würden, müsste doch jeder sagen können: Es gibt kein absolut Gut und Böse. Ja, mehr noch: Jeder soll sich aussuchen dürfen, was für ihn die gültige Ethik sei. Jeder soll machen können was er will. Wenn jemand demnach Töten gut findet, soll er töten; wenn jemand Stehlen gut findet, soll er stehlen! Es scheint ja sowieso alles relativ zu sein.
Aber was geschieht, wenn wir so handeln? Es macht sich Unmut breit, denn niemand möchte gern getötet werden oder bestohlen. Man wird die Polizei rufen und die Justiz wird ihre Arbeit tun. Denn niemand findet das gut! Was ist hier geschehen? Auf der einen Seite sagen wir, Gut und Böse seien relativ und jeder soll doch so handeln, wie er es für richtig hält; auf der anderen Seite sagen wir, man solle Grenzen ziehen. Wer setzt hier die Grenzen?
Nun schön, wir sagen, der Staat setzt die Grenzen. Aber tut er es willkürlich? Wo nimmt er die Kriterien her für seine Grenzziehung?
Der Gesetzgeber drückt es sinngemäß so aus:
Wir Menschen haben durch Überlegung einen Konsens gefunden, nach dem wir uns richten wollen und haben es als Gesetz formuliert. In der Fachsprache nennt man das „Positives Recht“, im Gegensatz zum „Naturrecht“, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Mit anderen Worten: Das Wissen um Gut und Böse entsteht bei dieser Rechtsprechung aus den gemeinsamen Überlegungen der Menschen selbst, mittels der Vernunft. Wenn irgendwann eine andere Meinung herrscht, wird das Gesetz wieder geändert. Gut und Böse werden hier beliebig dem jeweiligen Zeitgeist angepasst.
Auch hier merken wir: Jeder Staat formuliert seine Gesetze wie er es braucht. Ein diktatorischer Staat wird andere Gesetze haben als ein demokratischer. Auch hier sehen wir: Wie beim Einzelnen sind die Vorstellungen vom rechten Handeln auch im Staat sehr relativ. Immer, wenn die Moral vom Menschen her begründet wird, bleibt sie relativ, egal ob vom Einzelnen oder von Vielen.
Müssen wir uns damit abfinden oder gibt es absolute Gründe für die Ethik? Kann das Naturrecht sich auf feste Werte berufen, die immer gültig sind? Wenn wir von absolut und immerwährend sprechen, tut sich die Frage auf: Gibt es überhaupt das Absolute und Ewige? Genau das ist der entscheidende Punkt!
Das Absolute und das Relative
Unsere Gesellschaft lebt im Allgemeinen sehr eindimensional (sie glaubt nur an diese sichtbare Welt) und rechnet nicht mehr mit dem Absoluten. Man kann es auch religiös ausdrücken: Sie rechnet nicht mehr mit Gott. Denn Gott ist ja der oder das Absolute schlechthin. Wenn man diesen Gedanken aber von vornherein ausklammert, wird man immer im Relativen stecken bleiben. Wer nicht mit einer transzendenten Dimension rechnet, wird immer zu demselben Resultat kommen, dass Gut und Böse relativ seien, ja sogar, dass das gesamte Leben relativ ist. Es gibt demnach nichts Absolutes; alles ist relativ, wandelbar und allezeit neu verhandelbar.
Für einen religiösen Menschen stellt sich diese Frage nicht, oder zumindest nicht in dem Maße. Ein religiöser Mensch glaubt an das Absolute namens Gott. Aber auch hier bleibt die Unsicherheit. Ist es nur ein Glaube? Glauben heißt doch „nicht wissen“, bzw. „vermuten“. Jeder würde auf unseren Hinweis auf das Absolute immer argumentieren: „Was du da sagst, ist ja nur deine Meinung, dein Glaube, deine Vermutung. Beweise mir doch, dass es das Absolute gibt, dann können wir uns über eine Ethik unterhalten, die nicht relativ ist“.
Gewiss kann man gegenargumentieren und fragen: „Beweise mir doch, dass es nur das Relative gibt und nicht das Absolute!“ Auch hier kann kein Beweis für das Gegenargument erbracht werden.
Das Relative kann also genauso wenig bewiesen werden wie das Absolute.
Was nun? Hier sind wir in einer Sackgasse. Denn könnte man das Absolute beweisen, könnte man auch Gott beweisen. Wie wir wissen, kann man das nicht. Wie will ein unvollkommenes Wesen das Vollkommene beweisen?! Wie will eine Ameise den Menschen beschreiben?
Mit einem groben Werkzeug kann man keine Uhr reparieren. Unser Gehirn entspricht einem groben Werkzeug. Gott ist Geist, wie wir wissen. Unsere Gehirnaktivität tut sich schwer mit diesem Gedanken. Sie ist zu grob, um den Geist Gottes zu erfassen.
Gibt es denn einen Apparat in uns, der das geistig Absolute erfassen kann? In den religiösen Traditionen spricht man hier von „Herz“. Mit dem Herzen können wir Gefühle und geistige Wahrheiten eher wahrnehmen als mit unserem Gehirn. Dafür sprechen schon die elektrischen Impulse, die vom Herzen ausgehen; sie sind viele Male stärker als die des Gehirns.
Das Herz reagiert, wenn wir etwas Schlechtes tun.
Es reagiert z.B. wenn wir lügen. Wir kennen alle einen Lügendetektor aus den Krimis im Fernsehen oder vielleicht haben wir selbst schon mal bei der Polizei davor gesessen. Mit Hilfe eines Lügendetektors kann man messen, ob man lügt oder nicht. Man misst dazu mehrere elektrische Impulse. Denn diese verändern sich, wenn man lügt. Sie verteilen sich im gesamten Körper. Der Herzschlag wird schneller, der Blutdruck steigt, die Haut reagiert und die Atmung verändert sich. Wir sehen also: Der Körper reagiert auf Lügen. Man kann generell sagen: Der Körper reagiert auf das Böse. Er „weiß“ sozusagen was gut ist und böse.
Aber natürlich ist es nicht der physische Körper oder das physische Herz, welche das wissen, sondern es ist unsere Seele. Die Psychologie kennt das Phänomen der Psychosomatik. Sie sagt, dass sich psychische Dinge auf körperlicher Ebene zeigen. Also ist es naheliegend, dass man das auch körperlich mit Geräten messen kann. Obwohl in der Medizin viel von der Psyche die Rede ist, wird dennoch meist nicht anerkannt, dass die Seele ein „geistiges Organ“ ist, das weiß, was das Richtige ist, sondern es wird behauptet, dass dies anerzogen sei.
Wir sagten vorhin, dass wir auf unser Herz hören sollten, wenn wir nach dem Absoluten fragen. Obwohl unser Herz ein feineres Organ für geistige Realitäten ist, kann man immernoch nicht im klassischen Sinne beweisen, dass es das geistig Absolute gibt. Weiter kommen wir scheinbar nicht. Denn alles, was man beweisen will, muss man ja mit dem Gehirn reflektieren. Dieses kann aber nur einseitig argumentieren.
Lasst uns ein Beispiel aus der Pathologie anführen! Es gibt Menschen, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Sie denken nur logisch. Ihre Gefühlswelt bleibt verschlossen. Diese Menschen nennt man Psychopathen. Diese können die schlimmsten Verbrechen begehen, ohne irgendwelche Bedenken oder Gewissensbisse. Wir erkennen sofort: Ein Handeln nur aus der Logik heraus, ohne Zugang zu Gefühlen, ist krankhaft zu nennen. Und dennoch wird in der Wissenschaft immer nach einer reinen Logik geforscht. Immer will man das Gewissen logisch einordnen oder definieren.
Also: die Frage nach dem Absoluten kann mit der Logik allein nicht beantwortet werden. Und natürlich ebenso nicht die Frage nach dem absolut Guten und Bösen.
Logik ist also sehr lückenhaft. Erst die Hinzunahme der Gefühle von Empathie ergeben ein vollständigeres Bild. Natürlich kann deshalb immer noch nicht von einem Beweis gesprochen werden. Aber immerhin von einem Indiz.
Das absolute Wissen um Gut und Böse kann zwar nicht direkt vom Absoluten hergeleitet werden, aber immerhin verweist uns die Indizienlage auf die Annahme, dass es ein Absolutes gibt.
Was sollen wir tun, wenn wir uns fragen, ob eine Handlung, die wir begehen wollen, gut oder böse ist? Wir könnten zuerst alle Argumente sammeln, die wir finden, um abzuwägen, was das Beste davon sei. Es kann vorkommen, dass trotz allem kein Ergebnis befriedigend scheint. Was tun wir dann? Dann fragen wir uns selbst. Dann fragen wir: Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich für mich persönlich an und wie fühlt es sich für den betreffenden Anderen an? Das nennt man Empathie.
Die Empathie ist ein entscheidender Faktor für die Frage nach richtig und falsch.
Sie sollte bei allem hinzugezogen werden! Nicht nur bei der Frage, wie man dem Menschen gegenüber handeln soll, sondern es betrifft ebenfalls die Tiere, die Pflanzen, und die Umwelt allgemein. Und manchmal fragen wir auch (falls wir religiös sind): Was mag Gott darüber denken? Der Theologe und „Urwalddoktor“ Albert Schweitzer nannte diese Einstellung „Ehrfurcht vor dem Leben“.
Das anerzogene Gut und Böse
Die Indizienlage ist klar. Unsere Gefühle schlagen Alarm, wenn wir etwas Böses tun und sie belohnen uns mit guten Gefühlen, wenn wir etwas Gutes tun. Das scheint von der Natur oder Gott einprogrammiert zu sein.
Vielleicht sollten wir weniger von Gut und Böse sprechen, als vielmehr von Ordnung und Unordnung.
Denn jeder Mensch merkt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und jeder merkt, wenn sich etwas nicht ordentlich, nicht richtig anfühlt. Jeder Mensch ist an eine übergeordnete universale Ordnung angeschlossen. Es ist die Natur des Kosmos, deren Teil jedes Lebewesen ist. Fallen wir aus dieser kosmischen Ordnung, fühlen wir uns schlecht oder krank und sind nicht „in Ordnung“.
Hier sollten wir uns eigentlich auf unsere innere Eingebung verlassen dürfen. Wir achten auf unsere Körperfunktionen, ob sie uns unruhig machen oder ob wir uns wohl fühlen, ob sie uns krank machen oder gesund. Alles ganz einfach. Oder?
In früheren Zeiten hat man danach ohne Weiteres gehandelt und hat darauf vertraut, dass diese inwendigen Gefühle von Gott eingegeben wurden und man zweifelte es nicht an. Jede Religion kann mit ihren Argumenten auf diese Gegebenheit verweisen.
Mit dem Bekanntwerden anderer Religionen und Weltanschauungen aber sah man, dass Gut und Böse von anderen Menschen auch verschieden von unseren Vorstellungen sein können. Was bei uns gut zu sein schien, war für andere böse. Hier sei an das o.g. Beispiel mit dem Islamisten erinnert, für den anscheinend andere Maßstäbe gelten, wenn er andere Menschen tötet. (Wie es innen drin bei einem solchen Menschen aussieht, bleibt fraglich. Denn obwohl er denkt, er handelt gut, muss er seine Gefühle stark unterdrücken oder abtöten. Er wird dadurch „Schaden an seiner Seele nehmen“ [Mt.16,26]).
Da könnte man auf den Gedanken kommen, dass das Verständnis von Gut und Böse nur anerzogen sei. Dieser Glaube ist heute sehr weit verbreitet. Er reicht so weit, dass selbst vermutet wird, dass „Mann und Frau“, bzw. „Junge und Mädchen“ etwas gesellschaftlich Geprägtes sei. Auch die verschiedenen Interessen der Geschlechter (wie z.B. Berufe als Krankenschwester oder Kfz-Mechaniker) seien nur anerzogen, aber nicht naturgegeben.
Bei unserer Frage nach dem Guten und dem Bösen neigt man heute also zu der Annahme, dass es sich um anerzogene Maßstäbe und Verhaltensregeln handelt, die weitestgehend von den Eltern oder der Gesellschaft geprägt sind.
Wenn man also heute von Gewissen redet, so geht man in der Verhaltenspsychologie davon aus, dass dieses evolutionär durch die Prägung gesellschaftlicher Autoritäten in Jahrhunderten und Jahrtausenden gebildet wurde. Mit anderen Worten: Gewissen müsse ein gesellschaftliches und demnach menschliches Produkt sein. Es ist klar, dass man diesem dann keinen absoluten Wert beimessen kann in dem Sinne, dass das Gewissen etwas Göttliches sein könnte.