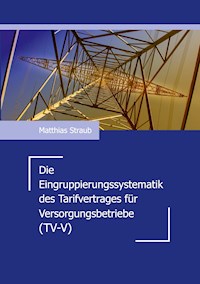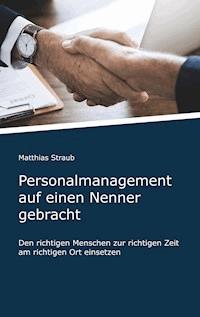Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch möchte ich ebenfalls personalwirtschaftliche Themen aufgreifen, die sich an einer meiner Grundaussagen zum Gelingen von Personalarbeit anschließt, nämlich, was macht gute Personalarbeit aus: Wenn es gelingt, den richtigen Mitarbeiter, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben! Diese Grundaussage muss richtungsweisender Parameter für alle Aktivitäten der Personalwirtschaft sein, sie sollte zumindest immer im Vordergrund stehen. Damit dies gelingt, müssen sehr viele Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Diese Einflussfaktoren beleuchtet dieses Buch aus der Sicht eines jahrelangen Praktikers. Es wird dabei bewusst auf tiefgreifende wissenschaftliche Ansätze verzichtet. Das heißt nicht, dass die gemachten Aussagen und die beschriebenen Erkenntnisse nicht wissenschaftlich belegbar wären. Der Autor möchte nur keine Zitate und Ausarbeitungen anderer Autoren wiedergeben, er möchte auch keine wissenschaftlichen Statistiken nutzen, um Aussagen zu belegen. Letztlich stellen alle Aussagen und Erkenntnisse reines Praktiker-Wissen dar. Sofern Begebenheiten und/oder Geschehnisse beschrieben werden, so sind diese tatsächlich passiert. Daran orientiert sich der Autor oftmals mit seinen fachlichen Vorschlägen für die praktische Umsetzung. Für den Autor des Buches ist es nur möglich, klare und erkenntnisreiche Aussagen zu der Branche zu treffen, in der er seit mehreren Jahrzehnten in der Personalwirtschaft unterwegs ist. Diese Branche ist die Energieversorgungsbranche und hier im näheren das kommunale Umfeld und damit im erweiterten Sinne auch der öffentliche Dienst. Für andere Branchen kann der Autor keine belegbaren Aussagen treffen. Er wird hier doch immer wieder offene Fragen stellen oder versuchen, Vergleiche mit anderen Branchen anzustellen. Nach den Beschreibungen der einzelnen Einflussfaktoren macht dieses Buch den Vorschlag, dass der aufmerksame Leser seine eigene Organisation selbst testen kann. Mit einer Art Eigenanalyse wird es dabei möglich sein, den Standort der Organisation zu bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. Präambel/Idee des Buchs/Information zum Autor
II. Hauptteil
III. Standortbestimmung/Eigen-Check
IV. Resümee
V. Danksagung
VI. Anlage
1. Art der Aufgaben
1.1. Sind die Aufgaben im Detail bekannt?
1.2. Gibt es offizielle Aufgabenbeschreibungen?
1.3. Ist Input/Output der Arbeit bekannt?
1.4. Sind Aufgabeninhalte anfällig für Veränderungen?
1.5. Ist die Qualität der Arbeit skalierbar (von einfach bis hochkompliziert)?
2. Menge der Aufgaben
2.1. Ist die Menge der Arbeit bekannt und abschätzbar/planbar?
2.2. Sind zeitliche/saisonale Schwankungen vorhanden und planbar?
2.3. Sind Mengenunterschiede handhabbar?
3. Notwendiges Wissen und Qualifikation
3.1. Ist für alle Aufgaben das notwendige Wissen bekannt?
3.2. Ist Wissen und Kompetenz ersetzbar?
3.3. Wie spezialisiert muss das Wissen sein?
3.4. Wie viel Schlüsselwissen gibt es?
3.5. Ist das Wissen/die Kompetenzen/die Qualifikationen „schnelllebig“?
3.6. Ist Wissensaufbau teuer und langwierig?
4. Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
4.1. Ist die Leistung der Mitarbeiter im Blick?
4.2. Arbeitsunfähigkeitsquote, Ausfallzeiten?
4.3. Ist Leistung und Gegenleistung in Balance?
4.4. Werden besonders gute Leistungen belohnt?
4.5. Werden schlechte Leistungen oder wird schlechtes Verhalten sanktioniert?
4.6. Exkurs: Gibt es überhaupt eine faire Bezahlung?
5. Veränderungsfähigkeit
5.1. Kann auf Änderungen in organisatorisch und personell gut reagiert werden?
5.2. Wie ist die Einstellung der Belegschaft zu Veränderungen?
5.3. Sind Führungskräfte auf Veränderungen vorbereitet?
6. Unternehmenskultur
6.1. Gibt es eine erkennbare Identifikation mit dem Unternehmen?
6.2. Gibt es ein sichtbares Grundverhalten (was macht uns aus)?
6.3. Ist das Miteinander authentisch?
6.4. Herrscht Offenheit und Klarheit im Umgang miteinander?
6.5. Werden Fehler toleriert (bei Einsicht)?
6.6. Sind nützliche Netzwerke intern/extern vorhanden?
6.7. Gibt es gesteuerte Moderation oder gar Coaching?
7. Marktverhältnisse
7.1. Ist der Markt stabil oder eher volatil?
7.2. Gibt es lange und „gefährdete“ Wertschöpfungsketten?
7.3. Gibt es große Abhängigkeiten am oder im Markt?
7.4. Gibt es komplizierte oder umfangreiche Eigentümerstrukturen?
7.5. Gibt es sogar Familien-Eigentümer?
8. Eigentümer/Gesellschafterstrukturen
8.1. Sind die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens klar?
8.2. Gibt es politische Einflüsse aus den Strukturen?
8.3. Wirkt Eigentümerschaft in die Kultur des Unternehmens?
8.4. Sind Eigentümer selbst in der Organisation?
9. Arbeitsvertragsrahmen (kollektiv/individuell)
9.1. Ist ein Tarifvertrag vorhanden?
9.2. Lässt der Tarifvertrag betriebliche Gestaltungen zu?
9.3. Sind individuelle Sonderregelungen vorhanden?
9.4. Gibt es Gewerkschaftseinfluss?
9.5. Ist das Betriebsrats Umfeld kooperativ?
9.6. Sind die Entgeltstrukturen klar und nachvollziehbar/anerkannt?
9.7. Gibt es leistungsorientierte Vergütung?
10. Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesse,
Digitalisierung
10.1. Sind Strukturen und Prozesse klar definiert?
10.2. Ist Aufbau- und Ablauforganisation bekannt und wird es gelebt?
10.3. Gibt es klare/nachvollziehbare Stellenbeschreibungen?
10.4. Findet Digitalisierung zielgerichtet und gesteuert statt?
10.5. Ist die IT-Infrastruktur passend vorhanden?
11. Führungskultur und Führungsverhalten
11.1. Wird eine „Vorlebe-Kultur“ praktiziert?
11.2. Besitzt die Führungskraft die notwendigen Soft Skills?
11.3. Werden die Führungskräfte stetig für die Führung weitergebildet?
11.4. Haben die Führungskräfte eigene zielgerichtete Netzwerke?
11.5. Werden die Führungskräfte angemessen und fair bezahlt?
11.6. Werden Führungskräfte bei Nichteignung ausgetauscht?
11.7. Finden regelmäßige 360°-Feedbacks statt?
12. Zielgerichtete Personalabrechnung und
Personalverwaltung
12.1. Findet die Abrechnung rechtlich fundiert statt?
12.2. Werden die Gehälter immer pünktlich und korrekt bezahlt?
12.3. Gibt es auch mal Probleme mit Behörden?
12.4. Erhalten die Mitarbeiter ihre Unterlagen immer zeitig und korrekt?
12.5. Gibt es elektronische Zeitwirtschaft?
Generelle Hinweise zur Geschlechter Ansprache:
Ich nutze in diesem Buch meist die männliche Form der Ansprache. Dies tue ich nur aus Vereinfachungsgründen. Selbstverständlich sind damit alle Geschlechter angesprochen.
I. Präambel/Idee des Buchs/Information zum Autor
Dieses Buch ist mein viertes Werk. In allen Veröffentlichungen habe ich mich dabei personalwirtschaftlichen Themen gewidmet. Das erste Buch war thematisch eher breit aufgestellt, die beiden folgenden Bücher hingegen waren Sonderthemen aus dem Themenfeld des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V).
Mit diesem Buch möchte ich ebenfalls personalwirtschaftliche Themen aufgreifen, die sich an einer meiner Grundaussagen zum Gelingen von Personalarbeit anschließt, nämlich, was macht gute Personalarbeit aus:
„Wenn es gelingt, den richtigen Mitarbeiter, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben!“
Diese Grundaussage muss richtungsweisender Parameter für alle Aktivitäten der Personalwirtschaft sein, sie sollte zumindest immer im Vordergrund stehen.
Damit dies gelingt, müssen sehr viele Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Diese Einflussfaktoren beleuchtet dieses Buch aus der Sicht eines jahrelangen Praktikers. Es wird dabei bewusst auf tiefgreifende wissenschaftliche Ansätze verzichtet. Das
heißt nicht, dass die gemachten Aussagen und die beschriebenen Erkenntnisse nicht wissenschaftlich belegbar wären. Der Autor möchte nur keine Zitate und Ausarbeitungen anderer Autoren wiedergeben, er möchte auch keine wissenschaftlichen Statistiken nutzen, um Aussagen zu belegen.
Letztlich stellen alle Aussagen und Erkenntnisse reines Praktiker-Wissen dar. Sofern Begebenheiten und/oder Geschehnisse beschrieben werden, so sind diese tatsächlich passiert. Daran orientiert sich der Autor oftmals mit seinen fachlichen Vorschlägen für die praktische Umsetzung.
Für den Autor des Buches ist es nur möglich, klare und erkenntnisreiche Aussagen zu der Branche zu treffen, in der er seit mehreren Jahrzehnten in der Personalwirtschaft unterwegs ist. Diese Branche ist die Energieversorgungsbranche und hier im näheren das kommunale Umfeld und damit im erweiterten Sinne auch der öffentliche Dienst. Für andere Branchen kann der Autor keine belegbaren Aussagen treffen. Er wird hier doch immer wieder offene Fragen stellen oder versuchen, Vergleiche mit anderen Branchen anzustellen.
Nach den Beschreibungen der einzelnen Einflussfaktoren macht dieses Buch den Vorschlag, heißt nicht, dass die gemachten Aussagen und die beschriebenen Erkenntnisse nicht wissenschaftlich belegbar wären. Der Autor möchte nur keine Zitate und Ausarbeitungen anderer Autoren wiedergeben, er möchte auch keine wissenschaftlichen Statistiken nutzen, um Aussagen zu belegen.
Letztlich stellen alle Aussagen und Erkenntnisse reines Praktiker-Wissen dar. Sofern Begebenheiten und/oder Geschehnisse beschrieben werden, so sind diese tatsächlich passiert. Daran orientiert sich der Autor oftmals mit seinen fachlichen Vorschlägen für die praktische Umsetzung.
Für den Autor des Buches ist es nur möglich, klare und erkenntnisreiche Aussagen zu der Branche zu treffen, in der er seit mehreren Jahrzehnten in der Personalwirtschaft unterwegs ist. Diese Branche ist die Energieversorgungsbranche und hier im näheren das kommunale Umfeld und damit im erweiterten Sinne auch der öffentliche Dienst. Für andere Branchen kann der Autor keine belegbaren Aussagen treffen. Er wird hier doch immer wieder offene Fragen stellen oder versuchen, Vergleiche mit anderen Branchen anzustellen.
Nach den Beschreibungen der einzelnen Einflussfaktoren macht dieses Buch den Vorschlag, dass der aufmerksame Leser seine eigene Organisation selbst testen kann. Mit einer Art Eigenanalyse wird es dabei möglich sein, den Standort der Organisation zu bestimmen.
Eine Abfrage, die aus den einzelnen Einflussfaktoren zusammengestellt wurde, führt mit einer hinterlegten Skalierung zu dieser Standortbestimmung. Es werden außerdem anhand der Skalierungsergebnisse Empfehlungen ausgesprochen.
Diese Idee für eine Standortbestimmung und die optionalen Hinweise zu Empfehlungen können lediglich für die Energieversorgungsbranche angestellt werden. Alle anderen Branchen können als Richtungsweisung zumindest die Faktoren für sich überprüfen, denn diese gibt es in jeder Branche.
Zum Autor:
Matthias Straub, Jahrgang 1964, schlug zunächst nach seiner Mittleren Reife eine Beamtenlaufbahn in der Kommunalverwaltung ein. Bereits kurz nach der Staatsprüfung kam er in den Bereich des Personalmanagements, dem er bis heute treu blieb.
Das Beamtenrecht ließ ihm keine Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung offen, weshalb er nach 12 Jahren den Ausstieg aus dem sicheren Hafen wagte und bei einem kommunalen Energieversorger als Sachbearbeiter in der Personalverwaltung anheuerte. Nach Abschluss eines berufsbegleitenden Betriebswirtschaftsstudiums übernahm er nach und nach Projektarbeiten im Personalbereich, führte einige Jahre eine Arbeitsgruppe in der Personalabteilung und ist nun seit vielen Jahren als Personalleiter des Unternehmens mit 700 Mitarbeitern gesamtverantwortlich für das Personalmanagement und dessen Strategie.
Seit 2012 ist er außerdem in Personalunion Geschäftsführer einer zum Konzern gehörenden Gesellschaft mit mehr als 80 Mitarbeitern und führt ausgestattet mit Prokura der Dachgesellschaft eine Hauptabteilung mit Aufgaben auch über die Personalwirtschaft hinaus. Als Mitglied im Arbeitgeberverband, als beisitzender Richter am Sozialgericht und Arbeitsgericht sowie als aktiver Netzwerker ist er immer auf der Suche nach Lösungen für den Personalbereich.
Er ist auch Mitglied im Vorstand der Verwaltungs-und Wirtschaftsakademie Rhein-Neckar e.V., die in der Metropolregion Heidelberg -Mannheim-Ludwigshafen berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge anbietet, aber auch hochwertige Weiterbildungsangebote für Betriebswirtschaft, Recht und Personal im Portfolio hat.
Als Referent und Mitglied des erweiterten Vorstandes für den Verband kommunaler Unternehmen (VKU), für den Bundesverband der Energie- und Wasserversorgung (BDEW) sowie bei Gastvorlesungen an der SRH Hochschule Heidelberg und der FH Kaiserslautern gibt er gerne sein Fachwissen und seine Praxiserfahrung weiter.
II. Hauptteil
1. Art der Aufgaben
Das Aufgabenspektrum für jeden einzelnen Arbeitnehmer ergibt sich aus den Aufgaben des Unternehmens. Und die Aufgaben des Unternehmens ergeben sich zwangsläufig aus den Zielen, die das Unternehmen setzt.
Die Ziele eines Unternehmens beziehungsweise einer Organisation sind dabei immer abhängig von vielen Faktoren. Es beginnt bereits damit, ob das Unternehmen bzw. die Organisation gewinnorientiert arbeitet, verwaltend oder eher karitativ unterwegs ist. Ein weiterer Aspekt ist das Marktumfeld, in dem das Unternehmen unterwegs ist. Wenn man die unterschiedlichen Branchen unseres Wirtschaftsraumes betrachtet, wird man schnell feststellen, dass es eine Unzahl von verschiedenen Branchen gibt.
Laut Aussage auf der Internetseite „Statista“ zur Branchenübersicht sind dort folgende Branchen für Deutschland gelistet
Agrarwirtschaft
Baugewerbe
Chemie- und Rohstoffindustrie
Dienstleistungen und Handwerk
E-Commerce
Energie und Umwelt
Finanzen, Versicherungen und Immobilien
Freizeit
Gesellschaft
Handel
Internet
Konsumgüter
Medien
Metall und Elektronik
Pharmaindustrie und Gesundheit
Sport und Fitness
Telekommunikation und IT
Tourismus und Gastronomie
Verkehr und Logistik
Werbung und Marketing
Wirtschaft und Politik
Diese hier gelisteten Branchen sind in der Regel gewinnorientiert aufgestellt. Daneben gibt es Unternehmen und Organisationen, deren erstes Ziel nicht die Absicht ist, Gewinne zu erzielen.
Derartige Unternehmen und Organisationen findet man daher meist im öffentlichen Dienst oder auch privatrechtlich organisiert in einem Unternehmen, das gesellschaftsrechtlich als GmbH oder AG von einem öffentlichen Träger gehalten wird. Auch kirchliche und karitative Einrichtungen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, etc. haben nicht originär das Ziel, Gewinn zu erzielen. Vielmehr geht es bei derartigen Einrichtungen darum, der Gesellschaft und den Menschen ein unverzichtbares Gut zur Verfügung zu stellen. Würde man zum Beispiel die Lebensrettung und die Notversorgung mit Gewinnerzielungsabsicht in die private Hand geben, würden nur noch Leistungen angeboten, die letztlich Gewinne abwerfen und das wäre für die Lebensrettung und die Notversorgung der Anfang vom Ende.
Unabhängig von der Branche und/oder von den Aufgaben muss jedes Unternehmen bzw. jede Organisation seine Aufgaben kennen. Dieses Kapitel befasst sich daher mit den einzelnen Fragestellungen im Zusammenhang mit den Aufgaben des Unternehmens und damit mit den Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter.
1.1. Sind die Aufgaben im Detail bekannt?
In jedem Unternehmen sollten die Aufgaben insgesamt bekannt sein. Damit dies möglich ist, bedarf es eines Gesamtbildes des Unternehmens, beginnend vom grundlegenden Ziel, über eine gesetzte Strategie zur Erreichung dieses Ziels, bis hin zur Beschreibung von Einzelaufgaben für die Organisation und letztlich für deren Mitarbeiter.
Bei einem Energieversorger sind die Ziele klar:
Der Bürger (der Kunde) soll jederzeit eine sichere Energieversorgung erhalten. Ergänzend wird vom Energieversorger meist auch noch die Wasserversorgung gewährleistet. Da die Wasserversorgung zusätzlich ein Grundnahrungsmittel darstellt, hat dieses Ziel eine sehr hohe Priorität. Die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme ist natürlich ebenfalls ein hohes Gut, weshalb alle Einrichtungen hierzu auch als kritische Infrastruktur im Sinne des Informationssicherheits Gesetzes gewertet werden.
Hinzu kommen bei einem Energieversorgungs-Unternehmen mit kommunaler Ausrichtung oftmals noch Aufgaben, die eher defizitär sind, da es in der Art der Aufgabe meist gar nicht anders zu handhaben ist. Hierzu zählt zum Beispiel ein Bäderbetrieb oder die Betreibung von öffentlichem Nahverkehr oder einer Bergbahn.
Alle Unternehmen in der Energieversorgungsbranche und den genannten möglichen anderen Betrieben sind in ihrer Zielsetzung relativ klar strukturiert, weshalb sich die Aufgaben gut ableiten lassen. Da die Aufgaben immer etwas mit Daseinsvorsorge oder mit Bereitstellung eines sehr wichtigen Gutes zu tun haben, sind die Aufgaben mit großem Mehrwert verbunden. Damit hat die Energieversorgungsbranche einen großen Vorteil für die Arbeitnehmer, denn der Sinn der Arbeit ist jedem klar und kann täglich nachgehalten werden.
Inwieweit ein Mehrwert in einer Branche wie die der Automobilindustrie in der heutigen Zeit noch dargestellt werden kann, muss sich die Branche selbst beantworten.
Wenn bei einer nächtlichen Stromstörung 3 Monteure, ein Meister und ein Ingenieur im Einsatz waren und binnen einer Stunde die Kunden wieder Strom hatten, zeigte sich der Mehrwert sofort. Ob ein Mehrwert noch erkennbar ist, wenn ein Ingenieur und viele andere Akteure in der Automobilindustrie das Geräusch für das Öffnen einer Autotür versuchen „noch kundengerechter“ zu korrigieren, sei dahingestellt.
Doch völlig unabhängig von derartigen Rahmenbedingungen des Marktes oder der Branche muss man sich bezüglich der Aufgaben spezielle Punkte genauer anschauen.
1.2. Gibt es offizielle Aufgabenbeschreibungen?
Bei der Frage nach der Aufgabenbeschreibung geht es um 2 wichtige Aspekte, die auf der einen Seite wichtig für das Unternehmen sind und auf der anderen Seite ebenso für den Arbeitnehmer. Aufgaben- bzw. oftmals auch Stellenbeschreibungen genannt, sollten so aufgebaut sein, dass ein unbedarfter Dritter ohne große Kenntnisse der Organisation schnell erkennt, wozu diese Stelle dient.
Die Stelle stellt in Bezug auf den Organisationsaufbau die kleinste organisatorische Einheit eines Unternehmens dar. Sie sollte daher mindestens folgende Punkte beinhalten:
Die Stellennummer und die Stellenbezeichnung
Die Darstellung der organisatorischen Eingliederung, also die Über- und Unterordnung im Sinne einer Hierarchie. Dazu zählt vor allem die Benennung der übergeordneten Stelle, also die Benennung der Führungskraft und ebenso die Benennung der unterstellten Stellen, also der Mitarbeiter, denen diese Stelle direkte Weisungen erteilen kann.
Das Ziel der Stelle muss beschrieben sein, wobei dieses in kurzen/prägnanten Sätzen dargestellt werden sollte, also eher inhaltlich auf den Punkt gebracht.
Die erforderlichen Qualifikationen für diese Stelle müssen genannt sein. Hier kann gerne in Grundqualifikationen und Zusatzqualifikation unterschieden werden.
Berufserfahrung, Kompetenzen und Soft Skills sollten ebenfalls enthalten sein. Darauf kann verzichtet werden, wenn es im Unternehmen sogenannte Jobfamilien gibt, die gut beschrieben sind und die sich mit der jeweiligen Stelle direkt verzweigen.
Die einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten mit den jeweiligen Prozentanteilen der Arbeitszeit. Auch hier sollte eher versucht werden, die Aufgaben in Gruppen aufzuteilen, so dass am Ende nicht zu kleinteilig dargestellt wird. In der Praxis hat sich bewährt, hier unterhalb von 5% keine Aufgaben zu beschreiben. Bei der Aufgabenbeschreibung sollte ergänzend für die Bewertbarkeit der Stelle unterschieden werden, ob die Aufgaben nur unterstützend sind, reine Ausführung erfolgt oder ob der Stelleninhaber dafür sogar verantwortlich ist.