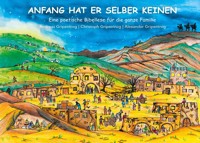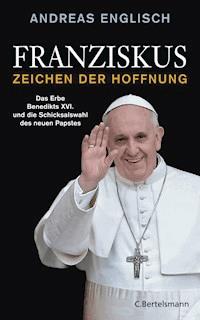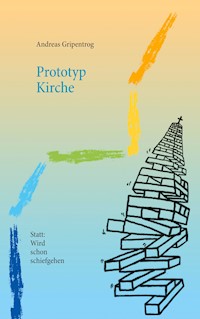
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Martin Luther behauptete in seinen Schmalkaldischen Artikeln 1538 von der Kirche: Es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Die Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Kirche ist also ganz einfach, eigentlich kinderleicht und darum auch nicht schwer zu vermitteln. Wenn der Reformator sich da mal nicht getäuscht hat! Was die Kirche sei, ist heute überhaupt nicht mehr klar, sondern in Theorie und Praxis höchst umstritten. Dieses Buch will gegen alle Verzettelung die lutherische Kinderleichtigkeit des Weidens von Gottes Herde neu zur Sprache bringen und begründen. Also alles eigentlich ganz easy, aber nur weil es den Prototyp gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor
Pfarrer M Th Andreas Gripentrog
Jahrgang 1957, ist nach seinem Theologiestudium in Basel seit 1980 Pfarrer der evangelischen Kirche in Österreich und seit 1991 in der Toleranzgemeinde Schladming tätig. Das ist eine der traditionsreichen Pfarrgemeinden, die sich nach zwei Jahrhunderten Geheimprotestantismus gleich nach dem Toleranzpatent Josephs II. 1781 neu gebildet haben. Ein Arbeitsschwerpunkt in der Schladminger Tochtergemeinde Radstadt-Altenmarkt hat zu einer besonderen Beschäftigung mit Fragen der Gemeindeentwicklung unter Diasporabedingungen geführt.
Gewidmet
meiner first Lady Christiane und den „Damen des Herrn“, meinen mich geduldig ertragenden Gemeinden
Anliegen
Martin Luther behauptete in seinen Schmalkaldischen Artikeln 1538 von der Kirche: „Es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören.“ Die Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Kirche ist also ganz einfach, eigentlich kinderleicht und darum auch nicht schwer zu vermitteln. Wenn der Reformator sich da mal nicht getäuscht hat! „Was die Kirche sei,“ ist heute überhaupt nicht mehr klar, sondern in Theorie und Praxis höchst umstritten. Dieses Buch will nicht eine zusätzliche zu den mittlerweile zahllosen Antworten auf die Frage nach der Identität der Kirche hinzufügen, die jede christliche Gemeinde selber gibt und ist. Vielmehr soll gegen alle Verzettelung die lutherische Kinderleichtigkeit des Weidens von Gottes Herde neu zur Sprache gebracht und begründet werden. Also alles eigentlich ganz easy, aber nur weil es den Prototyp gibt.
„Wichtig ist nur,
dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle,
den mir Jesus, der Herr, übertragen hat.“
Apg. 20,24 (GNÜ)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Hütte vollkriegen und die Hucke volllügen
Am selben Strang ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung
Prototyp Kirche?
Prototyp Kirche! Auftragsgemäß
Ein Kanon für fünf Stimmen - Zusammenspiel
Eine Handvoll Funktionalität - weitere Quintette
Durchlebt durchlitten - nicht ohne Gemeinde
Statt wesentlich mehr mehr Wesentliches
Grundentscheidung - nicht nur für Insider
Gottesdienst - Vollversammlung der Glaubenden
Wie wieder Glauben aus der Predigt kommt
Prototypisches Organigramm
Eine neue theologische Ausbildung
Schiefgegangen
Was jetzt?
Liedtext
Literaturverzeichnis
Vorwort
Was meinte der Baumeister beim Baubeginn für den Turm von Pisa? „Wird schon schiefgehen!“ Die Ironie dieser Redewendung findet im geneigten Wahrzeichen der italienischen Provinzhauptstadt weithin sichtbaren Ausdruck. Und ausgesagt wird eigentlich das Gegenteil dessen, was formuliert ist, nämlich dass etwas gerade nicht schiefgehen, sondern gutgehen möge. Moderne Kirchenentwicklung ist oft ebenfalls von dieser Hoffnung getragen, aber auch von dem dazugehörenden mulmigen Gefühl der Ungewissheit: Tun wir das Richtige, und tun wir es richtig?
Macht man sich einmal die Mühe, die verschiedenen Gemeindeentwicklungsmodelle zu überblicken, dann kommen einem viele dieser Versuche vor wie Bauspiele, deren Einsturz zwar mit viel Mühe, letztlich aber vergeblich versucht wird zu verhindern. Das wiederum ist zu vergleichen mit der Mangelverwaltung einer Konkursmasse. Durchaus ernsthaft wird zwar versucht, die Kirche so weit und so gut wie möglich „nach oben zu bauen“ und dadurch vorwärts zu bringen, aber ohne klare Strategie. Sogar ganz bewusst versagt man sich, was man für einen „Hochbau“ eigentlich dringend braucht, nämlich ein Konzept. Angefangen wird nicht etwa beim Auftrag oder bei einem Plan, sondern bei der Talfahrt, vor allem der der Zahlen. Christliche Gemeinden analysieren ihre Situation und kontrollieren den Bestand ihrer Ressourcen. Sie formulieren dann sogar Visionen und Leitbilder. Aber ausgerechnet dabei gerät komischer Weise das biblische Ur- und Ausgangsmodell immer mehr aus dem Blickfeld. „Der Prototyp Kirche“ spielt keine Rolle mehr. Das Original der Kirche wird lediglich als exemplarischer Fall verstanden. Fix davon für die Gemeindeentwicklung Vorgegebenes, Bestimmtes, bereits Entworfenes erscheint nicht mehr zeitgemäß. Da heißt es dann: Jede Gemeindelage hat ihre eigene Gemengelage, die nicht eine uniforme, sondern eine spezifische Behandlung erfordert. Dabei wäre meiner Meinung nach genau am Original im Neuen Testament Maß zu nehmen nicht nur für die Werte und Inhalte des Gemeindeaufbaus, sondern auch für seine Struktur. Sonst wird Gemeindeaufbau probiert, bis er kollabiert. Bis dahin ist es ein Erfolg, wenn alles gerade noch nicht zusammengebrochen ist. Und „Schiefbau“ begegnet einem eigentlich überall: Bei der organisatorischen, theologischen, geistlichen, liturgischen, homiletischen, musikalischen, universitären und natürlich auch bei der eigenen Praxis des Gemeindeaufbaus ist er zu finden. Angesichts all dieser wackeligen Kirchtürme stelle ich die These auf: Gemeindeentwicklung kann gelingen mit einer Orientierung an Gottes Plan. Gottes Hausbau muss nicht schiefgehen, wenn das Fundament der Gemeinde nicht länger untergraben und mit eigenen Ideen verzweifelt hektisch experimentiert wird, sondern wenn mit substantiellen Impulsen aus der Bibel konsequent Gottes Auftrag erfüllt wird.
Manche Anmerkung in diesem Buch fällt sehr kritisch aus und ist durchaus umstritten. Und ich bin mir dessen nicht zuletzt auch wegen Kapitel 14 natürlich bewusst. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass Gemeindeaufbau nicht angegangen werden muss unter dem Motto: Wird schon schiefgehen! Denn Gott sei Dank gibt es Weisung von höchster Stelle. Die Bedeutung dieser Weisung ist vergleichbar mit der der Verfassung für den Staat, der des Skripts für das Theaterstück, der der Familiengeschichte für das Familientreffen. Diese Weisung neu zu beachten und zu beherzigen, ermutigt dieses Buch.
Ich bedanke mich für alle Unterstützung bei seiner Entstehung bei meiner Frau Christiane, meinem Sohn Alexander und meiner Schwester Wera.
1. Die Hütte vollkriegen und die Hucke volllügen
Bei einem kirchlichen Kurs für Lektoren: Gleich zu Beginn beim Erfahrungsaustausch wird der Reihe nach der rückläufige Gottesdienstbesuch beklagt: „Wir müssen schauen, dass wieder mehr Leute in die Kirche kommen.“ Es folgt ein Austausch über die Ideen und Versuche in den Gemeinden: Es gibt Krabbel-, Gospel-, Kinder-, Scater-, Sportler-, Seeker-(Suchende-), Jugend-, Familien-, Segnungs-, Heilungs-, Thomas-, Taizé-, Go-special-, Motorrad-, Berg-, Strand-, Vormittags-, 11vor11-, Abend-, 0-8-16-Gottesdienste. Wir haben ein Begrüßungs-, Moderations-, Technik-, Musik-, Küchen-, Seelsorge-, Theater-, Kinderteam. Und das Ergebnis? Trotz etlicher Highlights hält sich der Erfolg insgesamt in Grenzen. Einige dieser Gottesdienste machen sich gegenseitig Konkurrenz und vor allem viele Mitarbeitende müde.1
Bei einem Kongress für Gemeindeentwicklung geht es in einer Arbeitsgruppe um das Thema: Kleingruppen und Hauskreise, und es stellt sich heraus: In kreativen Gemeinden gibt es nichts, was es nicht gibt: Gesprächskreise, Leiterkreise, Mitarbeiterkreise, Gebetskreise, Männerkreise, Frauenkreise, Bibelrunden, Mutter-Kind-Gruppen, Dienstgruppen und sogar Stammtische. Schnell kommen aber auch die Probleme zur Sprache: Kleingruppen in Gemeinden sind manchmal elitär exklusiv, isoliert, funktionieren nicht. Sie benötigen qualifizierte Leiter, die nur schwer zu finden und zu motivieren sind. Hauskreise schlafen ein und sterben ab mit oder ohne Abschied. Es gibt in den Gemeinden eine bunte und gleichzeitig verwirrende, manchmal sogar erschlagende Vielfalt, neben großer Begeisterung für große Möglichkeiten, große Schwierigkeiten genau damit.
Was sind die Gründe für diesen Zwiespalt? Wie ist damit umzugehen? Bei kirchlichen Angeboten wird mittlerweile vermehrt danach gefragt, ob das Angebot auch zur Nachfrage gepasst hat, ob also am Kunden vorbei produziert und wieder einmal auf eine Frage geantwortet wurde, die niemand gestellt hatte. Das ist die große Sorge beim Weiden der Herde Gottes geworden: Attraktive Programme finden, die ankommen. Treffende Angebote machen, die auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit eingehen. Gerade christliche Veranstaltungen, deren Besuch sich ja schon länger nicht mehr von selbst versteht, müssen nach dem Geschmack ihrer Teilnehmer entworfen und auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sein. Der Erfolg dabei wird an den Besucherzahlen gemessen. Gut besuchte Veranstaltungen gelten als gelungen. Schlechter Besuch weist nicht nur auf Qualitätsmängel, sondern auch auf ein unpassendes Format hin.
Das Problem dabei ist, abgesehen von der permanenten Verunsicherung, dass sich als Ausweg eigentlich nur die Anpassung an das, was gerade „in“ ist, anbietet, eine Reaktion, die aber immer einen Schritt zu spät kommt und vom Zeitgeist abhängig macht. Klaus Douglass hat das Dilemma der Kirche bereits 2001 in seinem Buch „Die neue Reformation“ ganz grundsätzlich als Relevanzkrise und als Identitätskrise beschrieben und so erklärt: „Die Relevanzkrise besteht darin, dass die Kirche die Menschen von heute nicht mehr erreicht. Die Identitätskrise ist die, dass letztlich niemandem deutlich ist, was die Kirche eigentlich zur Kirche macht. Beide Krisen stehen in Wechselwirkung miteinander. Je stärker man versucht, der einen Krise zu entkommen, umso sicherer gerät man in die Fänge der jeweils anderen. Das bedeutet: Je mehr die Kirche versucht, in den Problemen der Gegenwart relevant zu werden, um so tiefer gerät sie in eine Krise ihrer eigenen christlichen Identität. Je mehr sie hingegen auf ihrer eigenen Identität beharrt, desto irrelevanter und unglaubwürdiger erscheint sie in unserer Zeit. Die Kirche steht offensichtlich vor der unglücklichen Wahl, entweder den Kontakt zu ihrem Ursprung oder den zu den Menschen zu verlieren.“2 In diesem Dilemma ist die Kirche insbesondere in ihrer volkskirchlichen Struktur zur Phantomkirche geworden. Ihre Zahlen stimmen überhaupt nicht mehr. Sie sind wie Mondpreise. Eigentlich muss man sie immer durch 10 teilen: Von der „Seelenzahl“ einer landeskirchlichen Gemeinde kommen im günstigsten Fall 10 Prozent zum Gottesdienst. Von diesen 10 Prozent engagieren sich 10 Prozent als Mitarbeitende. Davon sind schließlich 10 Prozent, also insgesamt 1 Promille von der Art, dass man mit ihnen „Pferde stehlen“ kann. Bei einer Seelenzahl von 1000 ist das genau eine Person!
Dieses Buch versucht mit der Beschreibung des Prototyps Kirche, einen Ausweg aus diesem Dilemma zu zeigen. Mancher Gedanke dazu wird ungewöhnlich und mancher Vorschlag unkonventionell sein z. B. der strenge Rat: Statt für/pro viel sein, Profil haben. Die größte Überraschung ist aber wohl die Behauptung eines „Patentrezeptes“ für das Weiden der Herde Gottes.3 Das ist kein Witz, sondern durchaus ernstgemeint und richtet sich gegen die Vergleichgültigung biblischer Gemeindewachstumsprinzipien. Weil es mir in diesem Buch um den Prototyp Kirche geht, unterscheide ich auch nicht prinzipiell zwischen konfessionell und historisch natürlich unterschiedlichen Kirchen, sondern lege gut ökumenisch allen den biblischen Prototyp zugrunde. Rick Warren schreibt in seinem Buch „Kirche mit Vision“: Es sind zwar „alle möglichen Arten von Gemeinden notwendig, um alle möglichen Arten von Menschen zu erreichen,“4 aber die Strategie dafür betrachtet er als biblisch vorgegeben. Wenn das nicht klar ist, werden die Prinzipien des Gemeindeaufbaus verwechselt mit den variablen Methoden ihrer Umsetzung. Vorgestellt wird hier ein befreiendes, weil leistbares und gleichzeitig beschränkendes, weil aussortierendes Konzept, das nicht nur eine To-do-Liste, sondern auch eine Don´t-do-Liste hervorbringt mit vielleicht einer Menge guter Ideen, die alle auch nicht aufgenommen werden, weil sie schlicht außerhalb des Fokus liegen.
Ans Herz gelegt werden soll ein prototypischer Kirchenplan mit nicht mehr und nicht weniger als exakt fünf Aufgaben. Diese Mandate werden ausführlich begründet und mit anderen „Quintetten“ bildlich veranschaulicht. Dadurch sollen die Funktionen der fünf Komponenten und ihre innere Zusammengehörigkeit deutlich werden. Auf der Grundlage dieses fünfteiligen Programmpaketes kann die Anbiederung an den Zeitgeist und verzweifeltes Experimentieren beim Weiden der Herde Gottes ebenso vermieden werden wie die Abschottung von der „bösen“ Welt im Rückzug auf eine Insel der Seligen, wo Innovation ausgeschlossen ist so nach dem Motto: „Wie es war im Anfang jetzt und immerdar.“
Nicht modernistisch adaptiert, nicht technokratisch ökonomisiert, nicht amerikanisch abkopiert, sondern einfach nur gut soll sie sein die Gemeindeentwicklung. Und klar muss sie werden. Gegen eine sich ausbreitende Begriffsverwirrung sollen die Grundbegriffe und Kernworte der Gemeindeentwicklung neu verständlich gemacht werden. Die Klärung von Missverständnissen und Verwechslungen soll Ermüdete ermutigen, sich nicht zurückzuziehen, sondern trotzdem weiter mitzuarbeiten und statt jetzt erst mal an sich selbst zu denken, jetzt erst recht Gemeinde Jesu zu leben und statt einem Schief- und Wackelbau den Prototyp Kirche als Hoffnung für die Welt zu präsentieren.
1 Vgl. Jes. 47,13:
„Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne.“
2 K. Douglass: Die neue Reformation 96 Thesen zur Zukunft der Kirche, Stuttgart 2001 S. 18-22
3 Statt „Gemeindeaufbau“ verwende ich wegen der Möglichkeit eines technokratischen Missverständnisses eher den Begriff „Gemeindeentwicklung“ oder metaphorisch die Formulierung „Weiden der Herde Gottes.“ Gemeinde sich entwickeln lassen und aktiv entwickeln gehört aber zusammen. Vgl. K. Eickhoff: Gemeinde entwickeln, Göttingen 1992
4 R. Warren: Kirche mit Vision Gemeinde, die den Auftrag Gottes lebt, Asslar 1998 S. 62
Vieles in diesem Buch ist eine relecture seines Bestsellers. Wie Warren verwende ich die Begriffe „Kirche“ und „Gemeinde“ als gegenseitig füreinander offene Containerbegriffe.
2. Am selben Strang ziehen, aber nicht in die gleiche Richtung
Bei jedem Bau ist das Fundament mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Die Belastbarkeit des Unterbaus ist genau zu beachten. Für den Gemeindeaufbau bedeutet das die Frage: Wie gut ist die kirchliche Unterlage? Was trägt Gemeinden?
Jede christliche Gemeinde wird von etwas bestimmt. Und um zu erkennen, in welche Richtung sie bewegt gehört, muss ihr klar werden, aus welcher sie kommt. Treibende Kräfte funktionieren wie Filter, die die Programme einer Gemeinde sortieren, oder wie Brillen, durch die alle Aktivitäten betrachtet werden. Treibende Kräfte können bewusst oder unbewusst wirken gelassen werden. Jedenfalls bewegen sie Gemeinden in unterschiedliche Richtungen, und das birgt Konfliktpotential. Darum beginnt eine zukunftsweisende Standortbestimmung mit der Analyse dieser Ausgangspunkte. Rick Warren reflektiert, wovon Gemeinden geprägt sein können und macht dabei zunächst die treibenden Kräfte aus, die Gemeinden von ihrer eigentlichen Bestimmung abhalten:5
Gemeinden können von Traditionen bestimmt sein. Und diese meist lange schon andauernde Prägung hat sie konservativ werden lassen. Solche Gemeinden wollen am liebsten das Vergangene immer weiter fortsetzen und sind darum skeptisch gegenüber jeder Veränderung. Ihnen sind stabile Verhältnisse wichtig. Ihr Motto lautet: „Das haben wir schon immer so gemacht.“
Gemeinden können von Schlüsselfiguren bestimmt sein. Wenn zum Beispiel Leitende als prägende Persönlichkeiten Gemeinden ihren Stempel aufgedrückt haben, ist dadurch unter Umständen eine große Unselbständigkeit entstanden, die Probleme bereitet, wenn diese Gallionsfiguren abgetreten sind.
Gemeinden können von Finanzen