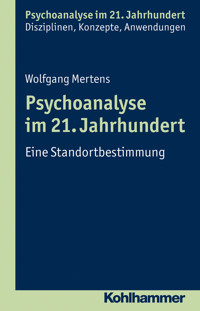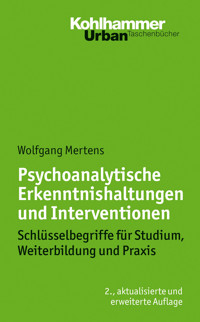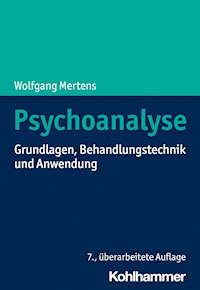
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
This introductory textbook is addressed to those wishing to gain a clear overview on chosen aspects of psychoanalysis and wanting to understand why this discipline remains important in viewing psychological, medical phenomena as well as phenomena from the field of the social and cultural studies. The following topics are presented in detail: psychoanalytical metapsychology, psychoanalytical developmental theories, general and special psychoanalytical theories on diseases, psychoanalytical techniques of treatment as well as implementation of psychoanalysis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort zur 7. Auflage
1 Psychoanalyse – ein kleiner Überblick über einige zeitgenössische Themen
1.1 Psychoanalyse in Zeiten der Corona- und Klimakrise
1.2 Psychoanalyse zurück an die Universität? Chancen und Probleme angesichts der Direktausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten
1.2.1 Die Situation nach Freud in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
1.2.2 Die Einrichtung des Direktstudiums Psychotherapie und was es dabei zu beachten gilt
1.2.3 Skizze eines psychoanalytischen Forschungsprojekts im universitären Kontext
2 Pluralität psychoanalytischer Richtungen und Konzepte
2.1 Einige Gedanken zur Pluralität psychoanalytischer Richtungen
2.1.1 Freud und die klassische Psychoanalyse
2.1.2 Amerikanische Ich-Psychologie
2.1.3 Objektbeziehungstheorie
2.1.4 Selbstpsychologie
2.1.5 Interpersonelle, relationale und intersubjektive Psychoanalyse
2.1.6 Bindungsforschung
2.1.7 Psychoanalytische Säuglingsforschung
2.1.8 Französische Psychoanalyse
2.1.9 Deutsche Psychoanalyse
2.1.10 Gemeinsame Schnittmenge?
2.2 Einige grundlegende Veränderungen im psychoanalytischen Theoriekorpus
3 Grundkonzepte der Psychodynamik
3.1 Affektregulierungsstörung
3.2 Symbolisierungsstörung
3.3 Trauma und Traumatisierung
3.4 Unbewusster Konflikt
3.5 Unbewusste Phantasie
3.6 Pathogene Überzeugung
3.7 Entwicklungshemmung
3.8 Ichstrukturelle Beeinträchtigung
3.9 Selbstwertstörung
3.10 Dysfunktionales Beziehungsverhalten
3.11 Persönlichkeitsstörung
3.12 Ressourcen, Fähigkeiten und Talente
3.13 Unterschiedliche Akzentsetzungen
4 Psychoanalytische Metapsychologie
4.1 Metapsychologische Gesichtspunkte im zeitgenössischen Verständnis
4.1.1 Der emotional-kommunikative Gesichtspunkt
4.1.2 Der dynamische Gesichtspunkt
4.1.3 Der topische Gesichtspunkt
4.1.4 Der strukturelle Gesichtspunkt
4.1.5 Der genetische Gesichtspunkt
4.1.6 Der adaptiv-interaktionelle Gesichtspunkt
4.1.7 Der psychosoziale Gesichtspunkt
4.2 Theoretische Modelle und Erkenntnisperspektiven sind unentbehrlich
5 Komplexe Entscheidungen in psychodynamischen Therapien
5.1 Der Ausgangspunkt: Konzeptvielfalt
5.2 Einige Entscheidungsprozesse – ein Überblick
5.3 Exkurs zur sensorischen Registration und zum adaptiven Reagieren
5.4 Implikationen des unbewussten kommunikativen und adaptiven Geschehens
5.5 Grundlagen für Entscheidungsprozesse
5.5.1 Freies Erzählenlassen oder dialogisches Begleiten?
5.5.2 Abstinenz und Neutralität bewahren oder spontan und authentisch kommunizieren?
5.5.3 Einsichten ermöglichen oder korrigierende, emotionale Erfahrungen bereitstellen?
5.5.4 Abgewehrte Bedeutungen im Patienten entdecken oder sie in der intersubjektiven Begegnung neu erschaffen?
5.5.5 Übertragungs-Inszenierungen nur im Außen analysieren oder sich selbst als Mitspieler begreifen, der für die Inszenierung verwendet wird?
5.5.6 Analytiker als Objekt von alten Beziehungserfahrungen oder als Entwicklungsobjekt, um neue Beziehungserfahrungen zu machen?
5.5.7 Genetische Deutung mit Rekonstruktion und Konstruktion oder Beziehung im Hier und Jetzt?
5.5.8 Arbeiten an der vorbewussten Oberfläche versus Deuten Angst bereitender unbewusster Phantasien?
6 Die Vielfalt an Perspektiven in supervisorischen Prozessen: »Und was soll ich jetzt tun?«
Nachwort
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Autor
Prof. em. Dr. Wolfgang Mertens war von 1982 bis 2011 Professor für Klinische Psychologie und Psychoanalyse am Department für Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Psychoanalytiker und psychoanalytischer Psychotherapeut (DGPT) und war viele Jahre als Dozent, Lehranalytiker und Supervisor der Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie München e. V. tätig.
Wolfgang Mertens
Psychoanalyse
Grundlagen, Behandlungstechnikund Anwendung
7., überarbeitete Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
7., überarbeitete Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-037142-2
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-037143-9epub:ISBN 978-3-17-037144-6
Vorwort zur 7. Auflage
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches sind 40, seit dem Erscheinen der 6. Auflage 15 Jahre vergangen. Nicht nur 40 Jahre, sondern selbst 15 Jahre gelten in wissenschaftlichen Diskursen als eine sehr lange Zeit, in der viele, vor allem naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse in der Regel gründlich überholt sind. Nun lassen sich Teile von psychoanalytischen Theorien zwar durchaus empirisch beforschen, aber in ihrem grundlegenden Selbstverständnis ist die Psychoanalyse keine Naturwissenschaft im klassischen Sinn, sondern eine dialogische Suche nach den unbewussten Beweggründen des individuellen, aber auch kollektiven Handelns, wenngleich auch auf dem Hintergrund anthropologischer Gegebenheiten. Diese Suche kann zwar mit sich verändernden Begrifflichkeiten und Konzepten wie im vorliegenden Buch beschrieben werden, aber das Grundanliegen der Psychoanalyse, das Aufspüren nicht bewusster, nur blindlings agierter Handlungsabsichten, die Dekonstruktion und Neukonstruktion von Bedeutungen, entzieht sich der Auffassung eines permanenten und immer schnelleren Wandels. Allerdings gehen in dieses Verstehen selbstverständlich gesellschaftliche und historische Hintergründe mit ein, die sich auch über kürzere Zeiträume verändern können.
Es existieren somit in den verschiedenen Modellen, die von Psychoanalytikern in den zurückliegenden 15 bis 20 Jahren ausgearbeitet wurden, durchaus Weiterentwicklungen, die es als gerechtfertigt erscheinen lassen, einige Änderungen in dieser Auflage vorzunehmen.
Vor 15 Jahren spielten beispielsweise die Existenz einer Theorienpluralität, damit verbunden eine größere Offenheit für ein »learning from many psychoanalytic masters« sowie die Bereitschaft für eine noch stärkere interdisziplinäre Öffnung der Psychoanalyse gegenüber ihren Nachbarwissenschaften eine große Rolle. Letztere schien insbesondere angesichts der Verunsicherungen, welcher die Psychoanalyse von verschiedenen Seiten ausgesetzt war, angezeigt zu sein. Würde es zum Beispiel möglich sein, mit bildgebenden Verfahren Veränderungen im Gehirn von psychoanalytischen Patienten nachzuweisen, wäre dies ein empirisch handfester »Beweis« für die Wirksamkeit analytischer Psychotherapien? Mittlerweile ist der Hype um neuropsychologische Belege unbewusster Prozesse jedoch schon wieder im Abflauen begriffen, zu viele methodische und erkenntnistheoretische Schwierigkeiten haben sich aufgetan. Zudem erfordert eine interdisziplinäre Öffnung auch keine einfache Übernahme, sondern zunächst einmal eine fundierte Auseinandersetzung mit Befunden, zum Beispiel aus der Kleinkindforschung, der Bindungsforschung, der Gedächtnis- und Emotionsforschung, der Cognitive Science, den Neurowissenschaften, aber auch den Kultur- und Geisteswissenschaften. Denn die unterschiedlichen Methoden und Menschenbild-Annahmen dieser Forschungsbereiche müssen sorgfältig studiert werden, um zu klären, inwieweit die damit erzielten Ergebnisse für das genuin psychoanalytische Vorgehen überhaupt aussagekräftig sind.
Und schließlich war auch die psychodynamische Psychotherapieforschung ein vor allem berufspolitisch wichtiges und stark expandierendes Thema. Maßgeblich waren hierbei vor allem die Forschungsprojekte von Marianne Leuzinger-Bohleber und Cord Benecke.
In den letzten Jahren war für mich die erstaunlichste Theorie-Entwicklung jedoch die folgende: Das Thema der Psychosexualität und eine erneute Auseinandersetzung um ihren Stellenwert sind in die Psychoanalyse zurückgekehrt! Viele Jahre war von ihr so gut wie keine Rede mehr. Die Freud'sche Triebtheorie galt als hoffnungslos veraltet, wozu auch viele Missverständnisse, Übersetzungsfehler und die Unlust, sich mit ihr gründlicher zu beschäftigen, beigetragen haben. Statt entscheidende Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung an der Verdrängung des Sexualtriebs und seinen weiteren Schicksalen festzumachen, wurde die Subjektkonstitution nur noch im Kontext der Bindung sowie der Entwicklung von Urvertrauen, Sicherheit und Selbstwertgefühl, Instinktsystemen und Motiven, die der Selbsterhaltung dienen, erforscht. Verschiedene Objektbeziehungstheorien wie die von Donald Winnicott, Wilfred Bion, die Selbstpsychologie von Heinz Kohut, aber auch interpersonelle und relationale Theorien von Harry Stack Sullivan bis Stephen A. Mitchell legten in unterschiedlichem Ausmaß so gut wie kein Gewicht mehr auf die Psychosexualität. Erst durch das Werk von Jean Laplanche, der die Freud'sche Triebtheorie auf ein neues Fundament stellte, wurde die Psychosexualität nach und nach wieder zum Thema. Auch wenn mittlerweile einige kritische Einwände gegen seine Allgemeine Verführungstheorie erhoben wurden, hat er fruchtbare Diskussionen darüber angestoßen, wie eine revidierte Triebtheorie in Verbindung mit der Bindungstheorie der zweiten und dritten Generation nach Bowlbys bahnbrechendem Werk eine umfassendere Erklärungsbasis bereitstellen kann. So haben etwa Jessica Benjamin im Rahmen ihres Anerkennungs-Modells oder Peter Fonagy und Mary Target im Rahmen von Mentalisierungs-Modellen einen wichtigen Beitrag zu dieser Diskussion geleistet. Diese verschiedenen Modelle lassen eine erklärungsstarke Theorie entstehen, in der die Befunde von Kleinkind- und Bindungsforschern mit dem Kosmos an mütterlicher Fürsorge, Empathie und Reflexionsfähigkeit ebenso integriert sind wie die Tatsache, dass Mütter/Eltern sexuelle Wesen mit erotischen Phantasien und rätselhaften Botschaften sind, die ihrem Kind unbewusst übermittelt werden. Damit wird die Psychoanalyse wieder psychoanalytisch, wenn auch nicht mehr im klassischen Sinn. Und selbstverständlich ändern sich im Zeitalter des Internet auch die Erscheinungsformen, an denen psychosexuelle Phantasien heutzutage festgemacht werden und zum Ausdruck kommen können. Das sexuelle Begehren und Phantasieren spielen nunmehr in Teilen der psychoanalytischen Theorie und Praxis – wie im wirklichen Leben – wieder eine herausragende Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit und zwischenmenschlicher Beziehungen (s. Mertens, in Vorb.).
Nach wie vor gilt die Psychoanalyse mit ihrem weitverzweigten Theoriegebäude trotz der gelegentlichen unsachgemäßen Kritik in manchen Medien als die interessanteste Theorie im human- und sozialwissenschaftlichen Bereich und als einziges Therapieverfahren, das langfristige, tiefgreifende und nachhaltige Veränderungen in einem Menschen bewirken kann. Dies wurde vor einigen Jahren noch stark angezweifelt und es wurden sogar einige Philosophen bemüht, um die Psychoanalyse in die Nähe von nicht beweisbarer Esoterik zu befördern. In den 1980er Jahren galt die wissenschaftstheoretische Kritik insbesondere von Adolf Grünbaum (z. B. 1988) als ein viel diskutierter Referenzpunkt für die Einschätzung der Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse. Immerhin gestand er ihr – im Unterschied zu seinem Kollegen Karl Popper – eine experimentelle Überprüfbarkeit zu, die jedoch viel zu wenig erfolgt sei. Mittlerweile sind die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen aber sehr viel differenzierter geworden (z. B. Schülein, 1999a,b; Nissen, 2010, 2012; Warsitz und Küchenhoff, 2015; Guggenheim et al., 2016). Das Experiment nimmt zwar in den Naturwissenschaften einen hohen Rang ein, aber für die Psychoanalyse gelten andere Kriterien der Überprüfung und Bestätigung als lediglich das experimentell Manipulier- und Messbare.
Immer mehr wird auch erkennbar, dass die mitunter heftige Ablehnung, welche die Psychoanalyse von Journalisten als Meinungsmachern und einigen Philosophen erfuhr, andere Gründe hatte als ihre Argumentationen dem gutgläubigen Leser glauben machen wollten: Diese Personen versuchten bei ihren Lesern damit zu punkten, dass sie die ängstigende Macht nur schwer steuerbarer unbewusster psychischer Vorgänge im Leben jedes einzelnen Menschen, aber auch innerhalb eines kollektiven Ganzen für unerheblich erklärten, indem sie auf das angebliche Überholtsein der Psychoanalyse verwiesen. Aber die Auseinandersetzung mit der Komplexität des Psychischen, mit den »Tiefen der Seele« gehört seit Jahrhunderten zu den ethischen und philosophischen Herausforderungen unseres Menschseins und kann niemals veralten. Denn letztlich geht es dabei um die Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins für einen selbst und selbstverständlich auch für alle Menschen. Aber immer wieder stellen sich diesem Vorhaben individuelle wie kollektive Verweigerungshaltungen und Widerstände entgegen. Auch in der Gegenwart hat es den Anschein, als dürften z. B. die Ursachen und Folgen der herannahenden Klimakatastrophe nicht wirklich gesehen und entsprechende Veränderungen vorgenommen werden (s. Kap. 1.1).
Mit dem bereits im Herbst 2021 begonnenen, lange erhofften und stark umkämpften neuen Studium »Direktausbildung Psychotherapie« an einigen Psychologischen Fakultäten Deutschlands ergeben sich wichtige Überlegungen zu der Frage: In welcher Form kann die Psychoanalyse zukünftig an der Universität gelehrt werden? In Kapitel 1.2 »Psychoanalyse zurück an die Universität? Chancen und Probleme angesichts der Direktausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten« wird der Frage nachgegangen, ob damit wirklich ein fairer Wettstreit der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren, wie kognitiv behaviorale, psychoanalytische/psychodynamische und systemtheoretische, ermöglicht werden kann und ob der Fortbestand der Psychoanalyse tatsächlich von ihrer Wiederaufnahme in die psychologischen und medizinischen Fakultäten abhängig ist, oder ob nicht andere Formen der kritischen Auseinandersetzung gefunden werden sollten.
Für diese 7. Auflage wurden die restlichen Kapitel nahezu komplett neu verfasst.
Ich danke meiner Lektorin, Frau Kathrin Kastl, für die sorgfältige Betreuung des Manuskripts sowie Herrn Dr. Ruprecht Poensgen für die jahrelange gute Zusammenarbeit.
Wolfgang MertensMünchen, im Juni 2022
1 Psychoanalyse – ein kleiner Überblick über einige zeitgenössische Themen
1.1 Psychoanalyse in Zeiten der Corona- und Klimakrise
Psychoanalytisches Denken war seit jeher gesellschaftskritisch. Schon früh stieß Freud (1905e, S. 176) bei seinem Versuch, psychisches Leiden als individuelles, lebensgeschichtlich bedingtes zu begreifen, auf die soziale und kulturelle Prägung neurotischer Konflikte:
»Aus der Natur der Dinge, welche das Material der Psychoanalyse bilden, folgt, dass wir in unseren Krankengeschichten den reinen menschlichen und sozialen Verhältnissen der Kranken ebenso viel Aufmerksamkeit schuldig sind wie den somatischen Daten und den Krankheitssymptomen.«
Die psychoanalytische Kulturkritik richtete den Blick auf gesellschaftliche Institutionen, Ideologien und politische Denkweisen, wie in der Gegenwart etwa den neoliberalen Wettbewerbsstaat. Dieser bringt ja nicht nur Verbesserungen zuvor ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen und entsprechender Zugewinne an individueller Freiheit mit sich, sondern er trägt auch zu einem übersteigerten Anspruchs- und Leistungsdenken, zu einer immer größeren Hektik, zu übermäßigem Konsum und Ressourcenverbrauch und schließlich zur Umweltzerstörung, Klimaveränderung, Einschränkung der Artenvielfalt und möglicherweise auch zu Zoonosen bei.
Seit dem Frühjahr 2020 hielt eine Pandemie, deren Ende noch nicht abzusehen ist, die Welt in Atem. Je länger sie dauerte, desto gravierender wurden ihre Auswirkungen in psychosozialer und ökonomischer Hinsicht. Und obwohl erstaunliche Anstrengungen von Seiten der Politik und der Bürger in unserem Land unternommen wurden, blieb aus psychoanalytischer Sicht dennoch eine schmerzliche Lücke.
Denn was in den vielen Verlautbarungen und in Talkshows, als den nahezu täglich stattfindenden medialen Bühnen der Politikerörterung, auf jeden Fall fehlte, war eine intensive Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen tieferliegenden Ängsten, welche diese Pandemie in nahezu jedem Einzelnen wachrief. Drohender Arbeitsplatzverlust, Reduzierung unbefangener sozialer Kontakte, Verbannung von Kindern und Jugendlichen in die häusliche Isolation und die Gefährdung von Bildungschancen, Schließung von Sportstätten, Restaurants, Hotels sowie Reiseverbote schränkten auf unterschiedliche Weise das Leben mehr oder weniger drastisch ein. Aber welche existentiellen Ängste und subdepressive Stimmungen wurden dadurch ausgelöst? Welche Gefühle der Verlorenheit in der bislang einigermaßen vertrauten Welt tauchten hierdurch auf? Welche tiefsitzenden und zumeist verleugneten Befürchtungen vor der Endlichkeit des Lebens, vor unheilbaren Krankheiten, der Vereinsamung und dem Sterbenmüssen ließen sich nicht länger wegschieben? Welche intergenerationell überlieferten Traumatisierungen früherer Kriegs- und Nachkriegserfahrungen von Gewalt, Tod, Vertreibung und jahrelangem Flüchtlingsdasein lebten bei älteren Menschen wieder auf? Welche Folgen hatten diese Einschränkungen aber auch für das unbekümmerte Jungsein- und Über-die-Stränge-schlagen-Dürfen von Kindern und Heranwachsenden? Wenn die Gefahren durch immer erneute Virusvarianten und den Klimawandel nicht länger verleugnet werden können, welche Zukunftsaussichten ergeben sich dann für die heranwachsende Generation? Fanden und finden diese – außerhalb therapeutischer Praxen – ausreichend Gehör?
Sehr viele der medialen Diskussionen kreisten nahezu ausschließlich um virologische und epidemiologische Fakten. Aber nur ganz selten kamen auch medizinsoziologische Erörterungen über den sozialen Status der von der Pandemie am meisten betroffenen Menschen mit prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen zur Sprache; so gut wie nie wurde ausgeführt, dass die Ansteckung mit dem Virus mit solchen Zivilisationskrankheiten stark korreliert, die vermeidbar wären; ganz selten nur kamen in den Medien Psychologen und Psychoanalytiker zu Wort, die darauf hätten hinweisen können, wie sehr ein reflektiertes Umgehenkönnen mit psychischen Belastungen und Konflikten zur Stärkung des Immunsystems beitragen kann.
Zwangsläufig hat die Corona-Pandemie Menschen in vielen Ländern dieser Welt von der herannahenden Klimakrise abgelenkt, weil es in erster Linie die Gesundheit und das ökonomische Überleben zu sichern galt. Und es stand zu befürchten, dass sobald der Befreiungsschlag gegen das Virus und seine Mutanten möglich würde, mit einer rasanten Aufholjagd in puncto Reisen, Mobilität, Konsum zu rechnen wäre.
Bereits der Umgang mit Corona-Verharmlosern und Impfverweigerern machte deutlich, wie rücksichtslos und wenig solidarisch ein Großteil dieser Menschen mit der Tatsache umgeht, dass es nicht in das Belieben des Einzelnen gestellt sein kann, wie man sich mit den Gefährdungen durch das Corona-Virus arrangiert. Man kann nicht naiv und egozentrisch darauf bestehen, sein Freiheitsstreben verwirklichen und sein Recht auf körperliche Unversehrtheit wahren zu wollen, ohne sich klarzumachen, dass man als Individuum unweigerlich Teil einer Gemeinschaft ist, von deren Leistungen und Solidarität das eigene Wohlergehen in nahezu jedem Augenblick abhängt. Auch wenn man diese Menschen gewiss nicht in einen Topf werfen kann, so muss man – abgesehen von denjenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen – die restliche, viel größere Gruppe differenziert betrachten: Da gibt es jene, die die Pandemie dazu benützen, ihre Wut und ihre Neidgefühle auf »die da oben« endlich hinausbrüllen zu können, da gibt es »narzisstisch gestörte« Menschen und Psychopathen, denen die Gesundheit ihrer Mitmenschen völlig egal ist, da gibt es Personen mit paranoiden Ängsten, die einem Eingriff in ihren Körper aufgrund unbewältigter Traumatisierungen mit Todesangst begegnen, da halten viele an einem kindlich gebliebenen Denkmodus fest, dass sie nur ihrem »Bauchgefühl«, psychoanalytisch betrachtet, ihrem Äquivalenzmodus folgen. Und schließlich gibt es noch viele, die Heilslehren, esoterischem Denken, mitunter auch einem links-liberalen, aber gründlich missverstandenen Freiheitsdenken folgen und sich dabei für klüger und aufgeklärter halten als die große Masse der autoritätsgläubigen und ängstlichen Schafe, was letztlich wiederum ein narzisstisch motiviertes Überlegenheitsdenken ausdrückt.
Aber wie können wir es mit Blick auf die herannahende Klimakatastrophe dann erst schaffen, uns von der Illusion einer grenzenlosen Freiheit, bei der alles technisch und ökonomisch Machbare als erstrebenswertes Ziel imponiert, bei der jeder nach Belieben Ressourcen dieser Erde verschwenden darf, nach und nach zu verabschieden und eine Kultur der Rücksichtnahme auf alles Lebendige und die Natur zu verwirklichen, auch wenn dies mit erheblichen Einschränkungen lieb gewordener Gewohnheiten einhergeht? Allein schon die Vorstellung, sich von einem überdimensionierten, tonnenschweren und vermeintlich Geltung und Macht signalisierenden SUV trennen zu sollen, löst bei vielen Menschen heftige Aversionen aus.
Das immer wieder angeführte Argument, wie widersinnig und »freiheitsberaubend« eine Verzichtslogik ist, sollte aber nicht übersehen lassen, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich durch die dringend notwendigen Einstellungs- und Verhaltensänderungen ergeben können und welche neuen Lebensweisen vorstellbar würden, die jenseits von übermäßigem, oftmals auch unsinnigem Konsum und herkömmlichen Befriedigungen neue Horizonte an Sinn und erstrebenswerten humanen Wertvorstellungen erahnen ließen. Anders als genetische Prägungen könnten sich kulturelle Gepflogenheiten, auch wenn sie auf den ersten Blick wie in Stein gemeißelt erscheinen, dennoch verändern und durch diese Herausforderungen zu einer neuen Bewusstheit führen. Und sicherlich braucht es dazu nicht immer viele Monate dauernde Reflexions- und Veränderungsprozesse, wie sie sonst nur in guten psychoanalytischen Therapien erreichbar sind.
Diese Krise darf auch nicht übersehen lassen, dass wir bereits seit Jahren vor dem in vielerlei Hinsicht gefährdeten Zustand unserer Welt gewarnt wurden. Denn vor allem der Klimawandel, der übermäßige Ressourcenverbrauch sowie das Artensterben bedrohen auf massive und kaum vorstellbare Weise unsere Zivilisation. Immer wieder haben sich auch Psychoanalytiker zu diesem Thema als Spezialisten für die triebhafte Dynamik von Gier, das Nicht-verzichten-Wollen auf ein maximal lustvolles Leben, übermäßigen Geltungsdrang, die Gleichgültigkeit gegenüber der Aufrechterhaltung unserer Lebensgrundlagen und den vom Klimawandel besonders bedrohten Völkern sowie die selbstvergessene Destruktivität mit einer »Nach mir die Sintflut-Haltung« Gedanken gemacht und sich in der Öffentlichkeit dazu geäußert. Autoren wie Harold Searles (1972, über »Unbewusste Prozesse im Umgang mit der Umweltkrise«) und hierzulande auch Horst-Eberhard Richter galten in jenen Jahren noch als einsame Rufer. Spätestens seit den Veröffentlichungen von Paul Parin beispielsweise über die Zürcher Unruhen (1980) wurden dann aber immer stärker auch ökologische Fragen Thema von psychoanalytisch sozialpsychologisch engagierten Autoren. Unvergessen bleibt etwa Parins Verständnis für die Jugendlichen, deren Graffiti-Sprüche an Zürcher Bürgerhäusern und auf Transparenten mit dem Satz endeten: »Wir haben Grund genug zum Weinen, auch ohne euer Tränengas«. Und: »Wir wollen nicht länger zusehen, wie ihr uns die Welt kaputt gemacht habt!« (Parin 1980, S. 1063). Vier Jahrzehnte später hielt die engagierte Greta Thunberg in ihrer Rede beim UN-Klimagipfel mit Emphase der Elterngeneration entgegen: »How dare you!«.
Bei der gegenwärtigen Auseinandersetzung, warum so viele Menschen immer noch über den bedrohlichen Klimawandel hinwegsehen, treten ganz offenkundige Widersprüche auf. Denn obwohl die meisten von uns wissen, dass wir unser Verhalten, unsere Art zu wirtschaften und zu konsumieren verändern müssen, wollen wir dennoch weiterhin so leben wie bisher. Habibi-Kohlen (2020, S. 19) spricht von einer »Depressionsabwehr«, die mit »triumphalen Gefühlen der Machbarkeit« und immer stärkeren manischen Expansionswünschen einhergeht und die gefühlte Bedeutungslosigkeit des Klimawandels entsprechend verstärkt.
Freud (1912e) erwähnte gegenüber Ärzten, die glaubten, mit schnellen Interpretationen der unbewussten Motive Veränderungen bei ihren Patienten herbeiführen zu können, dass dies vergleichbar mit dem Austeilen von Menükarten zu Zeiten einer Hungersnot sei. Änderungen könnten nur erreicht werden, wenn die Deutungen den Patienten gefühlsmäßig wirklich berühren und wenn es gelänge, die allgegenwärtige Abwehr zu berücksichtigen. Diese ist aber zunächst und manchmal für längere Zeit nicht bewusstseinszugänglich. Vernünftige Argumente sprechen uns zwar kognitiv an, erreichen aber nicht unsere emotionalen Tiefenschichten, in denen allein nachhaltige Veränderungen stattfinden können.
Wie kann es gelingen, unsere Abwehr gegenüber einem Reduzieren unseres lebensfeindlichen und klimaschädlichen Lebensstils zu verringern? Mit immer erneuten Appellen an die Vernunft? Mit dem unermüdlichen Aufzeigen, wie destruktiv viele Verhaltensweisen sind? Bereits in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 hatten wir Deutsche einen Ressourcenverbrauch erreicht, der für ein ganzes Jahr angemessen gewesen wäre. Bei US-Amerikanern und Australiern hatte sich diese Zahl sogar noch früher eingestellt. Es müssten also drastische Veränderungen im Lebensstil der privilegierten Weltbevölkerung erfolgen. Aber Argumente wie etwa, dass es im Belieben des Einzelnen stehe, vernünftig zu konsumieren, dass Vertrauen statt Überwachung das einzig sinnvolle Gebot sei, dass es der Markt schon regeln werde oder dass Veränderungen ausschließlich über technische Innovationen zu haben seien, aber keinesfalls mit ökodiktatorischen Maßnahmen, laufen ins Leere, stärken erneut nur die Abwehr und halten eine neoliberale Ideologie am Laufen.
Sollte es stattdessen immer wieder Zukunftsvisionen von einer besseren, gerechteren und glücklicheren Welt geben, in der die leise Stimme der Vernunft sich doch noch mit klugen sozial-ökologischen Transformationen behaupten kann? Denn Menschen wollen und müssen erfahren können, dass sie den unabwendbar erscheinenden Gefahren und Katastrophen sehr wohl etwas entgegensetzen können. Mit begrünten Fassaden und Grünanlagen sowie Beeten auf Hausdächern könnte es beispielsweise anfangen, mit Aufforstungen ganzer bisher dem Verkehr geopferter Straßenzüge in unseren Städten sich fortsetzen. Damit könnte für die grenzenlos gewordene Mobilität möglicherweise ein sinnvolles Korrektiv entstehen.
Die Psychoanalytikerin Donna Orange (2017) hat von einem »Klima-Notfall« gesprochen, der auch und vor allem von Psychoanalytikern dringende Hilfsmaßnahmen erforderlich mache. Eine radikale Ethik sei angezeigt, die Verantwortung für die unter der Klimakatastrophe am meisten Leidenden übernehmen müsse. Obwohl sich Psychoanalytiker tagtäglich mit dem Leid anderer Menschen befassen, scheuen sie – wie die meisten Menschen – aber noch davor zurück, sich mit den schwierigen und erschreckenden Herausforderungen des immer schneller eintretenden Klimawandels auseinanderzusetzen.
Die Psychoanalyse als Methode und Erkenntniserfahrung, die sich konsequent damit auseinandersetzt, dass wir mit vielen unbedachten Handlungen mehr Bedeutungen unseres Handelns und damit auch mehr Probleme erzeugen als wir zu verstehen und zu handhaben wissen, könnte uns dabei helfen, die trotz aller Hoffnungen und positiver Zukunftsvisionen dennoch verbleibende tragische Dimension unseres In-der-Welt-Seins besser zu begreifen. Dann müssten wir die Widersprüche humaner, sozialer und ökologischer Art nicht länger wegschieben und verleugnen, sondern könnten uns damit noch gezielter und gedankenreicher als bislang auseinandersetzen.
Seit dem 24. Februar 2022 wird die Welt jedoch noch von einem anderen Ereignis in Atem gehalten, angesichts dessen der »Klimanotfall« und die Corona-Pandemie in den Hintergrund gerückt sind: dem grauenvollen Krieg in der Ukraine. Dieser hat Szenarien an atomarer Bedrohung wieder real werden lassen, die lange Zeit vor allem für die jüngere Generation unvorstellbar gewesen sind. Der größte Landkrieg in Europa und die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg haben unsere Welt für immer verändert.
Der russische Angriffskrieg hinterlässt neben dem unbeschreiblichen Unglück der betroffenen und traumatisierten Menschen den unabweisbaren Eindruck, dass vieles, vielleicht sogar das Allermeiste, was uns bislang in der westlichen Welt als selbstverständlich erschien, verändert werden muss. Die naive Einstellung, dass der bisherige Lebensstil einfach fortgesetzt werden könne, sobald die letzte Krise überwunden sei, wird es angesichts der »Krisen-Permanenz« nicht mehr geben können. Die Politik wird ihren Bürgern deshalb einen Trauerprozess abverlangen müssen, wie er auch in jeder guten Therapie eine maßgebliche Rolle spielt: Die Welt realistisch so wahrzunehmen wie sie derzeit und vermutlich noch für längere Zeit ist bzw. sein wird. Sich mit den massiven Vertragsbrüchen, Gefährdungen, Abgründen und Zerstörungsprozessen zu konfrontieren und sich von einer bedenkenlosen Klimazerstörung, Verschwendung, der Illusion einer unbegrenzten Selbstverwirklichung sowie der Selbstverständlichkeit von immerwährendem Wohlstand in einer von Krisen geplagten Welt verabschieden zu müssen. Und sich auf diejenigen Werte zu konzentrieren, die das menschliche Miteinander und das Gemeinwohl sowie den rücksichtsvollen Umgang mit der Natur fördern und pflegen.
1.2 Psychoanalyse zurück an die Universität? Chancen und Probleme angesichts der Direktausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten
In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Psychoanalyse mit ihrem Aufklärungsanliegen in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen. Als Therapieverfahren galt sie als wissenschaftlich ohnehin nicht oder kaum beweisbar, auch wenn sie sich immer stärker empirisch positivistischen Ansprüchen, die von außen an sie herangetragen wurden, anpasste und versorgungspolitisch schien sie allenfalls nur noch für eine Gruppe von reflexiv begabten Menschen indiziert zu sein.
Auch wenn sich in den letzten Jahren deutliche und erstaunliche Anzeichen einer Veränderung in der Einschätzung der Psychoanalyse und analytischen Psychotherapie als Therapieverfahren ergeben haben, so bleibt doch das Unbehagen an ihr weiterhin deutlich ausgeprägt. Denn wer sich mit den unbewussten Vorgängen anderer Menschen beschäftigt und nicht nur psychisches Leid verringern möchte, sondern dabei durchaus auch Illusionen zerstört, kann nicht erwarten, vorbehaltlos akzeptiert zu werden. Aber gerade die gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Vorgänge fordern zum Nachdenken darüber auf, wie eminent wichtig es ist, sich mit Machtansprüchen, Größen- und Unsterblichkeitsphantasien, Realitätsverleugnungen im Einzelnen, aber auch in Gruppen auseinanderzusetzen.
Dennoch wurde die Psychoanalyse aufgrund der berufspolitischen Weichenstellungen, die eindeutig eine dem Zeitgeist entsprechende, empirisch positivistische Psychologie mit verhaltenstherapeutischer Affinität bei Lehrstuhlberufungen, Projektförderungen und ein Wiedererstarken einer einseitig naturwissenschaftlich orientierten Medizin mit einer Geringschätzung ganzheitlicher leibseelischer Zusammenhänge bevorzugten, in ein Abseits gedrängt, was natürlich auch auf junge Nachwuchswissenschaftler demotivierend wirkte.
Mittlerweile haben sich aber wichtige Veränderungen ergeben. So geriet z. B. die allgegenwärtige Forderung nach Evidenzbasierung von Psychotherapieverfahren als alleiniges Maß für deren Güte immer stärker in die Kritik (z. B. Orlinsky, 2008; Gerlach, 2012; Shedler, 2011, 2018; Penkler, 2019). Des Weiteren wurde der Ruf nach einer beziehungsorientierten statt einer technokratischen Medizin zunehmend lauter (z. B. Teufel und Berberat, 2019).
Und dank der Initiative und eines großen finanziellen Engagements wurde im Jahr 2009 in Berlin von der Psychoanalytikerin und Unternehmerin Christa Rohde-Dachser eine private Hochschule für Psychoanalyse, die International Psychoanalytic University (IPU) gegründet. Ein Masterstudiengang ermöglicht den Studierenden ein gründliches psychoanalytisches Studium. Einige Jahre später zählte die IPU bereits 600 Studierende und erhielt 2019 im CHE-Ranking einen Spitzenplatz im Fachbereich Psychologie.
Und schließlich wurde mit der Reform des Psychotherapeutengesetzes verfügt, dass in einem neu einzurichtenden Studiengang alle bisherigen wissenschaftlich anerkannten Verfahren (kognitiv-behavioral, psychoanalytisch/psychodynamisch, systemisch) angemessen und von qualifizierten Lehrpersonen gelehrt werden müssen.
Angesichts dieser erfreulichen Reform und der Möglichkeit, endlich wieder psychoanalytisches Gedankengut an psychologischen Fakultäten – wenn auch in einem beschränkten Umfang – lehren und lernen zu können, bleibt aber dennoch ein gewisses Unbehagen angesichts dieses »Zurück an die Universität«. Warum?
Wird der seit vielen Jahren von Otto Kernberg, einem der wichtigsten Doyens der Psychoanalyse, erhobene Ruf, Psychoanalyse müsse unbedingt zurück an die Universität – in einer Mesalliance enden oder tatsächlich zu einem dringend notwendigen und unverzichtbaren Unternehmen führen? Angesichts des Direktstudiums Psychotherapie ergibt sich dazu jetzt eine einmalige Chance, auch wenn der Anteil psychoanalytischer Theorie und Praxis am gesamten Curriculum sich immer noch – etwa im Vergleich mit dem Angebot an der IPU – bescheiden ausnimmt.
1.2.1 Die Situation nach Freud in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Von der ursprünglichen skeptischen Grundhaltung Freuds gegenüber einer an den Universitäten vertretenen psychoanalytischen Lehre und Forschung war sowohl in den USA als auch in Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren nur noch wenig zu spüren. Im Gegenteil: Die meisten der psychosomatischen und klinisch psychologischen Lehrstühle, aber auch die psychotherapeutischen und psychosomatischen Klinikstellen wurden ab dieser Zeit in Deutschland mit Psychoanalytikern besetzt. Allerdings herrschte in diesen Jahren wissenschaftspolitisch eine plurale Offenheit, zumal sowohl die Psychosomatik als auch die Klinische Psychologie noch in den Kinderschuhen steckten. Erst das Wiedererstarken der naturwissenschaftlichen Medizin und die zunehmende Feindschaft psychologischer Standesvertreter, die ein eigenes Therapieverfahren gemäß den Konzepten behavioristischer Lerntheorien entwickelten, sowie eine zunehmend veränderte Wissenschaftspolitik, wie ein biomedizinisch geprägtes Evidenzverständnis, führten bei der Wiederbesetzung der Stellen in den folgenden Jahren zu einer Chancenlosigkeit von psychoanalytisch orientierten Bewerbern.
Die Psychoanalyse erfuhr vor allem in den USA einen jähen Absturz. Wurden zur Zeit der Hochblüte der ichpsychologischen Psychoanalyse z. B. Klinikleiter-Stellen nur vergeben, wenn der Betreffende eine psychoanalytische Ausbildung absolviert hatte – zu diesem Zweck wurden Lehranalysen sogar finanziell gefördert –, so zogen bereits in den 1970er Jahren dunkle Wolken am Horizont auf. Verschiedene Umstände haben dazu beigetragen: zunächst die rasante Entwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie und anderer Therapieverfahren, die den durchschnittlichen US-Amerikaner mehr ansprachen als die nach innen gerichtete Psychoanalyse, dann der immer stärker werdende pharmako-industrielle Komplex – fast jede dritte US-Amerikanerin führte ab den späten 1980er Jahren ständig Prozac bei sich, – die Verkündigung einer »Dekade des Gehirns« sowie das Versprechen, alsbald das menschliche Genom entschlüsseln und damit die allermeisten Krankheiten heilen zu können. Aber auch gehässige und einflussreiche Freud-»Basher« haben zum schwindenden Ansehen der Psychoanalyse beigetragen.
Wie Untersuchungen amerikanischer Lehrbücher zur Einführung in die Klinische Psychologie ergeben haben, wird dort die Psychoanalyse in einem besorgniserregenden Ausmaß nur noch am Rande erwähnt; wenn überhaupt sind dies meistens karikaturhafte Schilderungen Freud'scher Konzepte, die auf junge Menschen eher verwirrend bis abstoßend wirken. Neuere Richtungen und die vielen existierenden Forschungsergebnisse werden nicht aufgeführt, die psychoanalytische Herkunft so mancher kognitionspsychologischer Konstrukte findet keine Erwähnung (Auchincloss und Kravis, 2000; Bornstein, 2005; Yalof, 2015). Dieser Befund schmerzt natürlich umso mehr, weil es nicht nur eine Fülle an empirischen Untersuchungen psychoanalytischer Konstrukte bis zum heutigen Tag gibt, sondern auch weil in den letzten Jahren die Wirksamkeit von analytischen Kurz- und Langzeittherapien überzeugend nachgewiesen, ja sogar eine größere Nachhaltigkeit psychoanalytischer Therapien aufgezeigt werden konnte. Studierende lernen somit in den USA die Psychoanalyse an psychologischen Fakultäten geschweige denn in der Medizin so gut wie nicht mehr kennen. Bei uns verhält es sich mittlerweile sehr ähnlich (s. Lackinger und Rössler-Schülein, 2017).
Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass seit mehreren Jahren von vielen, vor allem forschungsorientierten Psychoanalytikern die Forderung erhoben wird, die Psychoanalyse müsse unbedingt zurück an die Universitäten und Hochschulen, wie etwa hierzulande seit einigen Jahren von Berufsverbänden und von der Arbeitsgemeinschaft psychodynamischer Professorinnen und Professoren mit Cord Benecke und Jürger Körner als treibenden Kräften. »Zurück an die Universität« bezieht sich auf Psychologie und Medizin, denn in den kultur- und literaturwissenschaftlichen Disziplinen werden psychoanalytische Denkansätze durchaus als bereichernd wahrgenommen. Leider haben die Absolventen dieser Studiengänge keine Möglichkeit, Psychoanalyse an Weiterbildungsinstituten zu erlernen und zu praktizieren.
Die unbedingt erforderlichen intensiven Forschungsanstrengungen können jedoch nur in einem beschränkten Umfang von den Ausbildungsinstituten und Standesorganisationen getragen werden, da sie über einen viel zu geringen Forschungsetat verfügen. Auch aus diesem Grund ist der Anschluss an die Universität äußerst dringlich.
Kurzum: Ohne Forschung – so befürchten mittlerweile viele –, die in dem erforderlichen Ausmaß nur von Hochschullehrern geleistet werden kann, die über die Möglichkeit verfügen, Erhebung und Auswertung von Daten von Diplomanden, Doktoranden und Assistenten vornehmen lassen zu können, werde die Psychoanalyse den Anschluss an die modernen Wissenschaften verlieren und nur noch als interessante Theorie und Therapieform des 20. Jahrhunderts in Geschichtsbüchern Erwähnung finden. Ist dieser Zustand aber vielleicht schon eingetreten?
Dem lässt sich Folgendes entgegenhalten: Die Hoffnung, die Psychoanalyse könne endlich an öffentlicher Reputation gewinnen, wenn sie aufgrund vermehrter empirischer Forschung von der derzeitigen Universitätspsychiatrie und -psychologie wieder oder erstmalig akzeptiert würde, stellt möglicherweise eine Illusion dar. Denn diese Disziplinen sind im Zuge des politischen Neoliberalismus tendenziell zu unkritischen und technokratischen Organisationen verkommen. Schon vor einigen Jahren beschrieb der Deutsche Hochschulverband die Universität als »autistische Leistungsmaschine«, die Professoren in den Burnout treibe und der Wissenschaftsrat plädierte für eine Entschleunigung des akademischen Betriebs. Statt auf Quantität sollte endlich auf Qualität geachtet werden. Bei Bewerbungen um eine Professur sollte z. B. nicht länger eine viele Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte an Veröffentlichungen umfassende Literaturliste über alle möglichen Forschungsprojekte des Bewerbers oder der Bewerberin eingereicht werden – was Kritiker mittlerweile als »universitäre Publikationsindustrie« bezeichnen –, sondern maximal drei bis fünf Arbeiten, von denen er oder sie annehme, dass sie die eigene besondere Forschungsleistung dokumentieren.
Seit vielen Jahren ist ebenfalls bekannt, dass die deutsche Universität in einer tiefen Strukturkrise steckt (z. B. Mittelstrass, 1998). Der überwiegende Teil des Lehrkörpers hat im Zuge einer nach betriebswirtschaftlichem Denken umgestalteten »universitären Lernfabrik« nur befristete Verträge. Drittmittelstellen müssen aufgrund der chronischen Unterfinanzierung ständig und unter Zeitdruck rekrutiert und von Drittmittelgebern eingeworben werden und ihre Anzahl gilt dann als Ausweis von Exzellenz des betreffenden Lehrstuhls. Aufgrund der Überlastung, verschulter Ausbildungssysteme und des Durchschleusens von Massen an Studierenden anhand des möglichst raschen Sammelns von Credit Points ist von dem alten humboldtschen Ideal einer Einheit von Wissenschaft und Persönlichkeitsbildung so gut wie nichts mehr übriggeblieben. Mindestens ein Viertel der Studierenden ist eher ungeeignet und wäre in einem handwerklichen Beruf vermutlich besser aufgehoben. Und sicherlich lässt auch die Qualität mancher Lehrpersonen oft zu wünschen übrig.
Denn die Lehre wird zunehmend zu etwas Drittrangigem, zumal von Berufungskommissionen nur der Forschungs-Output mittels Veröffentlichungen in Fachzeitschriften bewertet wird. Die Qualität der Lehre, für die keinerlei pädagogische und didaktische Ausbildung verlangt wird, wird oftmals nur noch anhand einer einzigen Probevorlesung eingeschätzt. Heutige Vorlesungen bestehen zu großen Teilen aus PowerPoint-Folien mit Zahlenkolonnen, welche die Empiriehaltigkeit belegen sollen, sowie einigen eingestreuten Bildchen. Für selbstständiges Lernen, interaktive Vermittlung, permanente Rückmeldung, fragenden Austausch sowie emotionale Aneignung und Durchdringung gibt es wegen der Stofffülle und des mangelnden Verständnisses für didaktische Prozesse so gut wie keine Gelegenheit.
Entsprechend groß ist nicht nur die Angst dieser Disziplinen vor einem Einzug kritisch psychoanalytischen Denkens in die Hörsäle und Seminarräume, das – vereinzelt – immer noch einen aufklärerischen und gesellschaftskritischen Anspruch hat, eine reflexive Durchdringung eines Themas ermöglicht, Wert darauf legt, dass die Studierenden ihre unterschiedlichen Meinungen, Vorurteile und Ängste sprachlich auszudrücken lernen und nicht nur umfangreichen, aber letztlich toten Wissensstoff aufnehmen müssen, um ihn bei den Prüfungen wieder eins-zu-eins abrufen zu können.
Wäre die Psychoanalyse also wirklich gut damit beraten, im jetzigen universitären System nach der Anerkennung dieser Disziplinen – gemeint sind hierbei Psychologie und Medizin – zu streben? Würde es wirklich Sinn machen, die Psychoanalyse in die jetzige Psychologie vollständig zu integrieren, die sich ausschließlich als empirische Verhaltenswissenschaft begreift, bei der die statistische Kompetenz – ablesbar am Umfang der Lehrveranstaltungen und natürlich auch an der ideellen Gewichtung – an allererster Stelle steht? Während sich bei den interpretativen, hermeneutischen Verfahren hingegen eine absolute Leerstelle auftut? Was aber nicht gelehrt und gelernt wurde, hinterlässt bei vielen Universitätsabsolventen eine bedauernswerte Lücke. Ist es also wirklich erstrebenswert, sich einer empiristischen Engführung anzupassen, nur um auf diese Weise der Psychoanalyse zu mehr Reputation zu verhelfen?
Wie der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Solms (2017, S. 53) es prägnant ausgedrückt hat: »Akademische Psychiatrie und Psychologie haben keine Seele!« Dies deshalb, weil sie glauben, dass Subjektivität etwas zutiefst Unwissenschaftliches sei. »Die Seele ist im Begehren verwurzelt, im Affekt, im Körper« (S. 62). Psychologie und Psychiatrie aber seien Abwehrstrukturen gegen die Psyche, gegen die Psychoanalyse (vgl. S. 50). Ohne wirklichen psychologischen Sachverstand kann man aus einer Dritte-Person-Perspektive Forschung betreiben; statistische Methoden und Prüfkriterien ersetzen eine genuin psychologische Annäherung an den Forschungsgegenstand; der entsubjektivierende Zugang belässt den Forscher in sicherer Distanz; maschinell durchführbare und computerisierbare Methoden erzeugen in relativ kurzer Zeit große Datenmengen, die sich trefflich zur Produktion von Forschungs-Output eignen; statistisch aufbereitete Tabellen und Messreihen mit minimaler theoretischer Durchdringung erwecken den Eindruck großer naturwissenschaftlicher Entdeckungen.
1.2.2 Die Einrichtung des Direktstudiums Psychotherapie und was es dabei zu beachten gilt
Nun erhalten aber – wie bereits ausgeführt – die Forderung »Zurück an die Universität« und die damit verbundenen Fragen eine neue Wendung, seitdem es ab dem Wintersemester 2020/21 die Möglichkeit gibt, Studierende in einem begrenzten Umfang mit psychoanalytischem Denken und Fühlen vertraut zu machen.
Dabei sollte nun aber die Chance genutzt werden, in genuin psychoanalytisches Denken einzuführen. Und es sollte dabei dem Bedenken und der Befürchtung widerstanden werden, dass man damit von den bereits im Grundstudium in psychologischer Methodik geschulten Studierenden nicht so recht ernstgenommen wird.
Vielmehr könnte und sollte der Aufbau der neuen Psychotherapie-Direktausbildung an den Universitäten eine Chance darstellen, methodisch komplementär vorzugehen, quantitativ und qualitativ, Beobachtungen aus einer Dritten-Person-Perspektive und introspektive Aufschlüsse aus einer Erste-Person- sowie aus einer Zweite-Person-Perspektive, wie sie im psychoanalytischen Setting gang und gäbe sind. Denn Psychoanalyse ist die Wissenschaft von der Subjektivität, der inneren Welt der beiden am analytischen Diskurs Beteiligten, somit nicht nur des Patienten. Es geht um ein Erfahrungswissen, das zwei Menschen miteinander generieren. Es kann deshalb nicht die innere Welt des Analysanden ohne die innere Welt der Analytikerin, des Analytikers geben. Das ist eine Vorstellung, die der herkömmlichen, positivistisch geprägten Psychologie und Medizin völlig unverständlich bleibt. Gemessen werden in diesen Disziplinen behaviorale Merkmalsausprägungen einer Versuchsperson oder somatische Marker eines Patienten auf möglichst objektive Weise, unbeeinflusst von allen persönlichen Gleichnissen, Messfehlern und ähnlich unkontrollierbaren Einflüssen.
Sich selbst als Einfluss nehmendes und damit »Daten« generierendes Forschungssubjekt aufzufassen, lässt sich mit einer empirisch positivistischen Auffassung in der Psychologie nur schwer bzw. überhaupt nicht vereinbaren; denn der psychologische Forscher möchte und muss seine Befunde generalisieren, während die psychoanalytische Erkenntnis immer an die Erfahrung einer spezifisch psychoanalytischen Beziehung gebunden bleibt.
Der Psychoanalytiker Thomas Ogden hat dies folgendermaßen ausgedrückt: »Das analytische Gespräch, das mit jedem einzelnen Patienten entsteht, ist einzigartig für diesen Patienten und könnte nicht zwischen zwei anderen Personen stattfinden [...] Die Art und Weise, wie ich mit Patienten spreche, ist nicht der Modus, in dem ein anderer Analytiker mit Patienten spricht; wäre dem so, würde der Patient mit dem falschen Analytiker sprechen« (Ogden, 2015, S. 304, Übersetzung WM) oder – so ließe sich hinzufügen –, dann könnte er auch mit einem Computer Konversation betreiben.
Genug der kritischen Pro und Contra-Argumente – was bleibt unter dem Strich übrig?
»Zurück an die Universität« kann meines Erachtens nicht bedeuten, sich der derzeitigen Mainstream-Psychologie oder -Medizin bzw. -Psychiatrie lediglich anzudienen. Wenn überhaupt, müsste sich erst vieles verändern, zum Beispiel korrigiert werden, wie psychoanalytische und psychodynamische Konzepte systematisch unterschlagen, trivialisiert oder insgeheim abgekupfert werden, wobei sie aber ihren Gehalt dadurch verlieren, dass sie als beobachtbare Verhaltensmerkmale ausgewiesen werden und damit dem Zwang zur einheitswissenschaftlichen Objektivierung unterliegen.
»Zurück an die Universität« muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass man sich der vorherrschenden Methodologie, dem einheitswissenschaftlichen Credo unterwerfen muss. Sondern es ließe sich mit entsprechendem Mut und Können eine der Psychoanalyse angemessene Wissenschaft betreiben.
Leider finden aber so gut wie keine Diskussionen mehr darüber statt, wie etwa zu Zeiten des Positivismus-Streits in der deutschen Soziologie, als intensiv darum gerungen wurde, was »empirisch« überhaupt bedeutet, wie abhängig Grenzziehungen zwischen dem, was als wissenschaftlich definiert wird und was nicht, von gesellschaftlichen und politischen Strömungen sind und damit auch wie diskussionsbedürftig all diese Festlegungen sind. Jüngere Kolleginnen und Kollegen, die als Psychotherapieforscher engagiert um den Legitimationsnachweis für die Psychoanalyse für deren Erhalt bei den Krankenkassen kämpfen, haben kaum Chancen, sich mit wissenschaftstheoretischen und methodologischen Argumentationen zu behaupten. Deswegen gehen sehr viele Bemühungen um den Nachweis einer mindestens ebenso großen oder gar größeren Wirksamkeit der analytischen und psychodynamischen Therapieverfahren derzeit wie das Rennen zwischen Hase und Igel aus. Immer wenn der Hase glaubt, vor dem Igel am Ziel angekommen zu sein, ist der Igel schon da. Die Frau des Igels ist im vorliegenden Fall der Nachweis von Fehlern der psychoanalytischen Forscher, z. B. die Randomisierung betreffend oder ungenügende Einschlusskriterien bei Meta-Analysen, zu geringe Beachtung und Sicherung der Adhärenz oder fragwürdige Kriterien der Nachhaltigkeit usw. Das sind die Joker, welche die derzeitige Universitätspsychologie jederzeit aus dem Ärmel zaubern kann, wenn man es wagt, sich auf das Gebiet ihrer einseitig positivistisch geprägten Wissenskultur zu begeben.
Allerdings gab es in den zurückliegenden Jahren durchaus Veröffentlichungen, die sich mit wissenschaftstheoretischen und methodologischen Problemen der Psychoanalyse befassten, wie z. B. von dem Philosophen Michael Hampe (2001, 2003) über die »Pluralität der Wissenschaften«, von Johann August Schülein (z. B. 1999, 2015) »Die Logik der Psychoanalyse« und über die Unterschiede denotativer und konnotativer Theorien, von Bernd Nissen (2010, 2012) über den dynamischen Strukturkern der Psychoanalyse, der einen eigenen Wissenschaftstyp rechtfertigt, von Erwin Kaiser (2018) über die »Unzulänglichkeit der nomologischen Psychologie«, von Christian Sell und Rolf-Peter Warsitz (2018) über die Dialektik der Psychotherapieforschung und unterschiedliche Wissenskulturen und schließlich noch die umfassende Arbeit von Rolf-Peter Warsitz und Joachim Küchenhoff (2015) »Psychoanalyse als Erkenntnistheorie – psychoanalytische Erkenntnisverfahren«.
1.2.3 Skizze eines psychoanalytischen Forschungsprojekts im universitären Kontext
Vorbemerkung: Die derzeitige neuerliche Welle einer ausschließlich naturwissenschaftlichen Empirisierung in der Psychotherapieforschung, unter der so viele andere wichtige Themen und Fragestellungen, vor allem aber das komplementäre Denken verloren zu gehen drohen, sollte sich die moderne Physik zum Vorbild nehmen: Diese hat längst die Grenzen ihres nach Objektivität strebenden Erkenntnisdranges erkannt und ist in dieser Hinsicht wissenschaftsphilosophisch mittlerweile um einiges reflektierter als das Gros der Universitätspsychologen und evidenzbasierter medizinischer Forscher. Wir sollten also das genuine Erkenntnisverfahren der Psychoanalyse auf keinen Fall für ein Linsengericht, in diesem Fall für simple Befund- und Fragebögen, verhökern.
Das Schreckgespenst der Kritik von Adolf Grünbaum, das noch in den 1980er Jahren für Aufregung bei forschungsorientierten Psychoanalytikern sorgte, ist längst einer gelasseneren Einstellung gewichen. Forschung – um kein Missverständnis aufkommen zu lassen – ist selbstverständlich sehr wichtig, aber sie sollte keiner ausschließlich empirisch positivistischen Engführung unterliegen.
Qualitative Forschung, die in ihrem Vorgehen gewiss auch transparent und intersubjektiv zugänglich sein sollte, Einzelfallforschung, komparative Kasuistiken brauchen den Vergleich mit den historischen Wissenschaften oder den Rechtswissenschaften nicht zu scheuen. Und keiner käme übrigens auf die Idee, diesen den Charakter von Wissenschaft abzusprechen, nur weil sie keine kontrollierten Experimente anstellen (vgl. Guggenheim et al., 2016).
Dennoch könnte und sollte die Einstellung, dass auch sehr evident erscheinende Gewissheiten, die überwiegend intuitiv, introspektiv, abduktiv, tiefenhermeneutisch gewonnen werden, immer wieder in Frage gestellt gehören, zur erforderlichen Weiterentwicklung der Psychoanalyse in Theorie und Praxis beitragen. Psychoanalyse besteht zudem nicht nur aus einem intersubjektiven und neuerdings feldtheoretischen Prozess des Zuhörens und mutuellen Affektabstimmens, sondern auch aus Konzepten und Theorien über psychische Symptome, Leidenszustände und Krankheiten, über Entwicklungsvorgänge, behandlungstechnische Prozesse, soziokulturelle Phänomenen wie Beschleunigung, chronischer Zeitmangel, Karriereangst, Überfremdung und anderes mehr, die sich mit psychischen Grundängsten verbinden, die sorgfältig studiert werden müssen. Und wenn man bei diesen Untersuchungen der psychoanalytischen Wissenskultur verbunden bleiben möchte, dann sollte man entsprechende methodologische Überlegungen darüber anstellen, inwieweit bei interdisziplinären Forschungsprojekten ein Wechsel der verschiedenen Seinsebenen mit entsprechend anderen Methoden stattfindet und wie das der spezifisch psychoanalytischen Betrachtungsweise gerecht werden kann.
Denn trotz aller beeindruckenden Forschungsbefunde aus den Bereichen der Bindungstheorie, der Entwicklungspsychologie, der Affekt- und Kognitionsforschung sowie der neurowissenschaftlichen Forschung sollte die wichtigste Frage dabei lauten: Inwieweit entstehen dadurch neue Erkenntnisstrategien für den Umgang mit intrapsychischen und interpersonellen vor- und unbewussten Phänomenen in der psychoanalytischen Praxis? Auf diese Weise erfolgt die Rückbesinnung auf die analytische Ausgangssituation mit ihrer ureigenen Methodik. Denn ansonsten könnten sich Psychoanalytiker auch als Bindungsforscher oder als Entwicklungspsychologen betrachten und hätten es damit in der derzeitigen akademischen Welt um einiges leichter.
Wie könnte nun psychoanalytische Forschung aussehen, bei der sowohl die empirisch hermeneutische Forschung als auch die empirisch messende Forschung berücksichtigt werden? In meiner Fragestellung klingt bereits an, dass es selbstverständlich nicht nur eine Form der Empirie gibt, die dann gegenüber der herkömmlich als »nur interpretierend«, »geisteswissenschaftlich« oder »weich« bezeichneten Erfahrung als höherwertig eingeschätzt wird, sondern zwei Formen der empirischen Forschung, die zwar nicht als methodisch gleichwertig betrachtet werden können, sich aber dennoch gegenseitig befruchten und ergänzen, möglicherweise triangulieren können. Wichtig dabei ist, dass jede dieser methodologischen Einstellungen und methodischen Vorgehensweisen bestimmte Vorzüge, aber auch Grenzen der Erkenntnis aufweist, die nicht nur der Hyperkomplexität des Menschen, des menschlichen Geistes geschuldet sind, sondern mit unserem Erkenntnisvermögen überhaupt zu tun haben.
Ausgangspunkt der empirisch hermeneutischen Forschung ist die psychoanalytische Situation. Der behandelnde Psychoanalytiker befasst sich außerhalb der Therapiestunde mit dem Verlauf des analytischen Prozesses. Ulrich Moser (1991) hat dies als »Online-Forschung« bezeichnet. Mit oder ohne eine audiografierte Aufnahme des Stundenablaufs protokolliert er im Nachhinein seine Anmutungen, Gefühlseindrücke, den Nachhall von Konflikten und vergangenen Traumatisierungen in ihm selbst, im weitesten Sinn seine vorbewusste Gegenübertragung, ferner und damit zusammenhängend seine Rollenempfänglichkeit, Reverien, impliziten und expliziten Konzepte und auch seine Deutungsentwürfe. Damit werden anhand dieses »Liegungsrückblicks« (Meyer, 1981) in einem ersten Schritt seine ansonsten als »stilles Denken« und in seinem introspektiven Raum verbleibenden Aktivitäten – von Meyer (1981, 1988) als »systematische akustische Lücke« in reinen Verbatimprotokollen bezeichnet – für ihn selbst festgehalten und auch für einen Außenstehenden prinzipiell »argumentationszugänglich« (Körner, 2002).
In einem zweiten Schritt dieser Online-Forschung kommt dann die Supervisions- oder Intervisionsgruppe zum Tragen, die mit ihren Anmutungen und Gefühlsregungen weitere Mutmaßungen über die latenten Bedeutungen der interpersonellen und intrapsychischen Prozesse der beiden Beteiligten beisteuert (z. B. Frühwein, 2019).
Im Anschluss daran kann der behandelnde Analytiker Hypothesen über die Entstehungszusammenhänge und Auswirkungen persistierender vorbewusster und unbewusster Phantasien, Abwehrvorgänge, sowie ungenügend symbolisierter Emotionen entwickeln. Diese Mutmaßungen bleiben zwar immer subjektive Interpretationen, die von persönlichen Vorlieben, Theoriebruchstücken, impliziten Alltagstheorien getragen sind, auch wenn sie wie in einer Intervisionsgruppe durch weitere Bedeutungszuschreibungen angereichert werden. Dennoch sind sie mittels einer privilegierten Beobachtungssituation entstanden, die methodisch einmalig ist, weil sie aus dem Zusammenspiel zweier um Erkenntnis bemühter Menschen hervorgegangen sind. Denn jeder der beiden Beteiligten nimmt die verbalen wie nichtsprachlichen Äußerungen seines Gegenübers auf, reflektiert seine eigenen wie die seines Gegenübers, versucht den Anmutungen und Gefühlen Bedeutungen zuzuschreiben und diese konsensuell zu klären. Der Analytiker ist hierbei in der Regel in einer Erkenntnisposition, in der er – zumeist, aber keineswegs immer – umfassender und reflektierter als sein Patient verschiedene Bedeutungsebenen erkennen und integrieren kann. So reflektiert er das emotional-kommunikative Geschehen, das sich szenisch zwischen den beiden abspielt, versucht, die verschiedenen, in der Regel vorbewusst und unbewusst erfolgenden Rollenzuweisungen auf sich wirken zu lassen, die darin zum Ausdruck kommenden Konflikte zu erspüren und sie möglicherweise mit Vermutungen über lebensgeschichtliche Hintergründe in Beziehung zu setzen. Darüber hinaus achtet er darauf, wie seine verbalen wie nonverbalen Äußerungen, wie z. B. sein Schweigen auf sein Gegenüber wirken könnten. In den Mitteilungen und Erzählungen versucht er auch, die unbewussten Kommunikationsinhalte zu erraten, die zwischen ihm und seinem Patienten ausgetauscht werden. Diese kommunikative und reflexive analytische Kompetenz verdankt sich dem geschulten analytischen Blick und Gehör.
Für nicht wenige praktizierende Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker würde diese durchaus intensive Art der reflexiven Beforschung des emotional-kommunikativen Geschehens (▶ Kap. 4.1.1) bereits ausreichend sein. Natürlich wissen sie, dass es hinsichtlich der Wahrnehmung der Übertragung und Gegenübertragung, der Empathie und des szenischen Verstehens keine »reine« Beobachtung und untrügliche Introspektion geben kann. Bei allen diesen Methoden spielen metapsychologische, klinisch theoretische und alltagspsychologische Konzepte als hermeneutische Deutungshorizonte eine mehr oder weniger große Rolle.
Bereits seit einigen Jahrzehnten haben Psychoanalytiker über die expliziten Konzepte der verschiedenen Richtungen nachgedacht und auf Tagungen und Symposien sowie in Fachzeitschriften Vergleiche anhand von Therapietranskripten angestellt. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die psychoanalytische Gemeinschaft nun aber weltweit mit dem Thema, wie der einzelne Analytiker tatsächlich arbeitet, egal ob er sich z. B. als Post-Ichpsychologe, Selbstpsychologe, Kleinianer oder als psychoanalytischer Pluralist bezeichnet. Zu dieser Frage haben vor allem die Befunde der empirischen Psychotherapieforschung beigetragen, dass nämlich Psychoanalytiker nicht selten »unter der Hand« anders intervenieren, als es ihrem eigenen Selbstverständnis entspricht (z. B. Ablon et al., 2006).
Aus diesem Grund wurde es immer wichtiger, die stillschweigenden Hintergrundannahmen für sich selbst und für Dritte nachvollziehbar werden zu lassen, d. h. sich darüber Gedanken zu machen, welche impliziten und natürlich auch expliziten Theoriebestandteile, Vorlieben und Gepflogenheiten das analytische/therapeutische Tun tatsächlich durchwirken. Dies lässt sich nicht allein mit Hilfe von Verbatimtranskripten entscheiden, selbst wenn diese eine gute Basis darstellen, sondern nur durch eine gründliche Reflexion des Ablaufs einer Therapiesitzung mittels lauten Denkens. Geschieht dies nicht, kommt es zu dem von Meyer (1981, 1988) als »systematische akustische Lücke« bezeichneten Phänomen. Die Exaktheit der Aufzeichnung würde dann beeinträchtigt durch einen Verzicht auf alle abgelaufenen Überlegungen und Gefühle. Wie ist es zu einer bestimmten Äußerung oder Deutung gekommen? Was wurde dabei bewusst, vorbewusst gefühlt und gedacht? Wird ein mögliches Enactment nachvollziehbar? Welche Entscheidungen sind eingeflossen, als sich der Analytiker z. B. zu einer Frage, einer Selbstmitteilung, einer Zurückhaltung, des Ansprechens eines Widerstands oder einer Übertragungsdeutung im Hier und Jetzt entschloss? Tauchte in diesem Moment z. B. die Erinnerung an die eigene Lehranalyse auf? An etwas in den letzten Tagen Gelesenes? Oder erfolgte die Intervention aus einem wieder virulent gewordenen eigenen Konflikt?
Geschieht diese Reflexion nicht, ist die Gefahr eines zu wenig reflektierten impliziten Theoriengebrauchs gegeben, was Bion (2009[1970]) als »parasitäres Containment« beschrieben hat: Die Lieblingskonzepte und -überzeugungen suchen sich dann einen Patienten als Container (vgl. H. König, 2014, S. 328). Bei herkömmlichen Fallberichten muss man davon ausgehen, dass die Protokolle selektiv verkürzt sind, weil die Erinnerungsfähigkeit des Analytikers vor allem wegen möglicher stichwortartiger Notizen und/oder nachträglicher Aufzeichnungen und der Konzentration auf die geäußerten Interventionen reduziert ist. Die selektiven und nachträglich in unterschiedlichem Ausmaß redigierten Fallberichte weisen neben ihrer Glättung deshalb Auslassungen auf, die – wie in einem Vergleich mit einem audiografierten Verbatimprotokoll des Öfteren nachgewiesen – erheblich sein können. Aber sie haben wiederum den Vorteil, dass die Kürze des Berichts Raum für Begleitkommentare lässt.
Aus diesen Gründen wurde der Ruf nach einer empirisch messenden Forschung immer lauter. In dieser, nach Moser (1991) der sog. Offline-Forschung, kann die analytische Situation mithilfe der mittlerweile zahlreichen Instrumente zur Therapieprozess- und -wirkungsforschung untersucht werden (z. B. Leuzinger-Bohleber und Fischman, 2006; Kächele et al., 2009; Hörz-Sagstetter und Mertens, 2015; Krause und Altimir, 2016) – unter Verzicht auf all die vorgenannten subjektiven Überlegungen. Denn diese Forschungsmethodologie legt nach wie vor großen Wert darauf, dass Forschung, soweit dies möglich ist, möglichst unabhängig vom Forscher und seiner Subjektivität vorgenommen wird.
Dass diese Objektivität allerdings nur eine vermeintliche ist, wird unmittelbar deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass unsere Messinstrumente immer schon ein Apriori unserer messenden Erfassung der Wirklichkeit darstellen und niemals die Wirklichkeit als solche, wie sich das manche Laien vorstellen, abbilden bzw. erkennen können. Diese Abbildtheorie war erkenntnistheoretisch lange Zeit ein Merkmal des naiven Realismus, der aber seit geraumer Zeit von einem kritischen Realismus oder kritischen Idealismus abgelöst worden ist (z. B. Hanly und Hanly, 2001; Stänicke et al., 2020). Die immer schon gegebene Abhängigkeit der Wirklichkeitserfassung von vorgängigen Konstruktionen wird ersichtlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es beispielsweise im Bereich der Erfassung des Arbeitsbündnisses mittlerweile 12 bis 15 verschiedene Mess