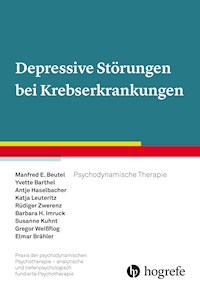23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Der Band vermittelt konzeptuelles und methodisches Grundlagenwissen zur psychoanalytischen und psychodynamischen Praxis. Zunächst werden die psychoanalytischen Behandlungstechniken auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen theoretischen Konzepte und Anwendungsbereiche dargestellt und Unterschiede der wichtigsten psychodynamischen Verfahren aufgezeigt. Ferner wird auf die störungsorientierte psychoanalytische Therapie eingegangen, und es werden Fragen nach Technik vs. Beziehung sowie nach Kurz- vs. Langzeittherapie diskutiert. Ein weiteres Kapitel erörtert die Grundlagen evidenzbasierter Psychotherapie auch unter wissenschaftstheoretischen Überlegungen. Die Wirksamkeit von psychodynamischer Therapie wird ausführlich anhand der vorliegenden Psychotherapiestudien, störungsspezifischen Behandlungsmodelle und vorliegenden Therapiemanuale dargestellt. Die vorliegende Neuauflage berücksichtigt aktuelle Studien und geht auf neuere Entwicklungen, wie transdiagnostische Verfahren und Online-Therapie, ein. Abschließend reflektieren die Autoren den Einfluss der Psychotherapieforschung auf die klinische Praxis. Dabei geht es zunächst um die Wirkfaktoren von Psychotherapie, bevor die Bedeutung manualisierter Therapieansätze für die Praxis, Psychotherapieausbildung und für die Erstellung von Behandlungsleitlinien diskutiert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Manfred E. Beutel
Stephan Doering
Falk Leichsenring
Günter Reich
Psychodynamische Psychotherapie
Störungsorientierung und Manualisierung in der therapeutischen Praxis
2., überarbeitete Auflage
Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Band 1
Psychodynamische Psychotherapie
Prof. Dr. Manfred E. Beutel, Prof. Dr. Stephan Doering, Prof. Dr. Falk Leichsenring, Prof. Dr. Günter Reich
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Manfred E. Beutel, Prof. Dr. Stephan Doering, Prof. Dr. Falk Leichsenring, Prof. Dr. Günter Reich
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Manfred E. Beutel, geb. 1955. Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytiker. Seit 2004 Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Prof. Dr. med. Stephan Doering, geb. 1966. Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalytiker. Seit 2011 Leiter der Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien.
Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Falk Leichsenring, geb. 1955. Psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker. Seit 2007 Professor für Psychotherapieforschung in der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie der Justus Liebig-Universität Giessen.
Prof. Dr. phil. Dipl.-Psych. Günter Reich, geb. 1952. Psychologischer Psychotherapeut, Psycho-analytiker, Paar- und Familientherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Bis 2017 Leiter der Ambulanz für Familientherapie und für Essstörungen, der Psychotherapeutischen Ambulanz für Studierende sowie der Psychotherapeutischen Sprechstunde für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. Seit 2017 tätig in eigener Praxis sowie in Forschung und Lehre, Fort- und Weiterbildung.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2020
© 2010, 2020 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2939-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2939-8)
ISBN 978-3-8017-2939-4
http://doi.org/10.1026/02939-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Entwicklung von Psychoanalyse und psychoanalytisch begründeten Therapieverfahren
1.1 Differenzierungen und Veränderungen der psychoanalytischen Behandlungstechnik
1.2 Parameter in der psychoanalytischen Behandlung
1.3 Der Einfluss der Ich-Psychologie
1.4 Niederfrequente analytische Psychotherapie nach Sven O. Hoffmann
1.5 Der Einfluss der Objektbeziehungstheorien
1.6 Einflüsse der Selbstpsychologie
1.7 Die Entwicklung interpersoneller Ansätze in der psychodynamischen Psychotherapie
1.8 Mentalisierungsbasierte Therapie schwerer Persönlichkeitsstörungen
1.9 Eklektische Ansätze
1.10 Psychoanalytische Kurzzeittherapie
1.10.1 Entwicklung
1.10.2 Behandlungstechnik in der Kurzzeittherapie
1.10.3 Indikationen und Kontraindikationen
1.11 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen psychoanalytischen Psychotherapien und modifizierten Verfahren
1.12 Transdiagnostische Manuale
2 Evidenzbasierung in der Psychotherapie
2.1 Anforderungen und Grenzen evidenzbasierter Psychotherapie
2.2 Zur Kontroverse um randomisierte kontrollierte vs. naturalistische Studien
2.2.1 Randomisierte kontrollierte Studien
2.2.2 Naturalistische Studien
2.2.3 Wissenschaftstheoretische Betrachtung
2.2.4 Grundlagenforschung, Psychotherapieforschung und psychotherapeutische Praxis
2.2.5 Evidenzstufen von naturalistischen Studien
2.3 Diskussion
3 Psychoanalyse und psychodynamische Therapien aus Sicht der Psychotherapieforschung
3.1 Forschung zur Psychoanalyse
3.1.1 Frühe statistische Studien
3.1.2 Klinisch-quantitative Katamnesestudien
3.1.3 Klinische Einzelfallstudien
3.1.4 Aktuelle europäische Studien
3.1.5 Randomisierte kontrollierte Studien
3.1.6 Kosten-Nutzen-Überlegungen
3.1.7 Zusammenfassung
3.2 Wirksamkeitsforschung zu psychodynamischer Psychotherapie anhand störungsspezifischer Behandlungsmodelle und Therapiemanuale
3.3 Neurobiologische Veränderungen durch psychodynamische Psychotherapie
3.4 Zur Wirksamkeit von psychodynamischen Online-Interventionen
4 Psychotherapieforschung und psychotherapeutische Praxis
4.1 Wirkfaktoren der Psychotherapie
4.2 Konsequenzen für die psychotherapeutische Praxis
4.3 Bedeutung der psychotherapeutischen Technik im Licht der Psychotherapieforschung
4.4 Manuale in der psychotherapeutischen Praxis
4.5 Psychotherapieausbildung
4.6 Evidenzbasierte Behandlungsleitlinien
4.7 Psychotherapeuten als Teilnehmer von Therapiestudien
5 Ziele der Manualreihe
5.1 Zielsetzungen
5.2 Aufbau und Format der Reihe
5.3 Kriterien für den Einschluss von Behandlungsmanualen
5.4 Bisherige Erfahrungen
5.5 Ausblick
Literatur
|7|Einleitung
Die 1. Auflage dieses Buches war vor 10 Jahren der Auftakt zur Reihe „Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“. Um zu der empirischen Absicherung von psychodynamischer Psychotherapie beizutragen, sollen innovative wie bewährte störungsbezogene Behandlungsmanuale für die psychotherapeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung zugänglich gemacht werden. Die vier Herausgeber der Reihe, allesamt Psychoanalytiker und Hochschullehrer, sind seit vielen Jahren in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten, Psychoanalytikern und Fachärzten tätig und waren maßgeblich an der Erarbeitung wissenschaftlich medizinischer Behandlungsleitlinien beteiligt (Bandelow et al., 2014). Sie untersuchten in wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit von psychodynamischen Therapieverfahren ein breites Spektrum von psychischen und psychosomatischen Krankheitsbildern (Beutel et al., 2013, 2014; Doering et al., 2010; Leichsenring, Beutel & Leibing, 2008; Leichsenring et al., 2013, 2014; Leichsenring & Salzer, 2014a; Leichsenring & Schauenburg, 2014; Leichsenring & Steinert, 2018; Leichsenring et al., 2019; Reich, 2007; Reich et al., 2009, 2014; Stefini et al., 2017; Salzer et al., 2018).
Anstoß für diese Reihe war die Tatsache, dass die empirische Fundierung psychodynamischer Psychotherapien in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte gemacht hatte, die für Praktiker und Ausbildungskandidaten oft schwer zugänglich sind. Inzwischen konnten wir eine Reihe z. T. nur im angelsächsischen Bereich publizierter Manuale einer breiten Fachöffentlichkeit in einer anwenderfreundlichen und für die deutschsprachige psychotherapeutische Praxis adaptierten Form zugänglich machen (z. B. Subic-Wrana et al., 2012). Auch die im deutschen Sprachraum in einer Reihe von kontrollierten randomisierten Studien entwickelten und systematisch geprüften psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Verfahren, z. B. zur Behandlung von Sozialen Phobien (Leichsenring et al., 2014), Somatisierungsstörung (Arbeitskreis PISO, 2012), Essstörungen (Friederich et al., 2014) und Persönlichkeitsstörungen bei Jugendlichen (Streeck-Fischer et al., 2016) wurden veröffentlicht.
|8|Im deutschen Versorgungssystem sind etwa 45 % der durch die Krankenversicherungen finanzierten psychotherapeutischen Behandlungen tiefenpsychologische, ca. 2 %analytische und 3 % kombinierte Psychotherapien; die übrigen 50 % sind Verhaltenstherapien (Multmeier & Tenckhoff, 2014). Obgleich die Hälfte der durchgeführten Behandlungen damit psychodynamischer Ausrichtung ist, gab es von psychoanalytischer Seite nur wenige Publikationen und Monografien zu störungsbezogenen Therapiemethoden (Clarkin et al., 2006). Eine kompakte, übersichtliche und klinisch wie wissenschaftlich aktuell aufbereitete Reihe zu Störungsbildern, -gruppen und spezifischen psychotherapeutischen Verfahren fehlte bislang für die psychodynamisch orientierte Praxis.
Dass Manuale aus psychoanalytischer oder tiefenpsychologischer Sicht gegenüber verhaltenstherapeutischen Behandlungsmanualen weniger Verbreitung gefunden haben, hängt nicht zuletzt mit den Störungs- und Behandlungsmodellen der Psychoanalyse zusammen, die weniger störungsspezifische, sondern mehr übergreifende Kategorien (z. B. der psychischen Struktur) zugrunde legen und die individuelle Entwicklung der Übertragungsbeziehung zwischen Therapeut und Patient in den Vordergrund stellen. Parallel hierzu gibt es ein mehr oder weniger explizit formuliertes und tradiertes klinisches Wissen um Behandlungsschwierigkeiten und Interventionsmöglichkeiten bei bestimmten Störungsbildern, das bisher nur unzureichend systematisiert wurde. Das bewährte allgemeine psychotherapeutische Modell gilt es nun explizit um störungsbezogene Merkmale in Diagnostik und Behandlung zu ergänzen. Auf diese Weise lässt sich das diagnostische und behandlungstechnische Repertoire des einzelnen Psychotherapeuten erweitern und dadurch seine Kompetenz vergrößern. Damit wollen wir auch einen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten, die sich in der psychotherapeutischen Praxis zunehmend stellt.
Darüber hinaus erweisen sich angesichts der gegenwärtigen, evidenzbasierten und leitlinienorientierten Behandlungsanforderungen störungsspezifische Ansätze für die wissenschaftstheoretische und gesundheitspolitische Akzeptanz der psychodynamischen Psychotherapie einerseits als unverzichtbar zur Prüfung der empirischen Absicherung dieser Verfahren in den verantwortlichen politischen Gremien (z. B. dem Gemeinsamen Bundesausschuss) in Deutschland. Die Bereitstellung störungsspezifischer psychodynamisch orientierter Behandlungsmanuale ist andererseits eine wesentliche Voraussetzung für die Einwerbung von Fördermitteln zur Durchführung anspruchsvoller standardisierter empirischer Studien, die als Bedingung für einen Wirksamkeitsnachweis gelten.
Die Reihe „Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ soll weiterhin dazu bei|9|tragen, dass die genannten Ziele erreicht werden können, indem störungsbezogen neue und innovative psychodynamische Therapiemethoden für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche auf anschauliche und wissenschaftlich fundierte Weise vermittelt werden.
Anders als Vertreter einer modularisierten Psychotherapie nach dem „Baukastenprinzip“ sind wir nicht der Meinung, dass diese beliebig mit anderen psychotherapeutischen Verfahren und Methoden kombinierbar sind. Methoden sind in einen theoretischen Hintergrund eingebettet, der neben theoretischen Konzepten auch anthropologische Grundannahmen (Menschenbild) und therapeutische Haltungen beinhaltet (Leichsenring et al., im Druck). Die Reihe richtet sich daher an tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeuten und Psychoanalytiker, an Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie an Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, an Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, an Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie sowie an Ausbildungskandidaten, Weiterbildungsteilnehmer und Studierende (Medizin, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften), natürlich auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen, die vorwiegend mit anderen Therapieverfahren (z. B. Verhaltenstherapie, Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Systemische Therapie) arbeiten.
Die einzelnen Bände stellen jeweils ein bestimmtes psychodynamisches Verfahren für einen spezifischen Störungsbereich vor. Voraussetzung für den Einschluss eines Verfahrens in die Reihe ist, dass zumindest ein empirischer Wirksamkeitsnachweis vorliegt. Im Unterschied zu vielen verhaltenstherapeutischen Manualen liegt der Schwerpunkt nicht auf konkreten und detaillierten Behandlungsschritten und -abfolgen. Vielmehr handelt es sich um Prozessmanuale, wie sie für psychodynamische Behandlungsverfahren kennzeichnend sind. Die Schwerpunkte liegen auf der psychodynamischen Diagnostik, auf Übertragungs-/Gegenübertragungsprozessen, auf der therapeutischen Beziehung, auf Abwehr und Widerstand, auf Fokusbildung unter Einbeziehung der Symptomatik und auf der Darstellung von Interventionen, die sich als hilfreich erwiesen haben.
Die 1. Auflage dieses Buches, das von den vier Herausgebern der Reihe gemeinsam konzipiert und verfasst worden war, hat in die Reihe eingeführt. Es sollte im Geiste der Reihe konzeptuelles und methodisches Grundlagenwissen vermitteln und im Spannungsverhältnis zur psychoanalytischen und psychodynamischen Praxis diskutieren. Nach 10 Jahren haben wir für die 2. Auflage an der bewährten Gliederung festgehalten, aber zugleich die wesentlichen neuen Studien und auch die aktuellen Entwicklungstendenzen in diesem Feld ergänzt.
|10|Im 1. Kapitel werden auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen theoretischen Konzepte und Anwendungsbereiche die Entwicklung der psychoanalytischen Behandlungstechnik und die Differenzierung der hauptsächlichen psychodynamischen Verfahren dargestellt. Daran anschließend werden spezifische Fragestellungen diskutiert, u. a. störungsorientierte psychoanalytische Therapie, die Fragen nach Technik vs. Beziehung, nach analytischer vs. tiefenpsychologischer Therapien sowie nach Kurz- vs. Langzeittherapie. Hinzugekommen sind die aktuellen transdiagnostischen Verfahren.
Die Grundlagen evidenzbasierter Psychotherapie werden in Kapitel 2 auch unter wissenschaftstheoretischen Überlegungen dargestellt. Die Wirksamkeit von Psychoanalyse wird anhand der vorliegenden Psychotherapiestudien in Kapitel 3.1 diskutiert, dabei wird auch auf Kosten-Nutzen-Überlegungen eingegangen. Kapitel 3.2 präsentiert eine Übersicht zu störungsbezogenen psychodynamischen Psychotherapien. Kapitel 3.3 präsentiert psychodynamische Online-Verfahren, Kap. 3.4 ausgewählte neurobiologische Befunde. Im 4. Kapitel wird der Einfluss der Therapieforschung auf die klinische Praxis reflektiert. Dabei werden zunächst die Wirkfaktoren von Psychotherapie vorgestellt, bevor anschließend die Bedeutung manualisierter Therapieansätze für die Praxis und die Psychotherapieausbildung sowie der Prozess der Leitlinienerstellung diskutiert werden. Die Vorzüge und Probleme bei der Manualisierung psychoanalytischer Therapieverfahren werden abgewogen und die Möglichkeiten von Psychotherapeuten zur Teilnahme an Therapiestudien auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen besprochen. Kapitel 5 resümiert die Erfahrungen mit der Reihe aus den letzten 10 Jahren und erläutert Zielsetzungen, Aufbau, Format der Reihe sowie Kriterien für den Einschluss von Therapiemethoden.
Mainz, Wien, Gießen und Göttingen, im August 2019
Manfred E. Beutel, Stephan Doering, Falk Leichsenring und Günter Reich
|11|1 Entwicklung von Psychoanalyse und psychoanalytisch begründeten Therapieverfahren
1.1 Differenzierungen und Veränderungen der psychoanalytischen Behandlungstechnik
Seit ihren ersten Anwendungen wurde das behandlungstechnische Vorgehen in der Psychoanalyse und später in den analytischen Psychotherapien immer wieder den jeweiligen Störungsbildern, dem Behandlungsprozess und nicht zuletzt den äußeren Lebensumständen von Patienten angepasst. Freud selbst machte hier den Anfang. So formulierte er, „dass die verschiedenen Krankheitsformen, die wir behandeln, nicht durch dieselbe Technik erledigt werden können“ (Freud, 1919, S. 191). Dabei bezog er sich auch auf Patienten, „die so haltlos und existenzunfähig sind, dass man bei ihnen die analytische Beeinflussung mit der erzieherischen vereinigen muss“ (Freud, 1919, S. 190). Freud selbst variierte seine Position zwischen Modifizierung und Kodifizierung, unter anderem aufgrund der in der Frühzeit der Psychoanalyse vorkommenden gravierenden Abstinenzverletzungen sowie der Probleme, die die „wilde Analyse“ für Patienten und den Ruf dieser vielfach angefeindeten neuen Therapie erbrachte.
Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen, die Psychoanalyse für bisher nicht erreichte Leidende verfügbar zu machen. „Andererseits lässt sich vorhersehen: Irgend einmal wird das Gewissen der Gesellschaft erwachen und sie mahnen, dass der Arme ein ebensolches Anrecht auf seelische Hilfestellung hat wie bereits jetzt auf lebensrettende chirurgische. Und dass die Neurosen die Volksgesundheit nicht minder bedrohen als die Tuberkulose und ebenso wenig wie diese der ohnmächtigen Fürsorge der Einzelnen aus dem Volke überlassen werden können. Dann werden also Anstalten oder Ordinationsinstitute errichtet werden, an denen psychoanalytisch ausgebildete Ärzte angestellt sind, um die Männer, die sich sonst dem Trunk ergeben würden, die Frauen, die unter der Last der Entsagungen zusammen|12|zubrechen drohen, die Kinder, denen nur die Wahl zwischen Verwilderung und Neurose bevorsteht, durch Analyse widerstands- und leistungsfähig zu erhalten. (…) Es mag lange dauern, bis der Staat diese Pflichten als dringende empfindet (…) aber irgend einmal wird es dazu kommen (…). Wir werden wahrscheinlich auch sehr genötigt sein, in der Massenanwendung unserer Therapie das reine Gold der Analyse reichlich mit dem Kupfer der direkten Suggestion zu legieren, und auch die hypnotische Beeinflussung könnte dort wie bei der Behandlung der Kriegsneurotiker wieder eine Stelle finden“ (S. 193).
Vorschläge zur Modifikation der psychoanalytischen Technik bezogen sich von Beginn an auf folgende Aspekte:
Eine Verkürzung der Dauer psychoanalytischer Behandlungen, obwohl diese in den 1920er, 1930er und 1940er Jahren oft nicht über ein Jahr hinausgingen. Freuds Hysterie-Behandlungen könnten durchaus als „hochfrequente Kurzzeitanalysen“ bezeichnet werden (Rüger & Reimer, 2006a, S. 4).
Eine Intensivierung des psychoanalytischen Prozesses.
Eine Erweiterung auf bisher nicht oder nur unzureichend behandelbare oder behandelte Patientengruppen, z. B. auf die Behandlung älterer Patienten (Abraham, 1919).
Dabei spielten folgende Aspekte, die im Weiteren detaillierter behandelt werden, eine wesentliche Rolle:
Die Einführung von Verhaltensaufforderungen, die die spezifische Abwehr, z. B. das Vermeiden bei Angstneurotikern, direkt angehen sollte.
Die zunehmende Berücksichtigung der Ich-Struktur und deren Störungen sowohl bei den „klassischen Übertragungsneurosen“ wie bei anderen Störungsbildern mit „Ich-Schwächen“.
Die Erfahrung, dass hauptsächlich durch Aktualkonflikte (d. h. nicht durch langfristige neurotische Entwicklungen) bedingte Störungen in kürzeren Therapien behandelt werden konnten.
Die zunehmende Berücksichtigung der Interaktionsmuster von Patienten innerhalb wie außerhalb der therapeutischen Beziehung und die Nutzung von deren Bearbeitung für den therapeutischen Prozess.
Modifikationen der psychoanalytischen Technik waren lange Zeit mit dem Verdikt der „Dissidenz“ versehen. Cremerius (1984c) zeigt auf, dass Freud selbst in seiner Behandlungstechnik „dissidenter“ war, als viele seiner engeren Schüler und Nachfolger. Die Entwicklung der Psychoanalyse zeigt, dass Konzepte und technische Überlegungen, die zunächst als „dissident“ galten, im Verlaufe der Zeit zumindest partiell Eingang in den psychoanalytischen „mainstream“ fanden. Dies gilt für Alexanders und Frenchs „korrigierende emotionale Erfahrung“ ebenso wie für Kohuts Konzept des |13|Selbstobjekts (vgl. auch Mertens, 1990; Thomä & Kächele, 2006). Kaum jemand wird heute ernsthaft bestreiten, dass eine gelungene psychoanalytisch begründete Psychotherapie auch eine verändernde emotionale Erfahrung und oft auch eine neue Selbstobjekt-Erfahrung ist. Beispielsweise ist das bei wirksamen Therapien beim Patienten vorhandene oder zunehmende Gefühl von Sicherheit eine solche notwendige Erfahrung mit einem bedeutenden anderen (vgl. auch Thomä & Kächele, 2006, S. 358). Erhellend ist in diesem Zusammenhang auch das Schicksal der Bindungstheorie, der hieraus folgenden Bewertung der äußeren Beziehungsrealität sowie deren Verarbeitung und die mit diesem Ansatz verbundenen therapeutischen Konsequenzen. Obwohl empirisch und konzeptuell überaus fruchtbar, wurde das Konzept Bowlbys (1960) zunächst von prominenten Psychoanalytikern zurückgewiesen (Anna Freud, 1960; Max Schur, 1960; René Spitz, 1960) und über Jahrzehnte kaum zur Kenntnis genommen, so dass sich die Weiterentwicklung der Bindungstheorie und -forschung außerhalb der psychoanalytischen Gemeinschaft vollzog. Heute ist sie jedoch, nicht zuletzt durch die Beiträge Fonagys und Mitarbeiter (2003, 2004), weitgehend ein integraler Bestandteil psychoanalytischer Entwicklungstheorie geworden. Fonagys Konzept der „Mentalisierung“, das bindungstheoretische Grundlagen hat, wird von vielen Psychoanalytikern und psychodynamisch arbeitenden Therapeuten in ihren Fallkonzeptionen und Behandlungen berücksichtigt. Hieraus hat sich inzwischen eine eigene modifizierte psychoanalytische Therapiemethode schwerer Störungen entwickelt (Bateman & Fonagy, 2008).
1.2 Parameter in der psychoanalytischen Behandlung
Freud selbst setzte in seinen Behandlungen direktive Elemente ein, etwa die Terminsetzung beim Wolfsmann (Freud, 1918). Theodor Reik riet er z. B., eine Patientin, bei der sich keine Übertragungsgefühle zeigten, eifersüchtig zu machen, indem er eine andere Patientin besonders herzlich begrüßte. Eduardo Weiß empfahl er eine Unterbrechung der Therapie einer Patientin, um einem Abbruch zuvorzukommen (vgl. Cremerius, 1984b). Hiermit schlug er eine fraktionierte psychoanalytische Behandlung vor.
Aus Unzufriedenheit mit der weitgehend auf Rekonstruktion und Einsicht beruhenden psychoanalytischen Technik entwickelten Ferenczi und Rank (1924) eigene Modifikationen. Ferenczi benutzte in seiner „aktiven Technik“ (1920) Aufforderungen und Verbote, um die Abwehr zu labilisieren und Neuerfahrungen zu ermöglichen. Diese Techniken wurden von ihm wieder zugunsten einer partiellen Befriedigung von Zuwendungswünschen |14|in der Analyse aufgegeben. Ein Beweggrund dabei war, schwerer gestörten Patienten zu helfen, denen mit bisherigen Mitteln nicht geholfen werden konnte. Eine differenzierte Bewertung seiner Verdienste und Irrtümer gibt Cremerius (1979, 1984c). Auf ebenso heftige Kritik wie die Arbeiten Ferenczis und Ranks, der die Genese von seelischen Erkrankungen sehr stark auf die Verarbeitung des Geburtstraumas einengte, stießen die Vorschläge von Alexander und French (1946), die ebenfalls die Bedeutung der Beziehung zwischen Therapeut und Patient gegenüber der Einsicht betonten und die Unterschiede zwischen Psychoanalyse und modifizierten Formen in Frage stellten. All diese Ansätze standen im Gegensatz zu einer von Eissler (1958) wohl eher defensiv formulierten „normativen Idealtechnik“, in der die Deutung zur einzigen bzw. einzig bedeutsamen Technik erhoben wurde (Thomä & Kächele, 2006). Hierdurch wiederum wurde der Kreis der psychoanalytisch behandelbaren Patienten erheblich eingeschränkt. Technische Veränderungen galten nunmehr als „Parameter“, die in einer psychoanalytischen Therapie zurückgenommen und durch Deutung aufgehoben werden sollten. Damit wurde konzeptuell ein tiefer Graben zwischen der Psychoanalyse einerseits und den modifizierten Anwendungen andererseits (analytische Psychotherapie, psychodynamische Psychotherapie) ausgehoben.
Schon vorher erschienen technische Veränderungen durch die Gold-Kupfer-Metapher (Freud, 1919) als qualitativ geringwertiger. Erst die Entwicklungen der letzten 20 Jahre, insbesondere die Ergebnisse psychodynamischer Therapien in der vergleichenden Psychotherapieforschung scheinen an diesem Bild etwas zu verändern. Dabei ist auch der aktive Beitrag des Therapeuten zur Entwicklung der therapeutischen Beziehung, der Übertragung und des Behandlungsverlaufes wieder stärker in den Vordergrund der Betrachtung gerückt. „Jedes Phänomen, das in der psychoanalytischen Situation spürbar oder beobachtbar ist, wird vom Psychoanalytiker beeinflusst“ (Thomä & Kächele, 2006, S. 9).
Die Entwicklung der psychoanalytischen und der psychodynamischen Therapien wurde insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst:
Die Entwicklung der Ich-Psychologie, die ein breiteres Krankheitsverständnis und einen spezifischen und differenzierten Zugang zu schwerer und auch leichter gestörten Patientengruppen ermöglichte.
Hieraus folgend auch die zunehmende Beachtung kognitiver und regulativer Funktionen bei verschiedenen Störungen.
Die Beachtung der Über-Ich-Funktionen.
Die zunehmende Berücksichtigung typischer Interaktionsmuster bei speziellen Störungsbildern in der Übertragung sowie in den außer|15|therapeutischen Beziehungen, also die zunehmende Bedeutung der interaktionellen und interpersonellen Perspektive.
Die Einflüsse der Objektbeziehungstheorie, der Selbstpsychologie und zuletzt der Säuglings- und Kleinkindforschung sowie der Bindungstheorie.
1.3 Der Einfluss der Ich-Psychologie
Der Beitrag Otto Fenichels
Ein wesentlicher Grund zur Entwicklung von Modifikationen in der Technik der psychoanalytischen Behandlungen liegt in der Einschätzung der „Stärke“ bzw. „Beschaffenheit“ des Ichs. In seiner Arbeit „Ich-Störungen und ihre Behandlung“ (1938) unterscheidet Fenichel zwei Formen der frühen Konfliktbewältigung. Eine, in der das Subjekt „die Angst und das Symptom sofort nach ihrem ersten Erscheinen durch fortgesetzte Verdrängung ausgeschaltet hat – eine Verdrängung, die dann in der Übertragungssituation durchbrochen wird“ – und eine andere, bei der „das Ich das Symptom in sich selbst aufnimmt und so seine eigene Natur verändert“ (a. a. O., S. 129). Auch wenn Fenichel in dieser Arbeit weitgehend triebtheoretisch-ökonomisch argumentiert, weist er im Folgenden darauf hin, dass ein wie skizziert verändertes Ich in der Behandlung nicht so mitarbeitet, wie es psychoanalytische Therapie eigentlich voraussetzt („Die analytische Behandlung vertraut auf die Mitarbeit des vernünftigen Ichs …“, a. a. O., S. 131). Die Arbeit an der Ich-Störung gewinnt Vorrang. In den Fällen, in denen der „gesunde Rest der Persönlichkeit“ fehlt, „muss er durch eine pädagogische Vorbereitungsphase geschaffen werden“ (a. a. O., S. 132). Daher empfiehlt er auch Abweichungen von der Regel, dass der Patient den Gegenstand der Sitzung bestimme. Durch „dynamische Deutung“ müssten auch die Dinge angesprochen werden, die der Patient spontan nicht erwähnt und die „unfreiwillig zutage treten“ (a. a. O., S. 134).
Dass psychoanalytische Therapie die Besonderheiten der Ich-Struktur berücksichtigen muss, skizziert er z. B. an den Zwangsneurosen, bei denen das Ich unter anderem dem magischen Denken verhaftet bleibt, und bei denen zunächst die Affektisolierung bearbeitet sein muss, bevor inhaltliche Deutungen wirksam werden können (Fenichel, 1982). Modifikationen der psychoanalytischen Technik beschreibt er auch für Impulsneurosen und Süchte. Diese erfordern eine erhöhte Aktivität des Therapeuten wegen der Spannungsintoleranz und der Neigung zum Ausagieren bei diesen Patienten.
|16|Der Beitrag Paul Federns
Federn entwickelt ein vom Freudschen Ich-Begriff z. T. abweichendes Konzept, das eher am Ich-Erleben orientiert ist. Das Ich ist für ihn die „Empfindung und das Wissen des Individuums von der dauernden oder wieder hergestellten Kontinuität in Zeit, Raum und Kausalität, seines körperlichen und seelischen Daseins“ (Weiss, 1978, S. 16). Heute würde hier wohl eher vom Selbst gesprochen werden. Auf der anderen Seite sind mit seinem Ich-Begriff durchaus auch die funktionellen Leistungen angesprochen, auf die Freud sowie die späteren Ich-Psychologen abzielen. Federn widmete sich insbesondere der Behandlung von Psychosen, präpsychotischer und psychoseähnlicher Entwicklungen und formulierte hierbei einige Prinzipien, die auch heute noch in der Behandlung schwerer seelischer Störungen (siehe z. B. den folgenden Abschnitt) Anwendung finden. Psychose stellt einen Zusammenbruch, ein Erliegen des Ichs dar. „Die Psychose selbst ist keine Abwehr, sondern eine Niederlage“ (Federn, 1949, S. 175). Von daher muss der Psychotiker angehalten werden, mit seiner psychischen Energie sparsam umzugehen, das Ich nicht weiter zu überfordern. Die Behandlung soll nicht neues unbewusstes Material zu Tage fördern, wie bei den Neurotikern. Im Gegenteil: gegen das Anfluten von Primärprozesshaftem müssen Widerstände und Abwehr gestärkt werden, damit das Ich wieder „arbeitsfähig“ werden kann. Nur die positive Übertragung ist in der Behandlung dieser Patienten von Nutzen. Sie soll nicht gedeutet werden. Negative Übertragung muss vermieden werden. Dem Psychotiker ist bei der Bewältigung der Probleme der äußeren Lebensrealität, der Unterscheidung zwischen der eigenen Person und der Außenwelt, der Wahrnehmung und der Projektion zu helfen. Die psychotischen und irrationalen Konflikte sind auf die zugrunde liegenden objektiven Konflikte zurückzuführen. Dabei muss das Setting flexibel gehalten werden. Der Therapeut muss auch außerhalb der festgesetzten Stunden zur Verfügung stehen. Er muss vor allem glaubwürdig sein. Probleme des Patienten sollten mit anderen nur in dessen Beisein besprochen werden. Dabei sind Angehörige durchaus in die Behandlung mit einzubeziehen (Federn, 1947; Weiss, 1978).
Ich-psychologisch orientierte Psychotherapie nach Getrude Blanck und Rubin Blanck
Aufbauend auf den entwicklungspsychologischen Hypothesen und Erkenntnissen von Spitz, Jacobson und Mahler sowie den Theorien von Hartman, Kris und Loewenstein entwickelten Gertrude und Rubin Blanck (1985) Vor|17|schläge zur Behandlung schwer gestörter und häufig auch unmotivierter Patienten. In ihrer deskriptiven Entwicklungsdiagnose versuchen sie, die jeweils erreichte Entwicklungsstufe in der Selbstobjekt-Differenzierung und der „Ich-Reifung“ zu erfassen, wobei z. B. das Niveau der Angst und die Angsttoleranz eine zentrale Rolle spielen. „Bei schwächer strukturierten Persönlichkeiten liegt das technische Problem daher nicht darin, das Unbewusste bewusst zu machen, sondern das Ich zum Umgang mit den Trieben zu befähigen, indem Libido und Aggression neutralisiert und dadurch für den Aufbau höherer Objektbeziehungen verfügbar werden“ (Blanck & Blanck, 1985, S. 131). „Die Faustregel lautet hier, dass Abstinenz und Deutung des Wunsches in Ordnung sind, wenn zuviel Befriedigung angeboten wurde; wo die Deprivation zu stark war, ist ein gewisses Maß an Befriedigung angezeigt“ (S. 163). „Die Befriedigung darf aber niemals so weit gehen, dass eine Fixierung an die Therapie die Folge ist. Sie muss stets symbolischer Art sein“ (S. 164).
Therapeutische Maßnahmen nach Blanck und Blanck:
Ich-Stützung: Dem Patienten sind konkret die Bereiche, Erlebensweisen und Handlungen aufzuzeigen, in denen seine Ich-Entwicklung die höchste Stufe erreicht hat. Der Patient soll hierdurch seine Stärken (heute würden wir sagen: Ressourcen) kennenlernen. „Initiative, Realitätsprüfung, Neugier und Wissensdrang, Mut zum Widerspruch können dort wieder aufgenommen werden, wo die Entwicklung zum Stillstand kam, als die Ausübung dieser Ich-Funktionen in der Kindheit entmutigt wurde und scheiterte“ (S. 418).
Stärkung der Abwehrfunktion des Ichs. Insbesondere ist es therapeutisches Ziel, „das Ich zu befähigen, Angst zu tolerieren und damit fertig zu werden, und sie, wenn möglich, auf die Ebene der Signalangst zu heben“ (S. 419). Dem Patienten müsse bei überflutenden, Angst erregenden Vorstellungen auch vermittelt werden, dass er „ein Recht auf Besänftigung hat“ (S. 420). Wenn derartige Vorstellungen auftauchen, solle „jede erdenkliche Erleichterung geschaffen“ werden, „etwa durch verstandesmäßige Erklärungen, durch die Lockerung des Drucks allzu strenger Über-Ich-Komponenten usw. So kann man zum Beispiel dem Erwachen aus einem Angsttraum den Schrecken nehmen, indem man bemerkt: „Zumindest konnten Sie der Angst Herr werden, indem Sie erwachten“ (S. 420).
Verbalisierung macht bis dahin unerwähntes, auch präverbales Material zugänglich, hilft vor allem der Neutralisierung, stärkt somit das Ich.
|18|Ich-Bildung durch Stärkung der synthetischen Funktion des Ichs. Der Patient soll ermutigt werden sein eigenes Verständnis von Erlebens- und Verhaltensweisen zu formulieren, zu „deuten“.
Neutralisierung beider Triebe durch Etablieren eines vorhersehbaren Rhythmus von Befriedigung und Frustration. Dazu muss das therapeutische Klima Vorhersehbarkeit bieten.
Neben neutralisierter Libido muss neutralisierte Aggression eingesetzt werden können, damit Autonomie-Entwicklung stattfinden kann. Ein „zu guter“ Therapeut verhindert Wut, Frustration und deren Bemeisterung.
Konfrontation soll dem beobachtenden Teil des Ichs helfen, „den erlebenden Teil ‚anzuschauen‘ und ihm intrasystemisch entgegenzutreten“ (S. 426).
Verinnerlichungen führen allmählich zu neuen Ich- und Über-Ich-Identifizierungen.
Regulierungen, die vorher nur in der therapeutischen Beziehung möglich waren, werden dabei in die Ich-Struktur aufgenommen.
Die Autonomie ist während der gesamten Behandlung entsprechend den Ich-Fähigkeiten des Patienten und der Entwicklung in der Selbstobjekt-Differenzierung zu schützen und zu fördern.
Kriterien für die Beendigung einer solchen Behandlung sind:
Erwerb von Identität.
Linderung der vorgebrachten Beschwerden.
Erwerb der Fähigkeit zu kompetenter Abwehr (Signalangst statt traumatischer Angst).
Die Objektbeziehungen nähern sich der Objektkonstanz. „Der Therapeut wird nicht mehr gebraucht, um dem Patienten zu helfen, seine Ich-Funktionen auszuüben“ (S. 437).
Damit sind höhere Ebenen der Verinnerlichung erreicht.
„Das Ich übt seine Funktionen in immer höherem Maße selbst aus und lässt den Therapeuten hinter sich“ (S. 437). Dabei soll die Furcht vor dem Ende der Beziehung bei dieser Patientengruppe als mangelnde Erfahrung mit der Objektkonstanz verstanden werden.
Auch wenn die zuletzt genannten Kriterien z. T. sehr weit gefasst sind und von daher „schwammig“ wirken, lohnt es sich doch, sich die Überlegungen und Vorschläge des Autorenpaares genauer vor Augen zu führen, denn sie finden sich partiell auch in vielen anderen Behandlungsmodifikationen, z. B. was die Internalisierung von Regulierungsfunktionen, die adaptive Funktion der Abwehr und auch die Betonung der Ich-Stärken angeht.
|19|Ich-Psychologie und interaktionelle Perspektive: Die psychoanalytisch-interaktionelle Therapie nach Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl und ihre Weiterentwicklungen
Diese zum guten Teil ebenfalls durch die Ich-Psychologie beeinflusste Behandlungsform entstand wie die eben beschrieben von Blanck und Blanck aus der Arbeit mit schwer gestörten Patienten, mit z. B. Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen, antisozialem Verhalten oder Perversionen und defizitären Über-Ich-Funktionen (z. B. Forensik). Sie ist für Patientinnen und Patienten mit schweren strukturellen Beeinträchtigungen gedacht, wie sie durch die Diagnostik entlang der Strukturachse von OPD-2 festgestellt werden können. Es bestehen massive Probleme in wesentlichen Bereichen der Selbstregulierung (z. B. Affektwahrnehmung und -regulierung) und in den interpersonellen Beziehungen, bei in der Regel unrealistischem Selbstbild und nicht selten ausgeprägter Kränkbarkeit. Auch das körperliche prozedurale Beziehungswissen ist oft gestört, so dass körperliche Signale (Gesten, Mimik) nicht „verstanden“ werden (Streeck & Leichsenring, 2015; Streeck, 2018).
Diese entwicklungsgestörten Patienten brauchen nicht zu regredieren, damit sich infantile Affekte, Impulse und Beziehungswünsche an der Oberfläche zeigen. Aufgrund der Schwäche der Abwehr sind sie oft schon bewusst, können aber nur schädigend oder selbstschädigend „gehandhabt“ oder „reguliert“ werden. Die Therapie basiert zum einen auf einem „objektivierenden Blick“ auf die defizitären Strukturen, zum anderen auf einer sozialwissenschaftlich-kontextuellen Perspektive der Mikronalayse von Interaktionen (Streeck, 2018). Bezugpunkt ist die gemeinsam geteilte soziale Lebenswelt von Patient und Therapeut, auf die sich beide in der Therapie beziehen (Streeck, 2018).
In der therapeutischen Beziehung werden hier intrapsychisches Erleben und Interaktion auf einer bewussten Ebene in einem aktiven Austausch verbunden. Dies geschieht durch die „Antwort“ des Therapeuten, in der dieser dem Patienten als Subjekt mit einer eigenen Realität begegnet und ihm so zu komplementären oder alternativen Sichtweisen des eigenen Erlebens und Verhaltens verhilft. Gegenwartsorientiert und sozial resonant wird „selektiv authentisch“ progressionsfördernd unter Beachtung der jeweiligen Toleranzgrenzen gearbeitet, indem der Therapeut eigenes Erleben und eigene Handlungsbereitschaften einbringt, sich u. a. virtuell „in die Schuhe“ des Patienten oder anderer Personen stellt.
|20|Dieser Modus kann folgende Funktionen erfüllen (Streeck, 2018; Streeck & Leichsenring, 2015):
Die Differenz von Selbst und Objekt und damit Getrenntheit und Individuierung werden betont.
Die Wirkungen des Verhaltens des Patienten auf andere (hier: Therapeut), deren Erleben und Handlungsbereitschaften werden selektiv herausgearbeitet.
Der Beitrag des Patienten zur Aufrechterhaltung maladaptiver Beziehungsmuster wird auf diese Weise klar aufgezeigt.
Die Entwicklung von auf Wechselseitigkeit gründenden Beziehungen wird so unterstützt.
Die interaktiven Kompetenzen sowie die Fähigkeiten zu hinreichend stabilen Kontakten werden verbessert.
Grundlegende Elemente interpersonellen Geschehens werden transparent.
Der Therapeut zeigt, dass er seine Grenzen beachten und schützen kann, sich nicht in destruktive und ausbeuterische Muster verstricken lässt. Das reduziert die Angst schwer gestörter Patienten vor heftigen Impulsen und Affekten.
Die Entwicklung nicht oder nur eingeschränkt vorhandener psychischer Funktionen wird gefördert, damit auch das Mentalisieren.
Ähnlich wie in dem Ansatz von Blanck und Blanck übernimmt der Therapeut u. a. Hilfs-Ich-Funktionen in folgenden Bereichen (vgl. König, 1993; Streeck, 2006, 2018, Streeck & Leichsenring, 2015):
Kontaktinitiative durch den Therapeuten.
Eingrenzen der Regression, z. B. durch Vermeiden von Schweigepausen.
Kein „Eintauchen“ in die Vergangenheit, Gegenwartsbezug.
Orientierung auf Progression.
Primat der Selbstregulierung und deren Förderung. Unterstützung der Regulierungsfunktion bei entsprechenden Problemen.
Besondere Aufmerksamkeit für körperliches nichtsprachliches Interaktionsverhalten.
Normative Regulierungen: Es wird aufgezeigt, welche Folgen bestimmte normative Regulierungen, z. B. in Gruppen, haben. Zudem wird eine gewisse Modellfunktion im Verhandeln von Normen übernommen.
Regulierung interpersoneller Beziehungen: Mögliche Wirkungen des eigenen Verhaltens auf andere werden aufgezeigt. Patienten mit schweren Störungen fehlen hier oft realistische Einschätzungsmöglichkeiten.