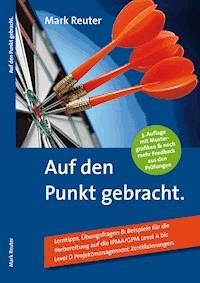Psychologie im Projektmanagement
Eine Einführung für Projektmanager und Teams
von Mark Reuter
www.publicis-books.de
Vollständige ePub-Ausgabe von Mark Reuter, „Psychologie im Projektmanagement“
ISBN 978-3-89578-361-6 (Printausgabe)
ISBN 978-3-89578-715-7
Verlag: Publicis Publishing
© Publicis Erlangen, Zweigniederlassung der PWW GmbH
Einleitung
Sie machen Projekte? Sie sind also Projektleiter oder Projektleiterin? Dann wissen Sie sicherlich: Projekte sind in Mode! Projektleiter sind in! Problematisch ist nur: Unter dem Begriff des Projektmanagements werden ganz unterschiedliche Dinge zusammengefasst. Was ein Projekt ist und was kein Projekt ist oder wo die Grenzen liegen, wird von verschiedenen Personen ganz unterschiedlich verstanden. Und was Projekterfolg ist, ist mindestens so vielschillernd. Operation gelungen – Patient tot? Dies trifft auf jeden Fall bei manchen Projekten zu. Projekte sind also irgendetwas zwischen Ausnahme und Planbarkeit, zwischen Komplexität und Machbarkeit, zwischen Risiko und Hoffnung.
Am Anfang meiner Seminare stelle ich regelmäßig fest, dass kaum zwei Teilnehmer im Raum sind, die die gleiche Vorstellung davon haben, was man unter Projektmanagement versteht. Offensichtlich werden unter dem Begriff des Projektmanagements ganz unterschiedliche Dinge zusammengefasst. Dies führt dazu, dass in manchen Betrieben Projektmanagement sehr „individuell“, „pragmatisch“ oder auch „spontan“ gehandhabt wird. Ein Projekt wird dann schnell mal aus der Taufe gehoben, ohne die formellen organisatorischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen richtig geklärt zu haben. In größeren Organisationen finden sich zumeist solche Regelungen, sie bleiben jedoch häufig abstrakt und werden nicht auf das jeweilige Projekt konkretisiert. Unklar bleiben in diesen Fällen die Zuständigkeiten und die Verantwortungsgrenzen des Projektleiters – gerade im Blick auf die Aspekte, die nicht den technischen Inhalt des Projektes betreffen: Wo beginnt und wo endet seine Macht gegenüber der Linie? Wie kann er die notwendigen Ressourcen aus den Fachabteilungen bekommen – gerade dann, wenn diese nicht sehr positiv seinem Projekt gegenüberstehen? Welche Möglichkeiten stehen ihm offen im Umgang mit schwierigen Personen und Situationen in seinem unmittelbaren und weiteren Projektumfeld? Was darf, kann und muss der Projektleiter selbst entscheiden – und was nicht? Nicht selten fühlen sich gerade unerfahrene Projektleiter ohnmächtig, diese grundsätzlichen Fragen zu klären. Da wird dann schnell darauf vertraut, dass man bei gegebenem Anlass den Rückhalt bei den eigenen Verantwortlichen hat. Meistens geht das nur so lange gut, wie das Projekt „problemlos“ läuft. Tauchen entsprechende Schwierigkeiten auf, wird nicht die mangelhafte Ausstattung der Rolle des Projektleiters verbessert, sondern schnell die persönliche Kompetenz des Projektleiters in Frage gestellt! So mancher Projektleiter empfindet sich in seiner Rolle daher als zahnloser Papiertiger, der sich gleichzeitig für sein Projekt mit Feuer und Flamme einsetzt, aber dabei zugleich zu verbrennen droht (Burn-out).
Die Ursache für diese erlebte Misere in der Praxis ist dabei nicht ausschließlich einem Faktor zuzuordnen. Wie so oft im Leben tragen mehrere Einflüsse zum Gelingen oder Misslingen bei. Meine These ist: Sollen Projekte erfolgreich zu Ende gebracht werden, braucht es im Projektmanagement in erster Linie ein bewusstes psychologisches Können. Gelegenheiten, dieses psychologische Können im Projekt unter Beweis zu stellen, gibt es viele:
beim Erspüren von unausgesprochenen Erwartungen und Erfolgskriterien an das Projekt durch die Auftraggeber
im Umgang mit externen Faktoren, die scheinbar so ganz nebenbei das Projekt beeinflussen
beim Verhandeln über den Zugriff auf Ressourcen mit externen Partnern oder internen Vorgesetzten
im Umgang mit Mitarbeitern, um diese für die Mitarbeit zu begeistern und später auch zu führen
bei der Selbstmotivation und Selbstausrichtung der eigenen Person.
Projektmanagement als designtes Management
Diese Aussage mag im ersten Moment etwas ungewöhnlich erscheinen: Projektmanagement als „Design“? Für viele Menschen ist „etwas zu designen“ eine künstlerische oder auch mal technische Tätigkeit. Das Wort „Design“ bedeutet wertneutral etwas „planen“, „entwerfen“, „gestalten“. Berücksichtigt man diese eigentliche Wortbedeutung, muss man festhalten: Insofern der Mensch ein Objekt bewusst formt oder gestaltet, ist dies Design. Diese Formgebung ist nicht zufällig, sondern unterliegt bestimmten Intentionen oder Prinzipien. Wenn also der Projektleiter das Projektgeschehen bewusst formt oder gestaltet, ist er Designer. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen: Neben Objekten, die durch ihre Form begreifbar sind, werden auch Ideen und Abstraktes erst durch eine Form begreifbar. Planen und Steuern als geistige Vorgänge sind solche Vorgänge. Sie sollten nicht „zufällig“ vom Projektleiter, seinen Erfahrungen und Vorstellungen abhängig sein. Vielmehr sollte ein Projektleiter sein Projekt nach bestimmten formalen und persönlichen Kriterien planen und steuern.
Anders ausgedrückt heißt das: Jeder Mensch ist in der Lage, durch Introspektion und Retrospektion den eigenen Gedanken und Gefühlen eine Form zu geben. Dieses Gestalten von Immateriellem zeichnet den Menschen aus! Planung und Steuerung eines Projektes sind Ergebnisse einer solchen Reflexion, sind also individuelle Leistungen der Formgebung. Also: Projektleiter reflektiere, was Du planst und wie Du steuerst. Dadurch bestimmst Du das Design Deines Projektmanagements.
Nur am Rande sei angemerkt, dass die Fähigkeit, Dinge bewusst zu gestalten eine Fähigkeit ist, die den Menschen aller Zeiten und Zonen innewohnt. Schon in den frühen Höhlenmalereien wird durch die zeichnerische Gestaltung versucht, den eigenen Gefühlen wie z. B. Angst vor den gefährlichen Tieren oder auch zukünftigen Ereignissen – wie der bevorstehenden Jagd – Ausdruck zu verschaffen. Bis zur Beginn der Moderne gab es immer einen vorherrschenden Stil in der europäischen Kunstgeschichte. Diese einseitige Ausrichtung zerbrach und wurde bis heute nicht mehr erreicht. In unserer Zeit steigert sich in der künstlerischen Gestaltung diese „pluralistische“ Bewegung manchmal bis ins Absurde und Groteske (siehe z. B. Dadaismus). Heute tritt durch die Vielfalt der Formen eine Beliebigkeit auf, die einem ästhetisierendem „Schön ist, was gefällt“ mündet.
Und was hat das mit Projektmanagement zu tun? Projekte zu managen ist eine bewusste Gestaltung des Projektgeschehens. Jedoch gibt es eine unüberschaubare Fülle an Methoden und Ansätzen, Werkzeugen und Techniken, um bestimmte Fragestellungen im Projektmanagement darzustellen, aufzubereiten oder zu lösen. Projektmanagement ist gewissermaßen ein Baumarkt der Problemlösungsmethoden, und der Projektleiter muss immer wieder auswählen, welche „Tools und Techniken“ er einsetzen möchte. Der Projektleiter gestaltet damit – bewusst oder unbewusst – das weitere Projektgeschehen.
Wir leben im Zeitalter der Baumärkte mit ihrem Überfluss an Tools und Templates, Methoden und Techniken im Projektmanagement. Projektarbeit verlangt, dass sich der Projektleiter immer wieder neu auf die Ziele und Anforderungen des Projektes einstellt, so wie ein guter Verkäufer sich auf seinen Kunden einstellt oder ein guter Arzt auf die Bedürfnisse seines Patienten. Persönliche Gewohnheiten, aber auch die Arbeit der Fachverbände mit ihren vorgefertigten Kategorien geben hier eine gewisse Orientierung. Dennoch: In der Tagesarbeit bin ich es als Person, die der Arbeit eine unverwechselbare Form gibt.
Was ist psychologisches Projektmanagement?
In meinen Projektmanagement-Seminaren sage ich manchmal scherzhaft, dass mancher Projektmitarbeiter – aber auch mancher Projektleiter – einem „autistischen Hacker“ gleiche. Diese Formulierung kommt erstaunlicherweise gerade bei vielen IT-Mitarbeitern gut an, denn jeder kennt einen Kollegen, der in dieses Vorurteilsraster passt. Natürlich soll mit dieser Formulierung niemand verletzt werden! Es handelt sich ja um ein Stereotyp, das humorvoll eingesetzt wird. Aber hinter dem Scherz verbirgt sich noch mehr, denn in der Tat wird manchmal das Managen eines Projektes betrieben wie ein rein mechanisches Handwerk, als eine Art Rechenkunst, die nach einer mathematischen Gleichung am Ende aufgehen muss, dass es mehr oder weniger isoliert von der Umgebung durchgeführt werden kann. Oder wie es eine andere Teilnehmerin am Ende eines Seminars einmal ausdrückte: „Ich habe hier gelernt, dass Projektmanagement und die Bedienung von MS Project ein Unterschied ist“.
Psychologisches Projektmanagement stellt die vielfältigen menschlichen Ebenen, die es in einem Projekt gibt, in den Vordergrund. Es geht um:
mich selbst, mein eigenes Selbstbild als Projektleiter, meine Ethik, den inneren Dialog, den ich mit mir führe, und der wichtig ist in Hinblick auf die Frage, was mir wichtig ist und wie ich bestimmt und selbstsicher in meiner Rolle auftreten kann. Es geht um die Selbstreflexion hinsichtlich meines Wissens und Könnens und um die Frage, ob ich als Projektleiter geeignet bin.
die Beziehung, die ich zum Kunden bzw. Auftraggeber habe: es geht um das Entwickeln einer gemeinsamen Denke, um das Verstehen des anderen: Warum und wofür braucht der Kunde das Produkt, welche Absicht verfolgt der Kunde letztlich, in welchem Kontext soll das Produkt zum Einsatz kommen etc. Es geht um das Erspüren von unausgesprochenen Erwartungen und Erfolgskriterien an das Projekt durch die Auftraggeber.
den Umgang mit Mitarbeitern, die es zu gewinnen gilt, deren Einsatz und Leistung es zu steuern gilt: Es geht um Motivation und nicht um Manipulation.
mein Verhältnis, das ich mit externen Lieferanten oder internen Vorgesetzten habe, deren Engagement und Unterstützung ich brauche.
Ich plädiere in diesem Buch für den bewussten Einsatz einer intra-individuellen und inter-individuellen Kompetenz, die menschliche Prozesse in den Vordergrund stellt und die es braucht, um eine komplexe Aufgabe zu lösen – etwas, das immer wieder als wichtig und richtig erkannt wird und trotzdem häufig auf der Strecke bleibt. In der Sprache des Projektmanagements stehen vor allem im Vordergrund: Stakeholdermanagement, Kommunikation und Beziehungsmanagement, Konfliktklärung, Ethik und Reflexion.
Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, ich sehe durchaus die Notwendigkeit, technische Hilfsmittel im Managen eines Projektes einzusetzen. Die Komplexität eines Vorhabens mit der Fülle an Dokumenten kann am besten in Form einer systematischen EDV-Ablage bewältigt werden. Kostenberechnungen können leichter durch entsprechende Hilfsmittel durchgeführt und kontrolliert werden. Technik bleibt aber zweitrangig und ist Mittel zum Zweck. Jeder Projektleiter sollte die Fähigkeit besitzen, sich nicht von der Technik dominieren zu lassen. Sicherlich, man kann sich die Arbeit in einem Projekt auch nur unter total sachlichen Gesichtspunkten vorstellen – die Frage bliebe aber: Wollten wir in einem solchen Kontext arbeiten?
Inhalte
In Kapitel 1 geht es um das Anforderungsprofil an den Projektleiter: Was muss ich alles kennen und können, um meinen Job gut zu machen? Was sagen die großen Fachverbände APM Group, IPMA und PMI mit ihren verschiedenen Normenkatalogen und ihren Zertifizierungsrichtlinien? Welche Rolle spielt bei Ihnen die menschlich-zwischenmenschliche Komponente?
In Kapitel 2 geht es um die Beziehung des Projektes zu verschiedenen Projektbeteiligten. Wie gehe ich als Projektleiter mit den verschiedenen Interessensgruppen, die es rund um mein Projekt gibt, um? Wie gehe ich mit Kritikern um? Gilt es nur, sie zum Schweigen zu bringen, muss ich sie bekehren, manipulieren oder haben sie nicht auch berechtigte Interessen? Sind es letztlich nicht sie, die am Ende beurteilen, ob das Projekt gelungen ist?
In den Kapiteln 3–5 geht es um Teamplay, Führung und Konfliktmanagement. Was kann ich tun, damit die Projektmitarbeiter sich mit dem Projekt identifizieren, dass sie die Projektarbeit nicht nur als zusätzliche Last empfinden? Wie kann ich echten Teamgeist erzeugen statt falscher Teamideologie? Welche Rolle kommt hierbei insbesondere der Person des Projektleiters zu? Wie geht er am besten mit Konflikten und Krisen im Projekt um? Hier geht es nicht einfach um die Anwendung von irgendwelchen Führungsregeln, sondern um das bewusste Einbringen von Wertvorstellungen in die Führung des Teams. Wenn das Team mehr als eine Gruppe mit einer gemeinsamen Arbeitsaufgabe sein soll und der Projektleiter mehr als ein Arbeitsverwalter, dann braucht es eine tiefere Übereinstimmung unter den Beteiligten, die sich in einem gemeinsamen Werteverständnis ausdrückt.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit den klassischen Planungs- und Steuerungsthemen aus psychologischer Sicht: Wie motiviere ich und wie überwache ich am besten die Projektmitarbeiter? Dabei gilt es, die Motivation abzugrenzen gegenüber der Manipulation und die Überwachung gegenüber der bloßen Kontrolle. Auch hier geht es darum, den anderen mehr zu erfassen, besser zu verstehen „wie der andere tickt“, was seine wahren Bedürfnisse und Anliegen sind. Nur die Fähigkeit, die Weltsicht des Mitarbeiters in die Planung und Steuerung zu integrieren, wird zu einem effektiven Miteinander führen.
Kapitel 7 ist dem Transfer gewidmet: Zum einen dem Projektabschluss als Ende der Projektzusammenarbeit mit der Frage: Was braucht es, um ein gutes Projektende zu finden? Zum anderen dem Erlernen des Projektmanagements – gewissermaßen als abschließende Aufgabe.
Am Ende soll aber auch noch eine andere Sicht der Dinge ihren Platz finden: Ist der Erfolg wirklich nur vom Projektleiter und seiner Persönlichkeit abhängig? Nein, sicherlich nicht! Vielmehr bewegt sich der Projektleiter auch in einem konkreten Unternehmen, mit eigenen Regeln und Werten, Normen und Richtlinien, die seinen Weg beeinflussen. Letztlich ist dies die Unternehmenskultur, die es ihm ermöglicht, seine Fähigkeiten zu zeigen oder aber verhindert, dass er etwas erreicht.
Aktuelle Relevanz
Im Frühjahr 2009 veröffentlichte die International Project Management Association (IPMA®) die Überarbeitung ihrer Beschreibung über das Wissen und die Erfahrung, die man im Projektmanagement braucht (ICB 3.0). Diese neue Norm wurde im Frühjahr 2009 in Deutschland freigegeben. Gleichzeitig überarbeitete das amerikanische Project Management Institute (PMI®) ihre „Project Management Body of Knowledge“ (PMBOK® Guide). In beiden Veröffentlichungen, die quasi Normcharakter haben, spielt der Faktor Mensch eine wichtige Rolle.
Das Buch berücksichtigt neben den Anforderungen der PMI und der IPMA als dritte Größe die Anforderungen der APM Group mit PRINCE2™. Der Ansatz von PRINCE2 wurde ebenfalls im Sommer 2009 aktualisiert und erhält im Moment auch in Deutschland zunehmend Beachtung.
Das Thema Projektmanagement hat in den letzten Jahren eine enorme Nachfrage erlebt. Dies lässt sich gut an den immer weiter steigenden Zahlen zu Zertifizierungen für Projektpersonal ablesen. Ich suche bewusst den kritischen Dialog mit den Inhalten der Zertifizierungen, denn in den Prüfungen werden genau diese sozialen Themen ebenfalls abgefragt.
Das Thema „Faktor Mensch im Projekt“ wird in vielen Veröffentlichungen zu Projektmanagement behandelt. Häufig wird aber das Thema der sozialen Kompetenz verkürzt zu einem pragmatischen „wie macht man das“? Diese vereinfachenden Rezepturen sollen hier nicht widergegeben werden! Ich will eine Ebene tiefer gehen, grundsätzlicher werden und suche den Dialog mit Ihnen als Leser – ich stelle meine Thesen, die ich durch meine Tätigkeit als Trainer und Berater gesammelt habe, berichte von den Erfahrungen meiner Seminarteilnehmer und möchte Sie als Leser bitten, abzugleichen, ob Sie gleiche oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Daher ist das Buch gerade für Personen, die bereits Erfahrungen im Projektmanagement haben, von zusätzlichem Nutzen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!