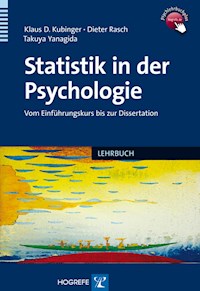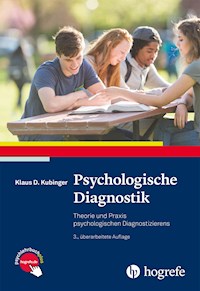
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Bachelorstudium Psychologie
- Sprache: Deutsch
Psychologische Diagnostik bezieht sich auf die psychologische Begutachtung von Personen bei unterschiedlichen Fragestellungen. Dieses Lehrbuch vermittelt die Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens, um Studierende der Psychologie auf ihre spätere Tätigkeit als fallbehandelnde Psychologinnen und Psychologen vorzubereiten. Das Lehrbuch behandelt zunächst die Gütekriterien, anhand derer psychologisch-diagnostische Verfahren hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit zu beurteilen sind, und klärt über den Einsatz solcher Verfahren auf und wie die mit ihnen gewonnenen Ergebnisse zu interpretieren sind. Zudem werden die bei einer Begutachtung wichtigen Aspekte der Gesprächsführung und Verhaltensbeobachtung erörtert. Breiter Raum wird der praktischen Abfassung psychologischer Gutachten gewidmet. Ein abschließendes Kapitel stellt die verschiedenen Themengebiete psychologisch-diagnostischer Fragestellungen anhand von Fallbeispielen vor. Verschiedene Übungen dienen dazu, die Inhalte zu vertiefen und kritisch zu reflektieren. Im Anhang finden sich ausführliche Darstellungen zu den testtheoretischen Grundlagen der Psychologischen Diagnostik und Beschreibungen einer Auswahl von psychologisch-diagnostischen Verfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus D. Kubinger
Psychologische Diagnostik
Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens
3., überarbeitete Auflage
Prof. Dr. Klaus D. Kubinger, geb. 1949. Studium der Psychologie und Statistik in Wien. 1973 Promotion. 1985 Habilitation. Gastprofessuren in Klagenfurt, Graz, Berlin und Potsdam. 1998-2012 Professor für Psychologische Diagnostik an der Universität Wien. Zahlreiche Lehraufträge an staatlichen und privaten Universitäten/Hochschulen. Klinischer und Gesundheitspsychologe sowie Psychotherapeut (Systemische Familientherapie).
Informationen und Zusatzmaterialien zu diesem Buch finden Sie unter www.hogrefe.de/buecher/lehrbuecher/psychlehrbuchplus
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock by Getty Images / FatCamera
Satz: Matthias Lenke, Weimar
Format: EPUB
3. Auflage 2019
© 2006, 2009 und 2019 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2779-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2779-0)
ISBN 978-3-8017-2779-6
http://doi.org/10.1026/02779-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
.
|V|Gewidmet Annalena und Konstantin
.
|VII|In Erinnerung an befreundete Kollegen:
Anton K. Formann, Jürgen Guthke, Peter Hampapa, Reinhold Hatzinger, Hans Müller, Walter Nährer, Jürgen Rost, Hartmann H. Scheiblechner
.
|IX|„No two people are exactly alike; everyone is unique. Even identical twins, who originate from the same fertilized egg and hence have identical heredities, differ in significant ways. This is true whether they are reared in the same or different environments. On the other hand, in certain respects everyone is similar to everyone else. Dispite differences in heredity, experiences, and culture, people share certain physical and mental qualities that distinguish them as human beings. Thus, we are both unique and similar, possessing a complex set of physical, mental, and behavioral characteristics that identify us as human and endow us with individual personalities.“
Aikin (1996, S. 3)
|XI|Vorwort zur 3. Auflage
Abgesehen von zwei Vorläufern (1995 und 1996) bei einem anderen Verlag und unter geringfügig anderem Titel erscheint nun das Lehrbuch Psychologische Diagnostik – Theorie und Praxis psychologischen Diagnostizierens nach 2006 und 2009 in dritter Auflage.
Waren die Vorworte der beiden letzten Auflagen noch geprägt durch universitätspolitische Betrachtungen bzw. durch Überlegungen zur berufs- und gesellschaftspolitischen Positionierung eines Bachelors für Psychologie (s. Kubinger, 2009a), so gelten die folgenden Ausführungen der Frage: Ist die psychologische Versorgung der Mitglieder unserer Gesellschaft (auch) für die Zukunft gesichert, indem Absolventen des Masterstudiums in Psychologie für die Praxis ausreichend vorgebildet werden?
Geänderte Studienpläne, wohl im Zusammenhang mit der Fokussierung universitärer Leistungen auf wissenschaftliche Erträge geben Anlass zur Besorgnis: Das Fach Psychologische Diagnostik als wesentliche Grundlage der praktischen Fallbehandlung wurde in letzter Zeit an etlichen Ausbildungsstätten drastisch gekürzt. Vor allem Seminare, die in die praktische Fallarbeit anhand realer Klienten einführen (s. z. B. Kubinger, 2005), werden kaum noch angeboten. Es scheint fast, als würden die Verantwortlichen vergessen haben, dass die Ausbildung an Universitäten primär der Berufsvorbildung dient ([deutsches] Hochschulrahmengesetz 1999, § 2 Abs. (1); [österreichisches] Universitätsgesetz 2002, § 3 Abs. 3.). Und damit ist sicher nicht gemeint, dass die meisten Studierenden zum Wissenschaftler vorgebildet werden – die wissenschaftliche Tätigkeit deckt nämlich nur ein relativ kleines Berufsfeld der Psychologie ab.
So kommt einem Lehrbuch für Psychologische Diagnostik mehr Bedeutung denn je zu. Im Idealfall ergänzt es die Lehre mit Materialien zum Selbststudium, um Studierende für die Praxis besser vorzubereiten. Weder die Zeit im Unterricht noch die geringe praxiserfahrene Qualifikation vieler Lehrender im Fach reicht nämlich dafür, Studierenden den Umgang mit Klienten in der Fallarbeit zu vermitteln. Immerhin geht es in der Praxis um die Fallbehandlung, d. h. um die psychologische Begutachtung von Personen bei verschiedensten Fragestellungen.
Daher werden in dieser 3. Auflage erstmals zahlreiche Fallbeispiele zitiert, mit deren Hilfe wenigstens stellvertretend Erfahrung in der Fallbehandlung gewonnen werden kann. Dann werden Übungen vorgeschlagen, die Studierende untereinander ohne Aufsicht durchführen können. Sie zielen insbesondere auf das angemessene Verhalten gegenüber Klienten ab. Schließlich findet sich regelmäßig |XII|eine „Reflexion für den fallbehandelnden Psychologen1“. Einerseits beruhen nämlich die theoretischen Ausführungen teilweise auf Idealen, die so in der Praxis nicht gegeben sind. Andererseits gehen die theoretischen Ausführungen traditionell zu wenig auf die praktischen Ansprüche ein.
Auch wird nunmehr besonders deutlich gemacht, dass das Fach Psychologische Diagnostik nicht auf die Konstruktion psychologischer Tests abzielt; dafür ist das Fach Testtheorie zuständig. In der Psychologischen Diagnostik geht es vielmehr um die Begutachtung in der Fallbehandlung. Mittelfristig ist demnach anzudenken, ein solches Lehrbuch, aber auch die entsprechenden Lehrveranstaltungen genau so zu benennen: „Psychologische Begutachtung“.
Wie aus dem Curriculum Vitae hervorgeht, entstammt der Verfasser einer Generation, die noch ein wenig der humanistischen Bildung anhängt – wenn auch gleichzeitig der so genannten 68er Generation. Ersteres hat zur Folge, dass in den letzten Auflagen laut einiger weniger Rückmeldungen die Sprache samt Satzaufbau des Lehrbuchs für manchen jungen Leser zu komplex war. Letzteres begründet heute beim Verfasser den Eindruck, dass junge Leser wieder viel konsequenter zum kritischen Reflektieren all dessen angeleitet werden müssen, was „gängige Meinung“ vielleicht bloß aus dem Selbstverständnis gewisser Autoritäten ist. So wurde nun einerseits versucht, ein hohes Leseverständnis mit eher kurzen Sätzen, einfachem Satzbau und gängigen Wörtern zu ermöglichen. Andererseits wird in vielen Ausführungen vorgelebt, wie alles an Richtlinien und Regeln hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Fundierung zu hinterfragen ist.
Kein Werk gelingt ohne Unterstützung des Verlags. Deshalb sei ganz herzlich Frau Dipl.-Psych. Susanne Weidinger gedankt, die diesmal mit ihrem Team für die Herstellung verantwortlich war.
Wien, im Juni 2019
Klaus D. Kubinger
P. S.: Redaktionsschluss aller Recherchen war der 1. 10. 2018.
Verlag und Autor haben sich redaktionell darüber geeinigt, bei üblicherweise von Personen beiderlei Geschlechts getragenen Funktionen immer nur die männliche Form im Sinne eines Gattungsbegriffs anzuführen. Wenn also in einem unpersönlichen Zusammenhang einfach über den Psychologen, den Untersuchenden, den Anwender, den psychologisch-diagnostischen Helfer oder den Klienten u. v. m. geschrieben wird, dann geschieht dies lediglich zur besseren Lesbarkeit des Textes.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
Kapitel 1 Einführung
1.1 Begriffsbestimmungen
1.2 Geschichte
1.3 Voraussetzungen
1.4 Gesellschaftspolitische Kritik
1.5 Rechtfertigung
1.6 Themen, Verfahren und Populationen
1.7 Grundsätze
Kapitel 2 Gütekriterien
2.1 Objektivität
2.1.1 Testleiterunabhängigkeit
2.1.2 Verrechnungssicherheit
2.1.3 Interpretationseindeutigkeit
2.2 Reliabilität
2.2.1 Messgenauigkeit laut Item-Response-Theorie
2.2.2 Messgenauigkeit laut Klassischer Testtheorie
2.3 Validität
2.3.1 Inhaltliche Gültigkeit
2.3.2 Kriteriumsvalidität
2.3.3 Konstruktvalidität
2.4 Eichung
2.4.1 Eichen im Sinn von Relativieren
2.4.2 Eichung im Sinn von Repräsentativerhebung
2.4.3 Kriteriumsorientierte Diagnostik
2.5 Skalierung
2.6 Ökonomie
2.6.1 Wirtschaftlichkeit und Aufwandsminimierung
2.6.2 Adaptives Testen
2.7 Nützlichkeit
2.8 Zumutbarkeit
2.9 Unverfälschbarkeit
2.10 Fairness
Kapitel 3 Formales
3.1 Gestaltungsweisen
3.1.1 Freies Antwortformat oder Multiple-Choice-Format
3.1.2 Power- oder Speed-and-Power-Test
3.1.3 Gruppen- oder Individualverfahren
3.1.4 Papier-Bleistift-Verfahren oder Computerverfahren
3.2 Erhebungstechniken
3.2.1 Prüfen
3.2.2 Fragen
3.2.3 Beobachten
3.3 Prozess-Strategien
3.3.1 Planungsstrategien
3.3.2 Untersuchungsstrategien
3.3.3 Entscheidungsstrategien
Kapitel 4 Inhalte
4.1 Leistungsdiagnostik
4.1.1 Intelligenz-Testbatterien
4.1.2 Spezielle Leistungstests
4.2 Persönlichkeitsdiagnostik
4.2.1 Faktorenanalytisch begründete Fragebogenbatterien
4.2.2 A-priori dimensionalisierte Fragebogenbatterien
4.2.3 Spezielle Persönlichkeitsfragebogen(-Batterien)
4.2.4 Objektive Persönlichkeitstests
4.2.5 Projektive Verfahren
4.3 Diagnostik „beidseitiger“ Eigenschaften
4.3.1 Kreativitätstests
4.3.2 Soziale Intelligenz-Tests
4.4 Biografie als mittelbare Diagnostik
Kapitel 5 Besondere Merkmalsträger
5.1 Gruppen und Teams
5.2 Arbeitsplätze
Kapitel 6 Gutachten
6.1 Allgemeine Regeln zur Gutachtenerstellung
6.2 Gestaltungsprinzipien im Detail
6.3 Häufige Fehler bei Gutachten der Praxis
6.4 Demonstrationsbeispiele psychologischer Gutachten
Kapitel 7 Themenbereiche psychologisch-diagnostischer Fragestellungen
7.1 Ausbildungs- und berufsbezogene Eignungsdiagnostik
7.2 Ausbildungs- und berufsbezogene Rehabilitationsdiagnostik
7.3 Entwicklungsdiagnostik im frühen Kindesalter
7.4 Forensisch-psychologische bzw. rechtspsychologische Diagnostik
7.5 Verkehrspsychologische Diagnostik
7.6 Klinische und gesundheitspsychologische Diagnostik
7.6.1 Klinisch-psychologische Diagnostik
7.6.2 Gesundheitspsychologische Diagnostik
7.6.3 Neuropsychologische Diagnostik
7.6.4 Gerontopsychologische Diagnostik
Nachwort
Literatur
Anhang
Testtheoretische Grundlagen der Psychologischen Diagnostik
Verfahrensbeschreibungen
Diagnostik-Info-Check ’19
Glossar
Verzeichnis der Verfahrensabkürzungen
Autorenverzeichnis
Sachregister
|1|Vorbemerkungen
Zum Unterschied von Psychologischer Diagnostik und Testtheorie
Viele Curricula des Fachs Psychologische Diagnostik sowie die meisten Lehrbücher dazu differenzieren zu wenig bis gar nicht zwischen diesem und einem anderen Fach, nämlich der (psychologischen) Testtheorie. Während sich die Psychologische Diagnostik mit den wissenschaftlichen Grundlagen des State-of-the-Art-Vorgehens bei der Fallbehandlung in der Praxis beschäftigt (s. die genaue Definition in Kap. 1), widmet sich die Testtheorie der mathematisch-statistisch fundierten Theorie des Messens psychischer Phänomene (daher auch: Psychometrie), also der Theorie der Konstruktion psychologisch-diagnostischer Verfahren. Das heißt, Psychologische Diagnostik betrifft die Arbeitswelt des (einzel-)fallbehandelnden Psychologen, Testtheorie die Arbeitswelt eines Verfahrenskonstrukteurs, also eines Psychologen der angewandten Forschung. Zweifellos brauchen beide Personenkreise auch tiefgehende Kenntnisse im Fach des jeweils anderen; und freilich baut Psychologische Diagnostik wesentlich auf der Testtheorie/Psychometrie auf. Die angesprochenen Curricula und Lehrbücher, die aber unter dem Titel „Psychologische Diagnostik“ fast ausschließlich Testtheorie bieten, müssen sich nun den Vorwurf des Etikettenschwindels gefallen lassen: Ein Psychologiestudium mit der Verantwortung, Berufsvorbildung zu leisten, darf nicht die Themen der Arbeitswelt des fallbehandelnden Psychologen vernachlässigen und sich nicht beinahe ausschließlich auf die Arbeitswelt des Verfahrenskontrukteurs beschränken.
Im vorliegenden Lehrbuch der Psychologischen Diagnostik geht es also explizit um das Vorbereiten des Studierenden auf die Arbeitswelt des fallbehandelnden Psychologen. Die dafür sicher auch nötigen, durchaus anspruchsvollen Kenntnisse der Testtheorie werden dabei eigentlich als bereits vorhanden vorausgesetzt. So gesehen könnte Studierenden, die über diese Kenntnisse doch noch nicht verfügen, einfach ein entsprechendes Lehrbuch empfohlen werden (z. B. Moosbrugger & Kelava, 2012). Praktikabler scheint es aber, allfällige Erinnerungslücken des Lesers zur Testtheorie gleich hier (in einem eigenen Anhang) zu stillen bzw. die von ihm gegebenenfalls noch immer nicht ausreichend reflektierten Inhalte entsprechend aufzuarbeiten. Allerdings werden dabei nur diejenigen Themen behandelt, welche mit dem Ziel eines sachbezogenen Verständnisses unbedingte Voraussetzung für die spätere praktische Tätigkeit der Fallbehandlung darstellen; und dies auch nur auf dem dafür ausreichenden mathematisch-statistischen Niveau. Als Ausbildung zum Verfahrenskonstrukteur reicht der Anhang: Testtheoretische Grundlagen der Psychologischen Diagnostik sicher nicht.
|2|Zum Unterschied von Bachelor und Master (Diplom)
Das Dreistufenmodell des so genannten Bologna-Prozesses verlangt insbesondere für das Fach Psychologische Diagnostik eine Differenzierung hinsichtlich Qualifikation und Tätigkeitsberechtigung der Absolventen. Dem muss auch das vorliegende Lehrbuch gerecht werden. Ohne die Entwicklung des Arbeitsmarktes, also die Nachfrage für Bachelors langfristig vorhersagen zu können, kristallisiert sich gegenwärtig heraus, dass diese gerade im Zusammenhang mit dem „Testen“ bestimmter Personengruppen gewisse einfache psychologische Tätigkeiten erbringen (dürfen). Absolventen eines Masterstudiums werden dagegen – wie schon früher die Diplom-Psychologen – die eigentliche psychologische Untersuchung insbesondere bei solchen Personengruppen eigenverantwortlich gestalten, bei denen mit dem Ergebnis der Untersuchung tiefgehende Konsequenzen verbunden sind; und zwar Konsequenzen, die entweder den persönlichen Lebensplan oder gesellschaftsrelevante Belange betreffen. Dementsprechend muss auch die universitäre Ausbildung differenziert erfolgen. Und doch ist Psychologische Diagnostik schwer zu teilen, nämlich nicht in ein Bis-hierher und ein Ab-hier. Also kann eine Differenzierung je nach Stufe des Studienabschlusses nur hinsichtlich eines unterschiedlichen Tiefgangs erfolgen, mit dem die Themen und Ziele des Fachs vermittelt werden. Daher muss auch ein Lehrbuch beide Abschlüsse gemeinsam ins Auge fassen. Bachelor-Studierende sollen, obwohl manches in der Ausbildung oberflächlich bleibt, die Chance haben, den Tiefgang zu ahnen bzw. sich in eine tiefergehende Reflexion der Probleme einzulassen. Immerhin können sie auf diese Weise genau erkennen, was die Inhalte und Themen des darauf aufbauenden Master-Studiengangs sind. Master-Studierende dagegen haben dann bereits ein Lehrbuch bei der Hand, in dem sie sich gut auskennen. – Gleichzeitig soll dieses Lehrbuch auch noch Höherqualifizierten dienen, nämlich Promoventen einerseits und solchen Psychologen andererseits, die ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf die Psychologischen Diagnostik (weiter) vertiefen wollen; dazu sind insbesondere Praktiker zu zählen, die am aktuellen Diskussionsstand des Fachs interessiert sind.
Die Struktur des vorliegenden Lehrbuchs sieht daher auch in die Tiefe gehende Ergänzungen vor, welche die kritische Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema anregen sollen. Das geschieht vor allem in Form einer „Bemerkung am Rand“ oder eines Beispiels „Zur Illustration“, aber auch in der Gestalt einer „Erläuterung“ zu einem bestimmten Begriff oder als „Exkurs“ dazu. Und selbst wenn die Ergänzung als „Wichtiger Hinweis“ bezeichnet wird, so ist dieser doch eher für die reflektierende Auseinandersetzung mit dem Fach gemeint. Gelegentlich werden einschlägige psychologische oder wissenschaftliche Begriffe verwendet, die dem Bachelor-Studierenden noch wenig geläufig sind; solche Begriffe sind beim ersten Auftreten mit einem Pfeil (→) versehen, was anzeigt, dass sie in einem eigenen Glossar am Ende des Buches genauer erklärt werden.
|3|Ganze Abschnitte des Lehrbuchs dienen Bachelor-Studierenden bloß zur (vorausschauenden) Ergänzung. Dies ergibt sich allein aus dem Umstand, dass nur Absolventen des Diplom- bzw. Master-Studiengangs Psychologie die Berufsbezeichnung „Psychologe“ rechtlich zusteht (s. Genaueres in Kap. 1.7Grundsätze). Das heißt, Bachelor-Studierende müssen nicht alle Qualitätsansprüche erfüllen, wie sie für Psychologen im Fach Psychologische Diagnostik gegeben sind (s. in Präsentation 0.1). Und insofern sind die entsprechenden Ausbildungsinhalte des Bachelor-Studiums von jenen des Masterstudiums genau abzugrenzen. Deshalb wird je (Unter-)Kapitel am Anfang in einem eigenen Kasten gegenübergestellt: „Unterschied im Bachelor- und Master-Studium“.
Präsentation 0.1:
Qualitätsansprüche für Psychologen im Fach Psychologische Diagnostik (mit Bezug auf Kubinger, 2005)
Umfassende Kenntnis über Konzepte und Regeln der Gesprächsführung in Bezug auf die „Sammlung aller typischerweise mit der gegebenen Problemsituation in Verbindung stehenden Informationen“ (s. in Kap. 3.2Erhebungstechniken).
Fertigkeit, umgangssprachlich formulierte Fragestellungen (Untersuchungsanlässe; Aufträge) mit Hilfe entscheidungsorientierter Gesprächsführung in psychologisch beantwortbare umzuformulieren (s. in Kap. 1.1Begriffsbestimmungen sowie Kap. 3.2.2).
Fertigkeit, je psychologisch-diagnostischer Fragestellung ein Anforderungsprofil auszuarbeiten (s. in Kap. 3.3.1).
Vertrautheit mit einem Katalog von Einflussgrößen, die mit dem Untersuchungsanlass typischerweise in Verbindung stehen, zum Zweck der diagnostischen Hypothesenbildung und -abklärung (s. in Kap. 3.2.2).
Detailkenntnisse von psychologisch-diagnostischen Verfahren (z. B. Tests) des Standardinventars der Psychologischen Diagnostik (s. im Anhang: Verfahrensbeschreibungen).
Qualifikation zur selbstständigen Einarbeitung in die Anwendung neuer bzw. spezieller psychologisch-diagnostischer Verfahren (s. im Anhang: Verfahrensbeschreibungen).
Beherrschung der wissenschaftlich fundierten Richtlinien bei der Beurteilung der Qualität psychologisch-diagnostischer Verfahren (s. in Kap. 2Gütekriterien).
Ansprechende Routine in der Anwendung psychologisch-diagnostischer Verfahren, insbesondere von Individualverfahren (s. in Kap. 3.1.3).
Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen psychologischen Diagnostizierens (z. B. ethische Richtlinien der Berufsverbände, Psychologengesetz – s. in Kap. 1.7Grundsätze; Datenschutz, allgemeine Grundlagen der Zivil- und Strafprozessordnung, Familienrecht).
|4|Kenntnis der besonderen Testbedingungen bei bestimmten Populationen (→ Populationen) (z. B. Mangel an „objektivem Aufgabenbewusstsein“ bei Kleinkindern, s. hierzu Kap. 4.1.2; Phänomen des Simulierens (→ Simulant), s. in Kap. 2.9Unverfälschbarkeit sowie Kap. 7.4Forensisch-psychologische bzw. rechtspsychologische Diagnostik).
Sachkundigkeit in der Darstellung von Ergebnissen einer psychologischen Untersuchung, insbesondere hinsichtlich der strikten Abgrenzung zu deren Interpretation (s. in Kap. 6.1Allgemeine Regeln zur Gutachtenerstellung).
Sachkundigkeit in der Interpretation von Ergebnissen einer psychologischen Untersuchung sowie in der Umsetzung als psychologisches Gutachten (z. B. Zusammenführung diverser Sachverhalte und Einzelergebnisse anhand einschlägiger psychologischer Theorien; Auflösen von vermeintlichen Widersprüchen in Teilergebnissen – s. in Kap. 6.1Allgemeine Regeln zur Gutachtenerstellung).
Kenntnis der psychohygienischen (→ psychohygienisch) Versorgungsinstitutionen samt deren Angebote in Bezug auf psychologische Behandlungsmöglichkeiten sowie grundlegende Kenntnis der Konzepte einschlägiger Psychotherapieschulen.
Kenntnis der Bildungsinstitutionen.
Kenntnis über Konzepte und Regeln in der Präsentation der Ergebnisse einer psychologischen Untersuchung (z. B. Überbringung von Katastrophennachrichten, s. in Kap. 5.1Gruppen und Teams).
Beherrschen eines adressatengemäßen Ausdrucksstils bei der Abfassung von psychologischen Gutachten (z. B. sachliche Umschreibung von Fachausdrücken; s. in Kap. 6.1Allgemeine Regeln zur Gutachtenerstellung).
Qualifikation zur Abfassung psychologischer Gutachten in einer Art und Weise, dass die gegebene Fragestellung eindeutig beantwortet wird, ein Maßnahmenvorschlag getroffen wird und die getroffenen Schlussfolgerungen für Fachkollegen nachvollziehbar sind (s. in Kap. 6.1Allgemeine Regeln zur Gutachtenerstellung).
Am Ende der meisten auf der zweiten Überschriftenebene nummerierten Unterkapitel findet sich auch eine „Reflexion für den fallbehandelnden Psychologen“. Hier geht es darum, die gemachten Ausführungen (nochmals) kritisch, explizit aus der Sicht der Praxis zu betrachten. Weil dabei öfters festgestellt werden muss, dass Masterstudierende bzw. unroutinierte Psychologen erst noch gewisse praktische Erfahrung sammeln sollten, werden dort auch entsprechende Übungsanleitungen gegeben. Sie sind für das Selbststudium gedacht. Allerdings wird dafür jeweils ein ähnlich vorgebildeter Studienkollege benötigt.
Anmerkung:Bei der Darstellung von Dezimalzahlen wird, wie im Englischen, ein Punkt anstatt eines Kommas verwendet und bei statistischen Kennzahlen, die nicht größer als eins werden können, keine Null vor dem Dezimalpunkt angegeben. Diese redaktionelle Entscheidung folgt den „Richtlinien zur Manuskriptgestaltung“ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie aus 2019 und entspricht nicht den Regeln der deutschen Sprache.
|5|Kapitel 1Einführung
|6|Am Anfang müssen verschiedene einschlägig gebräuchliche Bezeichnungen voneinander abgegrenzt werden. Es geht also um
❶ Begriffsbestimmungen.
Dabei interessiert insbesondere die Unterscheidung von Psychologischer Diagnostik1 und „klinisch-psychologischem Klassifizieren“. Auch die Begriffe Diagnose und Prognose müssen voneinander abgegrenzt werden. Schließlich sind Psychologische Diagnostik und psychologisches Diagnostizieren zu unterscheiden. Danach soll es um die
❷ Geschichte,
❸ Voraussetzungen,
❹ gesellschaftspolitische Kritik,
❺ Rechtfertigung,
❻ Themen, Verfahren und Populationen,
❼ Grundsätze
der Psychologischen Diagnostik gehen.
Unterschied im Bachelor- und Master-Studium:
Die ❶Begriffsbestimmungen (Kap. 1.1) sowie die ❸Voraussetzungen (Kap. 1.3) sind für Bachelor-Studierende wichtig, um in das Fach den Einstieg zu finden. Dafür ist außerdem das Kapitel ❼Grundsätze (Kap. 1.7) nötig, gerade weil die dort dargestellten Grundsätze in der gegebenen Form für Absolventen des Bachelor-Studiums nicht anzuwenden sind. Nur so können diese sich als psychologisch-diagnostisch Vorgebildete vom Psychologen abgrenzen bzw. können sie Psychologen als psychologisch-diagnostische Helfer sachdienlich unterstützen.
1.1 Begriffsbestimmungen
Wenn Psychologie als Wissenschaft das Erleben und Verhalten „des Menschen“ beschreiben und erklären will, dann geht es in der Teildisziplin Psychologische Diagnostik speziell um die Art und Weise dieses Beschreibens und Erklärens. Genauer betrachtet geht es um die Art und Weise der Feststellung von Unterschieden zwischen einer bestimmten konkreten Person und anderen, auch abstrakten, zum Beispiel (ideal-)typischen Personen. Während das Beschreiben oft auf Messen abzielt, impliziert das Erklären regelmäßig eine Entscheidung (über Maßnahmen).
Klingt „Messen“ in diesem Zusammenhang (noch) zu abstrakt, so kann (vorläufig) weniger technologisch, und sogar etwas umfassender, auch von „Erfassen“ |7|gesprochen werden. Tatsächlich werden in einer psychologischen Untersuchung (insbesondere beim Testen) jeweils interessierende psychische bzw. psychologische Phänomene (psychische Merkmale) „erfasst“.
Wichtiger Hinweis:
Je nach Menschenbild, also philosophisch-anthropologischer Ansicht, kann das „Psychische“ eines Menschen, also seine „Persönlichkeit“2, als grundsätzlich messbar aufgefasst werden oder, (lediglich) phänomenologisch-betrachtend, als erschließbar durch „mitmenschliche Begegnungen“ (zu Letzterem s. z. B. Wellek, 1959). Wichtig ist, dass sich beide Standpunkte ergänzen.
Dabei leugnet der erste Standpunkt, also der Zugang des Messens, keinesfalls die Einzigartigkeit eines jeden Menschen; und doch trachtet man dabei zweckorientiert, die Ähnlichkeit zu anderen Menschen zu quantifizieren. Um entsprechend schlüssige Interpretationen und Rückschlüsse anstellen zu können, bedarf es nun des Nachweises immer wieder zutreffender Zusammenhänge von Beobachtungen der Psychologen einerseits und interessierenden Konsequenzen andererseits. Solche Gesetzmäßigkeiten lassen sich aber nur unter entsprechender Abstraktion des erfassbaren Informationsgehalts ableiten; d. h., zugunsten definitorischer Festlegungen muss auf die Nutzung bestimmter Informationen verzichtet werden. Der Lohn ist die Aussicht auf wissenschaftlich fundierte Entscheidungen (Interventionen/Maßnahmenvorschläge), welche letztlich explizit in den einschlägigen Berufspflichten/-ordnungen verlangt werden (Genaueres zu den einschlägigen Berufspflichten/-ordnungen für Psychologen s. weiter unten).
Erläuterung zum Begriff„psychisches Merkmal“:
Obwohl in der Angewandten Statistik die Bezeichnung „Merkmal“ geläufig ist (und übrigens innerhalb der Psychologie oft unexakter Weise gleichgesetzt wird mit „Variable“ (→ Variable)), stellt die Bezeichnung psychisches Merkmal keinen verbindlichen Fachausdruck dar. Hier soll damit ein Oberbegriff gemeint sein von Eigenschaft (englisch: trait) einerseits und (Erlebens- bzw.) Verhaltensweise andererseits. Dabei kann als Eigenschaft einer Person vorläufig vereinfachend verstanden werden: die „Bereitschaft, auf eine funktional äquivalente Klasse von Situationen mit einer funktional äquivalenten Klasse von Reaktionen zu antworten.“ (Psychologie-Lexikon –Tewes & Wildgrube, 1999, S. 84 f.). Insbesondere beinhaltet der Begriff Eigenschaft auch (spezifische) kognitive3 (→ kognitiv) Fähigkeiten.
Aus der Klinischen Psychologie stammt der Begriff „Symptom“4 als solch ein besonderes psychisches Merkmal. Gemeint ist damit ursprünglich eine Erlebens- oder Verhaltensweise, die als Anzeichen einer Erkrankung bzw. einer Verletzung gilt; oft wird die Bezeichnung Symptom aber viel allgemeiner für jede auffällige Erlebens- oder Verhaltensweise verwendet, auch außerhalb der Klinischen Psychologie.
|8|Erläuterung zum Begriff„Fähigkeit“:
In sehr grober Anlehnung an Schaub und Zenke (2007) bzw. Böhm und Seichter (2017) kann zwischen den beiden Begriffen „Fähigkeit“ und „Fertigkeit“ wie folgt unterschieden werden:
Fähigkeit bezieht sich auf bestimmte (physische und) psychische Voraussetzungen, die es einem Menschen möglich machen, bestimmte (körperliche und) geistige Leistungen zu erbringen. Sie hängt von den genetischen Anlagen dieses Menschen ab, entwickelt sich aber auch je Umwelt.
Fertigkeit bezieht sich auf konkretes Können (Beherrschen von Handlungsweisen), welches in der Entwicklungsgeschichte eines Menschen gelernt wurde. Sie baut auf diversen Fähigkeiten auf.
Also: Das Beschreiben des Erlebens und Verhaltens einer Person gelingt mit Hilfe einer psychologischen Untersuchung, bei der bestimmte Merkmale erfasst bzw. gemessen werden. Das Erklären des Erlebens und Verhaltens der Person erfolgt auf Grund dieses Beschreibens; es kommt zu einer Entscheidung, die u. a. aus einer Diagnose besteht.
Das Prinzip des Erstellens jeder Diagnose ist dabei wissenschaftstheoretisch wie folgt untermauert: Zunächst wird eine Vielfalt von idiografischen5, also den Einzelfall betreffenden Hypothesen entwickelt, wie sie im Zusammenhang mit der konkret gegebenen Fragestellung denkbar sind. Dann werden Methoden bzw. Verfahren gesucht und eingesetzt, die ein Prüfen dieser Hypothesen ermöglichen. Schließlich dienen die der Überprüfung standgehaltenen und insofern nach Popper bewährten6 Hypothesen der Begründung der Diagnose bzw. genauer: machen die Diagnose aus (s. z. B. Westmeyer, 2003).
Also: Um gegen Ende eines ganzen Prozesses psychologischen Diagnostizierens zu einer Diagnose (über das Erleben und Verhalten einer konkreten Person) zu kommen, muss es am Beginn eine Fragestellung (das Erleben und Verhalten dieser Person betreffend) geben.
Die angesprochene Entscheidung beschränkt sich zumeist nicht auf die Diagnose in der Art eines Etiketts, d. h. nicht allein auf die Einordnung der untersuchten Person in eine bestimmte Kategorie (Klassifizieren) bzw. nicht auf die Zuschreibung irgendeines Attributs laut gebräuchlicher (psychologischer) Begrifflichkeit. Vielmehr beinhaltet die Entscheidung regelmäßig einen Maßnahmenvorschlag, oft verbunden mit einer Prognose7, die das künftige Erleben und Verhalten der betreffenden Person vorherzusagen versucht. Anders wird nämlich die gegebene Fragestellung nicht zu beantworten sein bzw. das dahinterstehende Problem nicht gelöst oder behandelt werden können.
|9|Zur Illustration:
Bezugnehmend auf die Fallbeispielsammlung von Kubinger und Ortner (2010) seien exemplarisch hier bereits folgende psychologisch-diagnostische Fragestellungen genannt (s. aber insbesondere auch in Kap. 7Themenbereiche psychologisch-diagnostischer Fragestellungen): „Besteht bei dem Kindergartenkind A. B. eine generelle bzw. spezielle Entwicklungsverzögerung im visumotorischen Bereich?“ (→ visumotorisch); „Ist bei den Kindeseltern C. & D. E. Erziehungsfähigkeit in Bezug auf ihre Kinder gegeben?“; „Besteht bei F. G. eine Lese- und Rechtschreibstörung?“; „Ist H. I. hochbegabt?“; „Verfügt J. K. über ausreichende Fähigkeiten für das Studium der Psychologie?“; „Welcher Kandidat ist am besten geeignet für die Stelle XY?“; „Ist der Antragstellerin auf Berufsunfähigkeitsrente, Frau L. M., Arbeitsunfähigkeit zu attestieren?“; „Wie lautet die Kriminalrückfallprognose des zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten N. O.?“; „Besteht bei Frau P. Q. ausreichende Bereitschaft zur Verkehrsanpassung in Bezug auf Alkoholkonsum und Autofahren?“.
Also: Psychologisches Diagnostizieren beinhaltet stets einen Maßnahmenvorschlag. Selbst wenn es am Ende nur zu einem Klassifizieren bzw. nur zur Zuschreibung irgendeines Attributs kommt, steht als Entscheidung wenigstens indirekt eine bestimmte Maßnahme im Raum. Maßnahmenvorschläge beziehen sich oft auf psychologische Interventionen8 aller Art, von Förder- und Rehabilitationsmaßnahmen (→ Rehabilitation) bis zu psychotherapeutischen Behandlungen.
Zur Illustration:
Hinsichtlich der oben gegebenen Fragestellung „Besteht bei F. G. eine Lese- und Rechtschreibstörung?“ findet sich in der angeführten Fallbeispielsammlung folgende Diagnose: „Aufgrund der insgesamt guten Begabung und der weit unterdurchschnittlichen Lese- und Rechtschreibleistung … wird eine Lese- und Rechtschreibstörung … diagnostiziert. Mangelnde Beschulung kann als Ursache der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ausgeschlossen werden; es liegen auch keine Hinweise auf eine neurologische oder psychiatrische Erkrankung vor.“ (Hirschmann & Koch, 2010, S. 138). Der entsprechende Maßnahmenvorschlag lautet auszugsweise: „Es empfiehlt sich eine Kombination aus professioneller und häuslicher Förderung der Rechtschreib- und Leseleistungen. Erstere sollte die funktionelle Behandlung des Lesens und Rechtschreibens in den Vordergrund stellen. Im Sinne einer Übungsbehandlung sollte sie ein bis zwei Mal wöchentlich im Einzelsetting stattfinden … Die Mutter ist in die Planung, Organisation und Durchführung der Fördermaßnahmen regelmäßig zu integrieren. Dies kann durch tägliche kurze Leseeinheiten sowie durch die Verwendung von Lernhilfen (Arbeitsblätter, Lernsoftware, Lernspiele) und einer Rechtschreibkartei zur Festigung von Regelwissen und zum verbesserten Aufbau eines Gedächtnisspeichers für Wortschreibung geschehen.“ (S. 139).
Zu ergänzen ist schließlich noch, dass abweichend von den bisherigen Ausführungen gelegentlich nicht eine einzelne Person, sondern eine zusammengehörige Gruppe von mindestens zwei Personen interessiert.
|10|All diese Betrachtungen führen zu folgenden zwei Definitionen:
Psychologisches Diagnostizieren ist ein Prozess, der unter Zuhilfenahme besonderer Verfahren zielgerichtete Informationen über die psychischen Merkmale von einem (oder mehreren) Menschen gewinnen will; dieser Prozess bezieht sich auf:
Klärung der Fragestellung,
Auswahl der einzusetzenden Verfahren,
Anwendung und Auswertung dieser Verfahren,
Interpretation und Gutachtenerstellung,
Festsetzen der Intervention (des Maßnahmenvorschlags).
Zur Illustration:
Jäger und Petermann (1995, S. 11) definieren psychologisches Diagnostizieren konkreter als „das systematische Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zu begründen, zu kontrollieren und zu optimieren. Solche Entscheidungen und Handlungen basieren auf einem komplexen Informationsverarbeitungsprozeß. In diesem Prozeß wird auf Regeln, Anleitungen, Algorithmen usw. zurückgegriffen. Man gewinnt damit psychologisch relevante Charakteristika von Merkmalsträgern und integriert gegebene Daten zu einem Urteil (Diagnose, Prognose). Als Merkmalsträger gelten Einzelpersonen, Personengruppen, Institutionen, Situationen, Gegenstände etc.“ – Übrigens wird damit vorweggenommen, dass potenziell nicht nur Menschen, sondern viel allgemeiner: Objekte verschiedenster Art (z. B. bestimmte Arbeitsplätze) in Betracht stehen; genauer wird darauf in Kapitel 5Besondere Merkmalsträger eingegangen.
Psychologische Diagnostik ist die wissenschaftliche Disziplin (Lehrfach), die psychologisches Diagnostizieren für die Praxis vorbereitet.
Was damit als Diagnostik bzw. Diagnostizieren definiert wurde, gilt in gewisser Weise generell, weit über die Psychologie hinaus; ersetzt man den Merkmalsträger „Mensch“ entsprechend, dann zum Beispiel auch für die Kfz-Reparatur. In der Psychologie gibt es zahlreiche Berührungspunkte mit der medizinischen Diagnostik und somit eine gewisse Verwechslungsmöglichkeit. Daher wird innerhalb der Psychologenschaft besser grundsätzlich das Attribut „psychologisch“ den Bezeichnungen Diagnostik und Diagnostizieren hinzugefügt.
Bemerkung am Rand:
Gelegentlich findet man in der Literatur auch noch die Bezeichnung „Psychodiagnostik“, welche – nach Einschätzung d. Verf. – aus der Tradition der DDR kommt. Dort gab es in Zeiten, in denen im westlichen deutschen Sprachraum psychologisches Diagnostizieren fast verpönt war, intensive Bemühungen um das Fach, was der Kultivierung dieser dort präferierten Bezeichnung förderlich gewesen sein mag.
Allerdings ist diese Bezeichnung den sogenannten Psycho-Tests einschlägiger Illustrierter assoziativ nicht mehr fern; „psychologisch“ auf „psycho“ verkürzt birgt also die Gefahr, den wissenschaftlichen Gehalt, den Psychologie hat, nicht mehr zu vermitteln.
|11|Mit der gegebenen Definition grenzt sich psychologisches Diagnostizieren eindeutig ab vom klinisch-psychologischen Klassifizieren, etwa gemäß ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen – Version 10; Dilling, Mombour & Schmidt, 2008) oder DSM-5® (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen – Version 5; American Psychiatric Association [dt. Hrsg.: Falkai & Wittchen], 2018). Ein solches Klassifizieren kann zwar Teil des diagnostischen Prozesses sein, nämlich innerhalb der Anwendung und Auswertung bestimmter Verfahren, alleiniges Ziel des diagnostischen Prozesses im hier gemeinten Sinn ist es nicht. Insofern wäre es angezeigt, in Zukunft gleich immer von (psychischer) Klassifikation und nicht von psychologischem Diagnostizieren zu sprechen, wenn eigentlich (bloß) das Klassifizieren gemeint ist.
Bemerkung am Rand:
Im Englischen gibt es den Begriff „psycho-diagnostics“ praktisch nicht, so dass der im Deutschen nunmehr als Klassifizieren akzentuierte Begriff „diagnostics“ (z. B. im „D“ von DSM) kaum mit dem hier gemeinten psychologischen Diagnostizieren verwechselt wird: Vielmehr spricht man dafür von psychological assessment9.
Bezugnehmend auf die bereits in den Vorbemerkungen getroffene Unterscheidung von Psychologischer Diagnostik und Testtheorie ist zu sagen, dass erstere selbstverständlich auf letzterer aufbaut. Ohne selbstständig psychologisch-diagnostische Verfahren konstruieren zu müssen, muss derjenige, der psychologisches Diagnostizieren in der Praxis betreibt, doch vermittels ausreichenden Wissens über Testtheorie bestimmte Fertigkeiten entwickeln, um die Eignung in Frage kommender Verfahren beurteilen und verantworten zu können. Die Existenz einschlägiger psychologischer Testverlage, die entsprechende Verfahren anbieten, erspart solche Fertigkeiten grundsätzlich nicht.
Bemerkung am Rand:
Die oftmalige Gleichsetzung von Psychologischer Diagnostik und Testtheorie sollte mittelfristig bei Sachunkundigen wohl am besten dadurch vermieden werden können, dass für das gegebene Fach prägnanter die Bezeichnung Psychologische Begutachtung gewählt wird; letztlich geht es darum, psychologisches Begutachten für die Praxis vorzubereiten. Damit wäre eben auch eine Entsprechung mit der englischen Terminologie gewonnen (vgl. weiter oben).
Bisher wurde schon öfter von (psychologisch-diagnostischen) Verfahren gesprochen, die laut Definition helfen sollen, zielgerichtete Informationen über psychische Merkmale eines Menschen zu gewinnen. Umgangssprachlich werden solche Verfahren zumeist vereinfachend als „Tests“ bezeichnet. Obwohl psychologische |12|Tests10 letztlich nur eine besondere Untergruppe von psychologisch-diagnostischen Verfahren darstellen, genügt es in den ersten beiden Kapiteln dieses Buchs doch, zunächst von einer sehr umfassenden Begriffsauslegung der Bezeichnung Test auszugehen.
Dementsprechend definiert Gustav A. Lienert11 (in der letzten Auflage: Lienert & Raatz, 1998, S. 1) sehr allgemein: „Ein Test ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung.“ – Entgegen der oft praktizierten Differenzierung in Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik verwendet Lienert (wie manche andere) den Begriff „Persönlichkeit“ für die Menge aller psychischen Merkmale eines Menschen. So sehr nun das Attribut „wissenschaftlich“ wesentlich und die Qualifikation als „Routineverfahren“ im Sinn von: für jeden (Berechtigten) anwendbar, kennzeichnend ist, so sehr bedarf diese Definition noch einiger Präzisierungen. Erstens fehlt der Bezug zur Experimentellen Psychologie, wobei diesbezüglich die systematische Variation der Bedingungen kraft willkürlichen Eingriffs (Manipulation) des Experimentators relevant ist; aber auch die standardisierten Untersuchungsbedingungen, um mögliche Störeffekte auszuschalten. Zweitens strebt die moderne Psychologische Diagnostik eher ein- als mehrdimensionale Merkmalsmessungen an – was nicht ausschließt, mehrere Tests zur Messung mehrerer Merkmale einzusetzen. Drittens ist nicht immer nur der relative Grad, sondern oft auch der absolute Grad einer individuellen Merkmalsausprägung gefragt. Viertens fehlt die Offenlegung, dass psychologisch-diagnostische Verfahren stets nur eine Verhaltensstichprobe erfassen.
Erläuterung zum Begriff „Experiment“ und zur Experimentellen Psychologie:
Heutzutage ist innerhalb der Psychologie ein „Experiment“ zumeist als Methode zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung im Sinne des Statistikers Ronald A. Fisher gemeint, und zwar in der Gegenüberstellung zu einer (schlichten) „Erhebung“ (s. Kubinger, Rasch & Yanagida, 2011); infolge der bei Experimenten unab|13|dingbaren „Randomisierung“, also der zufälligen Zuordnung der Untersuchungsobjekte zu verschiedenen Bedingungen, gelingt eine Ursachenzuschreibung, d. h. die Feststellung kausaler Zusammenhänge. Im Gegensatz dazu macht sich die Experimentelle Psychologie traditionell das physikalische Experiment zum Vorbild: „Experiment nennt man eine Beobachtung, deren Gegenstand ein … planmäßig gestaltetes Geschehen ist; man denke z. B. an Pendelversuche, bei denen die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von den verschiedenen Bedingungen (Pendelgewicht, Schwingungsbreite, Pendellänge) festgestellt werden soll.“ (Pauli, 1919, S. 5). So fehlt auch in der für die Psychologie klassischen Definition von Wilhelm Wundt die Randomisierung: „Nach Wundt (1913) muss ein Experiment folgende Bedingungen erfüllen: 1. Es muss ein willkürlicher Eingriff auf die Entstehung und den Verlauf der zu beobachtenden Erscheinungen erfolgen (Willkürlichkeitsbedingung). 2. Die untersuchten Vorgänge müssen variierbar sein (Variierbarkeitsbedingung). 3. Die experimentelle Prozedur muss wiederholbar sein (Wiederholbarkeitsbedingung).“ (Aus dem Psychologie-Lexikon; Tewes & Wildgrube, 1999, S. 117). Psychologische Diagnostik mit ihrer über 100-jährigen Geschichte basiert auf letzterem Verständnis.
So gesehen ist folgende weitere Definition zu geben:
Ein psychologisch-diagnostisches Verfahren (vereinfacht oft „Test“ genannt) erhebt unter standardisierten Bedingungen eine Informationsstichprobe über einen (oder mehrere) Menschen, indem systematisch erstellte Fragen/Aufgaben interessierende Verhaltensweisen oder psychische Vorgänge auslösen; Ziel ist es, die fragliche Merkmalsausprägung zu bestimmen.
Bemerkung am Rand:
Die Orientierung psychologisch-diagnostischer Verfahren an der Experimentellen Psychologie mag der Grund sein, warum vor allem Studierende die Personen, die psychologisch diagnostiziert werden, als „Versuchspersonen“ bezeichnen. Diese Bezeichnung ist kritisch zu sehen, weil die betreffenden Personen eben nicht an einem Experiment (Versuch) teilnehmen. Immerhin ist zu hoffen, dass der Psychologe schon weiß, dass das jeweilige psychologisch-diagnostische Verfahren in der gegebenen Situation wissenschaftlich begründet ergiebig ist, er also nichts mehr versucht. Ähnlich ist es mit der Bezeichnung „Proband“, welche in der Psychologie zumeist als Synonym zu Versuchsperson gebräuchlich ist, obwohl „probare“, aus dem Lateinischen, „prüfen“ heißt, Proband also „Prüfling“.
Oftmals wird die Bezeichnung Proband auch gewählt, um – wie bei pharmazeutischen Studien (Prüfungen) zur Unterscheidung von Patient üblich – damit auszudrücken, dass die entsprechende psychologische Untersuchung gar nicht angezeigt war, sondern freiwillige Personen (Volunteers12) zum Beispiel zum Zweck einer Testeichung (s. in Kap. 2.4Eichung) herangezogen wurden; tatsächlich ist aber in „Proband“ etymologisch keinesfalls die Freiwilligkeit enthalten.
|14|Im vorliegenden Buch werden Personen, die mit psychologisch-diagnostischen Verfahren untersucht werden, als Testpersonen bezeichnet, obwohl dies erst recht den Test oder das Testen in den Vordergrund rückt. Da das Testen nur vermeintlich das Wichtigste beim psychologischen Diagnostizieren darstellt, ist auch der Gebrauch dieser Bezeichnung nicht sachlich zwingend, bestenfalls Tradition. Selbstverständlich sind Bezeichnungen wie Klient, Patient, Bewerber oder Kandidat gelegentlich angebracht. Passend, wenn auch wenig geläufig, ist die Bezeichnung „der/die zu Untersuchende“, wie ihn Westhoff (2005) präferiert. Analog wird im vorliegenden Buch vom Testleiter gesprochen. Die denkbare Alternative, die Person, die psychologisch-diagnostische Verfahren einsetzt, gleich als Psychologe zu bezeichnen, schließt sich deshalb aus, weil oft genug auch psychologisch entsprechend eingeschulte Helfer bestimmte solche Verfahren administrieren (dürfen).
Interessant ist diese Diskussion auch in der englischsprachigen Literatur: Während subject (Versuchsperson) innerhalb der Psychologischen Diagnostik durchgehend unüblich ist, bestehen Herausgeber von Fachzeitschriften häufig auf examinee (und examinator) und lehnen die eher neutrale Bezeichnung testee strikt ab, obwohl „Prüfling“ in Form von examinee alles andere als wertschätzend ist. Und während test administrator unmittelbar passend scheint, bestehen manche der angesprochenen Herausgeber auf assessor (vgl. Fußnote 9).
Bemerkung am Rand:
Häufig wird unsinnigerweise von „Testverfahren“ gesprochen, was einen Pleonasmus darstellt: Ein Test ist schon für sich genommen ein Verfahren (s. z. B. Sick, 2007), wie eben auch in Lienerts Definition explizit so formuliert (vgl. weiter oben).
Selbst bei umfassender Begriffsauslegung der Bezeichnung Test (viele subsumieren darunter zum Beispiel Persönlichkeitsfragebogen und bezeichnen sie gar als „Persönlichkeitstests“; s. dazu Genaueres vor allem in Kap. 4.2Persönlichkeitsdiagnostik) läuft man Gefahr, andere psychologisch-diagnostische Verfahren dabei zu übersehen. Es sind dies zunächst
Anamneseerhebung und Exploration,
Verhaltensbeobachtung.
Während, vorläufig und ganz allgemein beschrieben, Exploration13 als das Erkunden bestimmter Sachverhalte und subjektiver Betrachtungen mittels qualifizierter Gesprächsführung bezeichnet werden kann, bezieht sich die Anamneseerhebung14 speziell auf das Erfragen der Kranken-, besser: der Vorgeschichte, der untersuchten Person. Die (systematische) Verhaltensbeobachtung zielt auf einen persönlichkeitsbezogenen Informationsgewinn über die untersuchte Person ab, und zwar durch das Wahrnehmen ihrer Aktionen oder Reaktionen.
|15|Sodann sind zu den psychologisch-diagnostischen Verfahren zu zählen
Biografisches Inventar,
Assessment-Center,
Arbeitsplatzanalyse.
Wieder vorläufig und recht allgemein beschrieben fragt ein Biografisches Inventar nach solchen grundsätzlich überprüfbaren Informationen aus der Lebensgeschichte einer untersuchten Person, die einen Einblick in deren (leistungsbezogene) Zukunft versprechen. Das heute hinlänglich auch schon in der Öffentlichkeit bekannte Assessment-Center erfasst die Qualität der Bewältigungsversuche einer Person bei vorgegebenen berufsrelevanten Anforderungen. Die Arbeitsplatzanalyse als psychologisch-diagnostisches Verfahren untersucht diejenigen psychologischen Bedingungen und psychischen Voraussetzungen, welche eine bestimmte berufsbezogene Tätigkeit an den Menschen stellt.
Zusammenfassung
Die Arbeitswelt des (einzel-)fallbehandelnden Psychologen bezieht sich regelmäßig auf die Begutachtung einer (oder mehrerer) Personen bei gegebener Fragestellung.
Die wissenschaftliche Disziplin Psychologische Diagnostik beschafft dazu die für die Praxis des psychologischen Diagnostizierens erforderlichen theoretischen Erkenntnisse.
Psychologisches Diagnostizieren erfolgt über eine psychologische Untersuchung mit Hilfe geeigneter psychologisch-diagnostischer Verfahren.
Solche Verfahren erfassen bzw. messen verschiedene psychische Merkmale.
Die Ergebnisse der eingesetzten psychologisch-diagnostischen Verfahren führen zu einer Entscheidung, welche eine Diagnose enthält; regelmäßig beinhaltet die Entscheidung auch einen Maßnahmenvorschlag, oft verbunden mit einer Prognose.
1.2 Geschichte
Bereits die Anfänge der Psychologischen Diagnostik orientierten sich an der Experimentellen Psychologie. Für die erste Phase innerhalb dieser Anfänge ist es charakteristisch, dass Sinnesfunktionen untersucht wurden (Schwellenmessungen im optischen, akustischen, taktilen15 Wahrnehmungsbereich) oder Reaktionszeitmessungen erfolgten; mit dieser Phase fest verbunden sind die Namen Francis Galton (1822 – 1911) und James McKeen Cattell (1860 – 1944). Später, und hier ist vor allem |16|der Name Emil Kraepelin (1856 – 1926) zu nennen, wurden auch komplexere Anforderungen, wie Rechenaufgaben, aber auch zum Beispiel bestimmte Problemlöseaufgaben, Gedächtnisaufgaben oder psychomotorische Aufgaben (etwa fortlaufendes Tippen) an die getestete Person gestellt; Anforderungen, die sich bis heute gehalten haben.
Was die Intelligenzdiagnostik16 betrifft, gingen entscheidende Impulse von Alfred Binet (1857 – 1911) aus. Gemeinsam mit Theodore Simon entwickelte er 1905 einen Test, der aus 30 im Schwierigkeitsgrad abgestufte Aufgaben bestand. Er war an 50 „normalen“ und 30 „schwachsinnigen“ Kindern mit der Zielsetzung geeicht, in Zukunft damit als minderbegabt identifizierte Kinder an Spezialschulen zu verweisen.
Zur Illustration:
Im so genannten Binet-Simon-Test waren zum Beispiel für 8-Jährige Aufgaben enthalten, wie folgende:
Das Kind kann den Unterschied zwischen zwei bestimmten Gegenständen aus dem Gedächtnis erklären;
es kann rückwärts von 20 bis 0 zählen;
es bemerkt Auslassungen in einem unvollständigen Bild;
es kennt das Datum des Tages der Untersuchung;
es spricht fünf vorgesagte Zahlen nach.
Für diese Aufgaben wurde festgestellt, dass sie jeweils 60 bis 90 % der 8-Jährigen lösen. Löst daher ein bestimmtes 8-jähriges Kind dementsprechend viele Aufgaben, so ist ihm nach Binet dasselbe „Intelligenzalter“ wie sein Lebensalter zuzuschreiben; andernfalls über- oder unterschreitet sein „Intelligenzalter“ das Lebensalter entsprechend.
Bis heute sind die empirisch begründeten Erkenntnisse von Louis L. Thurstone (1887 – 1955) bedeutend; auch das Testkonzept von David Wechsler (1896 – 1981).
Thurstone hat (bis auf das Jahr 1931 zurückgehend) mit Hilfe eigens entwickelter statistischer Methoden die berühmten „Primary mental Abilities“ etabliert: Verbal Comprehension, Word Fluency, Number, Space, Memory, Perceptual Speed und Reasoning (schlussfolgerndes Denken). Diese, voneinander unabhängigen Fähigkeiten werden für intelligentes Verhalten verantwortlich gemacht, und zwar je nach Leistungsanforderung in spezifisch kombinierter Wirksamkeit. Daran orientieren sich noch immer einige aktuelle Intelligenztests.
Wechsler (beginnend 1944) wählte einen pragmatischen17 Standpunkt bei der Entwicklung von Intelligenztests. Sämtliche seiner Intelligenztests, sowohl was die |17|Zielgruppe (Kinder oder Erwachsene) betrifft als auch was die in verschiedene Sprachen übertragenen Versionen betrifft, zielen darauf ab, möglichst viele spezifische Fähigkeiten zu erfassen, um damit zu einem genauen Maß der globalen („intellektuellen“) Fähigkeit einer Person zu gelangen. Dabei wurde weniger Wert auf Vollständigkeit bzw. Ausgewogenheit der geprüften Fähigkeiten gelegt als vielmehr darauf, möglichst viele verschiedene Aufgabenstellungen zu berücksichtigen – sofern sie den (damaligen) theoretischen Ansprüchen genügten.
Bemerkung am Rand:
Dessen ungeachtet versuchen die meisten jüngst publizierten Intelligenztests bzw. Versionen auch einen Bezug zur gegenwärtig weitläufig akzeptierten Cattell-Horn-Carroll(CHC)-Theorie (s. z. B. Schneider & McGrew, 2012) herzustellen.
Im Gegensatz zu der damit angesprochenen Leistungsdiagnostik finden sich in der Geschichte zur Persönlichkeitsdiagnostik zwar ebenfalls bald die Namen Galton, Kraepelin und auch Binet: Ersterer versuchte Emotionen mittels Herzschlag und Pulsfrequenz zu messen. Er gebrauchte auch die Methode der Verhaltensbeobachtung von Personen und verwendete, genauso wie etwas später Kraepelin sowie Carl G. Jung (1857 – 1961), die „Assoziationstechnik“ zur Persönlichkeitserfassung – auf das jeweils vom Testleiter gebotene Wort soll die untersuchte Person mit dem ihr als erstes einfallenden (anderen) Wort reagieren. Vor allem Kraepelins Beobachtungen und Beschreibungen von psychopathologisch Erkrankten (früher: „Geisteskranken“) waren die Grundlage für das 1943 in den USA entwickelte und weltweit noch immer eingesetzte Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Binet widmete sich noch vor dem oben skizzierten Intelligenztest der Persönlichkeitsuntersuchung berühmter Personen und ließ diese Phantasiegeschichten zu Bildern erzählen, Deutungen von Tintenklecksen geben bzw. analysierte deren Handschriften.
Und doch ist es Raymond B. Cattell (1905 – 1998), der mit Hilfe erster faktorenanalytischer Methoden (1949) nicht nur eines der bekanntesten und über viele Jahrzehnte weltweit eingesetztes psychologisch-diagnostischen Verfahren entwickelte (Sixteen Personality Factors Questionnaire – 16 PF), sondern damit auch das Vorbild für andere Persönlichkeitsfragebogen schuf: Ähnlich wie Thurstone versuchte er, voneinander unabhängige Eigenschaften zu entdecken, um die Vielfalt von Persönlichkeiten durch alle möglichen Kombinationen der Ausprägungsgrade in diesen Eigenschaften zu erklären.
Die Gegenwart der Psychologischen Diagnostik ist durch Folgendes geprägt: Erstens durch neue, innovative Verfahrenskonzepte, welche erst der Einsatz von Computern ermöglicht (s. dazu insbesondere die Methode des Adaptiven Testens in Kap. 2.6.2, die Messung der intellektuellen Lernfähigkeit in Kap. 4.1.2 und das |18|Konzept einer experimentalpsychologischen Verhaltensdiagnostik in Kap. 4.2.4)18. Zweitens durch die gesellschaftspolitische Trendwende, nämlich den Menschen in seiner Rolle als zu begutachtende Person samt seinen Bedürfnissen würdevoll zu beachten, d. h. eher partnerschaftlich und primär unterstützend zu begegnen (s. dazu die beiden Gütekriterien Zumutbarkeit und Fairness in Kap. 2Gütekriterien, aber vor allem den Anspruch auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit des diagnostischen Prozesses in Kap. 6Gutachten). Drittens durch die Einsicht, dass bisher nicht gesehene oder unkritisch bewertete Probleme psychologischen Diagnostizierens zu ihrer Lösung endlich einer systematischen Grundlagenforschung bedürfen (s. dazu z. B. das Antwortverhalten bei Persönlichkeitsfragebogen in Richtung eigenen persönlichen Vorteil der untersuchten Person in Kap. 2.9Unverfälschbarkeit oder den Rateeffekt bei Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in Kap. 3.1.1). Viertens durch den gegebenen Zeitgeist, ausreichende Informationen mit möglichst geringem Zeitaufwand zu erlangen (s. dazu wieder die Methode des Adaptiven Testens in Kap. 2.6.2 sowie die Idee des „multifunktionalen Testens“ in Kap. 4.2.4).
1.3 Voraussetzungen
Als ein wesentliches Konzept der Psychologischen Diagnostik wurde bereits die Idee des Experiments genannt. Darüber hinaus besteht der sachliche Ausgangspunkt psychologischen Diagnostizierens aber noch aus bestimmten Voraussetzungen bzw. Vorstellungen über den Zusammenhang von Verhalten und Eigenschaft.
Grundsätzlich ist nämlich zwischen tatsächlichem Verhalten und der „Verhaltensdisposition“ einer Person strikt zu unterscheiden. Dabei ist unter Verhaltensdisposition gerade das präziser zu verstehen, was bisher ziemlich abstrakt als Eigenschaft bezeichnet wurde: Bestimmte, einer Person letztlich zuzuschreibende, aber |19|eben nicht direkt beobachtbare Eigenschaften machen – vor allem unter gewissen Bedingungen – bestimmte Verhaltensweisen (Handlungen) mehr oder weniger wahrscheinlich; es besteht eine Disposition, eine „Anlage“ dazu, gerade diese Verhaltensweisen tatsächlich zu realisieren. Andere Eigenschaften machen dieselben Verhaltensweisen mehr oder weniger unwahrscheinlich. Eine Person, zum Beispiel, mit herausragender Fähigkeit im schlussfolgernden, logischen Denken als eine ihrer Eigenschaften, wird sich in (logisch lösbaren) Problemsituationen vermutlich bewähren, d. h. mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Verhalten zeigen bzw. Handlungen setzen, als Folge davon es zur Lösung kommt. Dennoch können andere ([un-]bekannte) Größen aller Art dieses Verhalten, diese Handlungen auch (gelegentlich) verhindern. Daraus folgt: Mittels psychologischen Diagnostizierens sind schwerlich konkrete Handlungen vorauszusagen, bestenfalls die grundsätzliche Disposition dazu. Übrigens spricht man dementsprechend besser von „latenten“19Eigenschaften, weil sie sich eben nur mittelbar, über (typische) Verhaltensweisen manifestieren.
Selbst Eigenschaften müssen nicht stabil sein. Im Gegenteil, Ansätze wie kognitive Rehabilitationsprogramme oder gar die Psychotherapie implizieren die Möglichkeit der Veränderung aufs Eindrucksvollste. Es ist daher genau zu unterscheiden, ob es sich um eine Eigenschaft handelt, die sich erfahrungsgemäß bloß in Folge gravierender Life-Events entscheidend verändert (z. B. die Intelligenz; s. z. B. Deary, 2014), oder um eine Eigenschaft, die einem vielfältigen, entwicklungspsychologischen Wandel – auch ohne belastende Life-Events – ausgesetzt ist (z. B. die Interessen; s. Buse, 1996).
Erläuterung zum Begriff„Life-Event“:
Wortwörtlich übersetzt aus dem Englischen handelt es sich dabei um ein Lebensereignis. In sozialwissenschaftlicher Anwendung sind darunter allerdings nur wichtige, ins Leben nachhaltig eingreifende Ereignisse gemeint; zum Beispiel das Eingehen von partnerschaftlichen Beziehungen oder deren Trennung, Hinzukommen neuer Familienmitglieder oder deren Verlust, aber auch Wohnungswechsel oder gar Verlagerung des Lebensmittelpunkts – u. v. m.
Neben anderen Eigenschaften als ([un-]bekannte) Größen, welche die zu erwartenden Handlungen verhindern – zum Beispiel die mit der oben genannten Fähigkeit konkurrierende Eigenschaft mangelhafter Leistungsmotivation der Person –, ist unter solchen Größen vor allem mit verschiedensten Situationseinflüssen zu rechnen. Daraus ergibt sich die grundsätzliche Herausforderung der Psychologischen Diagnostik: Um aus der gewonnenen Verhaltensstichprobe (situationsüberdauernde) Eigenschaften einer Person abzuleiten – die ihrerseits die Vorhersage künftigen Handelns erlauben sollen –, muss immer erst der Nachweis der Repräsentativität (→ Repräsentativität) dieser Stichprobe erbracht werden, bevor Prognosen zu verantworten sind.
|20|Die Grundidee der Psychologischen Diagnostik kann somit wie folgt skizziert werden:
Angelehnt an die experimentelle Idee des systematischen Manipulierens geht es in der Psychologischen Diagnostik darum, bei der untersuchten Person Verhalten (Reaktionen, gelegentlich auch Aktionen) zu provozieren. Dieses provozierte Verhalten stellt eine Verhaltensstichprobe der Menge aller (gegenwärtig möglichen) Verhaltensweisen der Person dar und wird als das Produkt der eigentlich interessierenden, aber latenten Eigenschaft (Verhaltensdisposition) dieser Person aufgefasst bzw. als ein Ergebnis, das durch diese Eigenschaft (mit-)verursacht wurde. Mittels Umkehrschluss folgt, dass diese Person die interessierende Eigenschaft zu einem bestimmten Ausprägungsgrad haben muss, weil sie eben genau das konkrete Verhalten gezeigt hat. Mit je nach dem unterschiedlich stark eingeschränkter Sicherheit kann schließlich eine Prognose über das typische Verhalten dieser Person in der Zukunft gegeben werden.
Bemerkung am Rand:
Manchenorts werden verschiedene Orientierungen psychologischen Diagnostizieren gegenübergestellt (s. z. B. Schuler & Höft, 2001): Der „Eigenschaftsansatz“ zielt dabei auf die Erfassung von relativ stabilen Eigenschaften ab. Der „Simulationsansatz“ konzentriert sich demgegenüber auf das Verhalten als solches, und zwar beobachtet in realitätsnah konstruierten Situationen (s. dazu insbesondere die Computer-Simulationen in Kap. 3.1.4, aber auch das in Kap. 3.2.3 näher beschriebene Assessment-Center). Und der „biografische Ansatz“ interessiert sich für lebensgeschichtliche Fakten. Die oben kurz gefasste Grundidee der Psychologischen Diagnostik betont dagegen das Wechselspiel von Verhalten und Eigenschaft. Nur selten genügt es danach, Verhalten unsystematisch und punktuell zu beobachten, um späteres Verhalten in ziemlich den gleichen Situationen vorherzusagen. Dagegen stellen die beim biografischen Ansatz zumeist mittels Biografischen Inventars zu erhebenden Fakten – die sich ihrerseits auf (allerdings auch früheres) Verhalten beziehen – insofern eine Ergänzung zur oben kurz gefassten Grundidee der Psychologischen Diagnostik dar, als mit ihnen ebenfalls versucht wird, das typische Verhalten einer Person für die Zukunft zu prognostizieren.
Zweierlei Einstellungen sind in der Öffentlichkeit anzutreffen, die entweder die faktischen Möglichkeiten oder die faktischen Grenzen psychologischen Diagnostizierens überschätzen: Einerseits die laienhafte „Gläubigkeit“ an die Psychologische Diagnostik und andererseits die unsachliche Disqualifikation ihrer Relevanz als eine entscheidungsbegründende psychohygienische Methode.
Eine typische Fehleinschätzung von Laien betrifft die Verbindlichkeit eines Testergebnisses für eine Prognose über einen sehr weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt. Aus dem vorhin Gesagten sind nämlich Prognosen definitionsgemäß immer kritisch; erst recht für die sehr ferne Zukunft. Eine andere typische Fehleinschätzung von Laien betrifft die „Ehrfurcht“, Psychologen könnten mit ihren Verfahren alle Intimitäten einer Person erkennen. Abgesehen davon, dass manche Eigenschaften einer Person je Fragestellung gar nicht interessieren, ist beim psychologi|21|schen Diagnostizieren nämlich regelmäßig die Bereitschaft der untersuchten Person nötig, sich typisch zu verhalten.
Zur Illustration:
„Wer als Psychologe oder Psychologin kennt nicht die beiden Reaktions-Stereotypien von Laien auf die Mitteilung, ihr – typischerweise in privater Gesellschaft zufällig(?) gefundener – Gesprächspartner ist vom Fach (Psychologie)? ,Aha‘ vs. ,Oje‘! Der ersten Reaktion, also ,aha‘, sei hier einmal die (neugierige) Erwartung unterstellt, (endlich) über die eigene Persönlichkeit aufgeklärt zu werden, über sie bzw. die eigenen Schwierigkeiten Klarheit zu erlangen, indem dieser Gesprächspartner einen selbst ziemlich schnell, und das bloß im belanglosen Gespräch, ,durchschaue‘. Und der zweiten Reaktion, also ,oje‘, sei hier einmal unterstellt, sie rührt von der Erwartung, die eigene psychische Unzulänglichkeit, die intimen Geheimnisse würden dem Gegenüber völlig transparent werden, so bald dieser einen selbst mit den Blicken (und im Gespräch) erforscht. … Wenn der Psychologie schon im privaten, kurzen Kontakt derart ,allmächtige Qualitäten‘ zugeschrieben werden, wie erst müßte, diesen Erwartungen gemäß, das ,Durchschauen‘ und ,Erforschen‘ der Persönlichkeit mittels psychologischer Tests gelingen?“ (Kubinger, 1997a, S. 21).
An Skepsis bzw. Vorurteilen gegenüber der Psychologischen Diagnostik wird von Laien vorgebracht (s. Kubinger, 1997a): Zweifel an den Theorien der Psychologie, Zweifel an der Qualität der Tests, Zweifel an der Relevanz der Tests und Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose. Entsprechende Vorbehalte sind je Fall sachlich angebracht und daher jeweils abzuklären. Die Grundlagen dazu bietet das vorliegende Buch.
Zur Illustration:
Einer nicht repräsentativen Umfrage an einer sehr kleinen Stichprobe zufolge finden sich folgende pauschalierende Urteile über Psychologische Diagnostik (Kubinger, 1997a): „Psychologische Tests sind mir zu subjektiv“, „Psychologische Tests sagen nichts aus“, „Psychologische Tests sind Interpretationssache“, „Ich nehme psychologische Tests nicht ernst“, „Psychologische Tests sind doch Humbug“; und „Was kann man nicht in einem guten Gespräch viel besser herausfinden als mit Tests?“.
Letztlich ist unabdingbare Voraussetzung für eine sachdienliche psychologische Untersuchung, dass alle in einer Fallbegutachtung involvierte Personen – das sind insbesondere die untersuchte Person und der fallführende Psychologe, eventuell Angehörige, fachfremde Kollegen oder Vorgesetzte des Psychologen sowie der Auftraggeber – den wissenschaftlichen Methoden der Psychologischen Diagnostik angemessene Brauchbarkeit zuerkennen (s. z. B. Hany, 2000). Sie müssen sich dabei darüber bewusst sein, dass die Untersuchung Rollenzwänge („Machtverhältnisse“) mit sich bringt, die für eine gewisse Zeit zu akzeptieren sind.
Bemerkung am Rand:
„Außer Diskussion steht …, daß manche Vorbehalte … bloß ein verständliches Mißtrauen aus sachlicher Unkenntnis darstellen: Angst vor ,Hinterlist‘ der Psychologen, Angst vor dem Verlust der Autonomie, Angst vor dem Mißbrauch der Ergebnisse |22|durch den Psychologen, Angst vor ,Stigmatisierungen‘, Angst vor zufälligem ,Versagen‘. Ihnen ist sowohl generell als auch (jedes Mal) im speziellen Umgang mit Testpersonen ,aufklärerisch‘ zu begegnen; und zwar durch Transparentmachung im Einzelfall (,was wird wie und wie lange warum diagnostisch getan?‘)“ (Kubinger, 1997a, S. 23).
1.4 Gesellschaftspolitische Kritik
Publikationen der 1970er Jahre, wie zum Beispiel ein Buch, das schon im Titel fragt: „Ist Psychodiagnostik verantwortbar?“ (Pulver, Lang & Schmid, 1978), waren Ausdruck für die damals generelle Verunsicherung über den Wert der Psychologischen Diagnostik. In „vielen Büchern und Zeitschriftenartikeln finden sich viele vereinzelte kritische Anmerkungen, Hinweise auf Unzulänglichkeiten, Äußerungen des Unmuts und der Unzufriedenheit bis hin zu Warnungen vor dem Einsatz von Tests überhaupt bzw. vor bestimmten Verfahren. Andere Autoren verzichten darauf, sich mit Einzelheiten lange herumzuärgern und abzuplagen, sie werfen den Tests gleich vor, zur Herrschaftsstabilisierung, Legitimation von Ausbeutungsverhältnissen usw. zu dienen und auch für diese Zwecke konstruiert worden zu sein.“ (Rexilius, 1978, S. 115).
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier einige solcher sozialpolitischen bzw. sozioökonomischen Argumentationen gegen die Psychologische Diagnostik referiert. Zum einen gibt es Kritik hinsichtlich ihrer ursprünglichen Intentionen:
Francis Galton, dem die „Geschichtsschreibung die Ehre zuteilwerden ließ, als erster ,Testkonstrukteur‘ zu gelten“ (Grubitzsch, 1991, S. 73), wird vorgeworfen, seine Tests in die Dienste einer „sozialdarwinistischen Position“ zu stellen, wonach „die geistige Leistung erbbestimmt sei und sich sozialer Rang nach genetischem Potential einstelle“ – was in der kolonialen Expansionspolitik Englands (in der Mitte des 19. Jahrhunderts) half, „auf seiten der Herrschenden einen erhöhten Legitimationsbedarf“ abzudecken (S. 68).
Der akute Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zur Zeit der Jahrhundertwende veranlasste das französische Erziehungsministerium, Alfred Binet mit der Entwicklung eines Tests zur Unterscheidung „normaler“ und „schwachsinniger“ Kinder zu beauftragen (vgl. schon in Kap. 1.2Geschichte). Ziel waren die Optimierung und Intensivierung der schulischen Ausbildung, womit die Unterweisung Minderbegabter in speziellen, neu eingerichteten Sonderschulen verbunden war. Damit wird auch ihm eine Legitimierungsfunktion angelastet. „Die Frage der Zuordnung von Individuen zu Bildungsinstitutionen war … nicht nur eine Frage der Anpassung individueller Ansprüche an institutionelle Angebote, sondern vielmehr eine Frage der Legitimierung und Legalisierung der Tatsache, dass eben nicht alle Individuen gleiche Zugangsmöglichkeit zu allen Bildungsinstitutionen haben. Dieses wurde u. a. mittels der |23|Behauptung der unterschiedlichen Abstufung von Bildungsfähigkeit, von Begabung, von Intelligenz … erreicht.“ (Grubitzsch, 1991, S. 81). Und dies, „… ohne daß zur Debatte stand, inwieweit das bestehende Bildungssystem die auszusondernden ‚Schwachsinnigen‘ eventuell produzierte.“ (S. 82).
Ähnlich werden die Bemühungen von Hugo Münsterberg (1863 – 1916) bewertet, die Eignung von Menschen für bestimmte Tätigkeiten in Schule und Beruf festzustellen. Er war zuversichtlich, „daß mit Hilfe von experimentellen Testversuchen eine zuverlässige Angleichung von Mann und Werk ermöglicht wird“ (zit. nach Grubitzsch, 1991, S. 90). Damit bekenne er sich dazu, die Nützlichkeit der menschlichen Tätigkeiten in Verbindung zu ihrem gewinnbringenden Beitrag zum gesellschaftlichen Leben“ (Grubitzsch, 1991, S. 91) zu sehen.
Zum anderen wird explizit die Nutzung zur Selektion ins Treffen geführt. Der Zweck psychologischen Diagnostizierens werde häufig „nicht vom Getesteten, nicht vom Tester und vom Testkonstrukteur“, sondern von außen, von Auftraggebern bestimmt, oft von gesellschaftlichen Institutionen (Rexilius, 1978, S. 113). „In diesem Sinn dienen Tests … der Stabilität ‚der Gesellschaft‘, die sich mit Hilfe von Tests gegen Fehlentscheidungen und unerwünschte Entwicklungen abzusichern hofft.“ Der Leistungs- und Wissensbegriff steht damit in unmittelbarem Zusammenhang mit Normen und Regeln, deren „materielle Grundlage das produktive Eigentum ist“ und „an denen sich entscheidet, ob jemand auffällig ist, abweicht und einem diagnostischen Ausgrenzungs- und Heilungsprozeß unterworfen werden muß. Stört er das herrschende Leistungs- und Wissenssystem, wird er für dieses ‚gefährlich‘ und ‚angsterregend‘, weil er es durch sein Herausfallen wie durch sein Beispiel bedroht …, und er muß stabilisiert werden, damit das System stabil bleibt.“
Zum Dritten geht es um die Beschränkung der Autonomie einer Person. Psychologische Diagnostik im Auftrag Dritter impliziere ein ethisch bedenkliches Autonomieproblem, weil es oft nicht der Betroffene selbst ist, der die Schlussfolgerungen aus den diagnostischen Ergebnissen zieht. „Jede Einschränkung der Autonomie in einem angeblich überindividuellen Interesse bedarf der Rechtfertigung durch einen interindividuellen Konsens“ (Lang, 1978, S. 29), wobei sich im gegebenen Zusammenhang die Frage stellt, „ob letzten Endes das Individuum für die Gemeinschaft oder die Gemeinschaft für das Individuum da sein soll.“
Wottawa (2002, S. 3) resümiert den sozialpolitischen bzw. sozioökonomischen Aspekt der Psychologischen Diagnostik in seiner Entwicklung bis heute wie folgt: „Es zeigt sich seit 1789 mit einer Wellenlänge von im Mittel etwa 60 Jahren ein periodisches Schwanken zwischen der Betonung von ,Gleichheit‘ (1789, 1848, 1918, 1968) und, in den Phasen dazwischen, eine stärkere Betonung von ,Leistung‘, was zwangsläufig die Akzeptanz von Unterschieden beinhaltet. Der letzte Höhepunkt des Strebens nach ,Gleichheit‘, die 1968er Bewegung, führte ja de facto zur Abschaffung der Eignungsdiagnostik an den meisten deutschsprachigen Universitä|24|ten, mit erheblichen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Inzwischen hat sich der allgemeine gesellschaftliche Trend vollständig gewandelt, und man würde in Fortsetzung der bisherigen ,Wellen‘ erwarten, dass man bis etwa 2028 nun wieder eine systematische Eignungsdiagnostik aufbauen kann. Für die Diagnostik hatte dieser Trend vor allem folgende Konsequenzen: Die Nachfrage nach (eignungs-)diagnostischen Instrumenten und Know-how ist seit 1990 massiv gestiegen, vor allem in der Wirtschaft.“
Zur Illustration:
„Aber auch andere brisante Fragestellungen dokumentieren das aktuelle Interesse der Öffentlichkeit daran, mittels psychologischen Diagnostizierens zum Teil gravierende Entscheidungen zu treffen bzw. vorzubereiten. Zu nennen ist hier der Einsatz der Psychologischen Diagnostik im Zusammenhang mit Sorgerecht, Arbeitsrecht und Verkehrsrecht, in der forensischen Begutachtung (etwa in Bezug auf Glaubwürdigkeit oder in Bezug auf eine Waffenbesitzberechtigung), bei Versicherungsfragen (etwa zur Identifizierung von Simulanten) oder zur Festlegung von Maßnahmen bei neurologischen Funktionsbeeinträchtigungen (etwa Teilleistungsstörungen).“ (Jäger & Kubinger, 2001, S. 157 f.).
Diese nach wie vor aktuellen Beispiele psychologischen Diagnostizierens können zwischenzeitlich um zwei sehr bedeutend gewordene Anwendungsbereiche der Psychologischen Diagnostik ergänzt werden. Beide betreffen das Problem der Studienplatzbewirtschaftung. Einerseits geht es um Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren von Hochschulen, wobei solche für das Fach Psychologie derzeit wohl die ausgereiftesten sind (s. Formazin, Schroeders, Köller, Wilhelm & Westmeyer, 2011). Andererseits geht es um so genannte Self-Assessments (s. weiter unten in Kap. 1.6Themen, Verfahren und Populationen sowie genauer in Kap. 3.1.4) im Rahmen der Studienberatung, und zwar zur selbstverantwortlichen Informationsgewinnung und -verwertung von Studiumsinteressierten (s. z. B. Kubinger, 2015).
1.5 Rechtfertigung
Selbstverständlich kann nicht die Nachfrage allein Psychologische Diagnostik bzw. bestimmte Arten psychologischen Diagnostizierens rechtfertigen. Die skizzierte Kritik ist also zu hinterfragen, wobei letztlich die eigene ideologische Positionierung jedes potenziellen Anwenders psychologisch-diagnostischer Verfahren darüber entscheidet, ob er einen Auftrag zur Bearbeitung einer gegebenen Fragestellung übernimmt.
Wichtiger Hinweis:
Für den Einzelnen wird es wohl darum gehen abzuwägen, ob die vielen Möglichkeiten eines wissenschaftlich fundierten und inhaltlich reiflich überlegten psychologischen Diagnostizierens, trotz gesellschaftspolitischer Skepsis, subjektbezogenen Wert haben können.
|25|Wenn in der angeführten Kritik deutlich auf den Einsatz psychologisch-diagnostischer Verfahren zur Selektion Bezug genommen wird, dann ist zunächst einmal anzumerken, dass Selektionsdiagnostik zwar eine wesentliche, nicht aber die einzige Zielsetzung der Praxis ist. Immer mehr setzen sich Konzepte durch, die das Interesse der untersuchten Person in den Mittelpunkt stellen. Sogar im Personalwesen (Human Resource Management) gibt es massive Bestrebungen, im Zuge einer „Personalentwicklung“ den Mitarbeitern vermittels fundierter Diagnose die Chance zur Weiterbildung, aber auch zur Persönlichkeitsentwicklung zu geben. Gibt es für den damit vage angesprochenen Begriff kaum noch eine andere Bezeichnung als die der gelegentlich zu findenden „Modifikationsstrategie“ psychologischen Diagnostizierens (zum Beispiel Pawlik, 1976), so ist innerhalb der Pädagogischen Psychologie die Bezeichnung „förderungsorientierte Diagnostik“ bereits lange etabliert (s. Kornmann, 2003): Sie ist so angelegt, dass mit der Diagnose mögliche Fördermaßnahmen unmittelbar aufgezeigt werden. Es scheint empfehlenswert, diese Bezeichnung generalisiert als Alternative zur Selektionsdiagnostik zu verwenden, und also zum Beispiel auch die „therapieleitende Diagnostik“, wie sie innerhalb der Klinischen Psychologie alltäglich sein sollte, zu subsumieren. Der Begriff „Förderung“ ist dazu ziemlich weit zu fassen, nämlich auch für Maßnahmen, die negative Entwicklungen lediglich stoppen oder wenigstens entschleunigen können.
Erläuterung zum Begriff „Personalentwicklung“:
Es ist das „ein Oberbegriff für ein breites … Spektrum von Maßnahmen zur Analyse, Planung, Förderung und Evaluation des gesamten personellen Potenzials einer Organisation … . Als praktische Zielsetzung steht oft die Verbesserung der aufgaben- und tätigkeitsbezogenen fachlichen Qualifikation … des Personals im Vordergrund. Zu berücksichtigen sind aber auch Kompetenzen, die über den Bereich unmittelbarer fachlicher Qualifikationen hinausgehen, wie insbes. Kreativität, soziale Kompetenzen und Teamentwicklung.“ (Dorsch – Lexikon der Psychologie; Greif, 2017a, S. 1255).
Eine solche „Horizonterweiterung“ der Psychologischen Diagnostik von der Selektionsdiagnostik auf die förderungsorientierte Diagnostik relativiert offensichtlich Vieles der angeführten gesellschaftspolitischen Kritik. Im Gegenteil, manche sozialpolitischen bzw. sozioökonomischen Bestrebungen sind erst mit einer förderungsorientierten Diagnostik möglich geworden. Als Beispiel sei hier die Bewegung der kognitiven Frühförderung bzw. der kompensatorischen Erziehung im Vorschulalter genannt (s. z. B. Lückert, 1969), mit dem Bemühen um Chancengleichheit der Kinder aus unteren Sozialschichten. In gewisser Weise wird damit auch die Autonomie der untersuchten Person in den Vordergrund gerückt, also psychologisches Diagnostizieren ins subjektbezogene Interesse gesetzt.
Wichtiger Hinweis:
Bei psychologischen Untersuchungen zu Fragestellungen innerhalb der Rechtspflege ist die Autonomie der untersuchten Person beschränkt: In der Regel findet dort ein psychologisches Diagnostizieren nicht aus eigenem Antrieb statt. – Beispiele solcher Frage|26|stellungen sind die Frage nach der Schuldfähigkeit von Angeklagten oder nach der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen (s. dazu z. B. Dietze, 1997, bzw. Volbert, 2010).
Bemerkung am Rand:
Zweifellos besteht bei der Personalauswahl sowie bei vielen ähnlichen Fragestellungen insofern ein gewisser Zwang zur psychologischen Untersuchung und ist damit der Verlust der Autonomie des Kandidaten verbunden, als bei einer Weigerung die Chancen des Kandidaten auf ein Minimum reduziert werden. – Um ihr Image bemühte Wirtschaftsunternehmen pflegen daher im Sinn von Personalentwicklung eine Beratung aufgrund der erfolgten Begutachtung selbst von denjenigen Kandidaten, welche letztlich nicht ausgewählt werden.
Freilich besteht zum Beispiel auch bei Fragen der Schuladministration eines Kindes die Möglichkeit, dass andere, vor allem die Interessen der Schulbehörde in den Vordergrund rücken. Psychologisches Diagnostizieren läuft dann vordergründig in Gefahr, die Funktion der Ausgrenzung zu leisten. Genau genommen liegt es aber in der Verantwortlichkeit des Diagnostikers, solchen Interessen nicht Vorschub zu leisten, sondern die Entwicklungsperspektive des Kindes da mit jener dort zu vergleichen und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände abzuwägen, welche von zwei Beschulungsweisen (Schultypen) dem Wohl des Kindes mehr zuträglich ist. Und das verlangt erst recht nach hochwertigen psychologisch-diagnostischen Verfahren, nämlich solchen, die nicht (nur) den gegenwärtigen, situativen und vielleicht spezifischen Grad an Fähigkeiten feststellen, sondern vor allem das entsprechende Potenzial bei optimaler Förderung.
Zur Illustration:
Genauso wie eine permanente Überforderung in den Leistungsanforderungen für ein Kind problematisch ist, kann sich auch eine mittel- oder langfristig gegebene Unterforderung negativ auf seine Entwicklung auswirken. Ausgehend von einer offensichtlich gegebenen aktuellen Überforderung ist daher jedes Mal zu diagnostizieren, ob je Maßnahme absehbar mit einer Unterforderung zu rechnen ist. Dabei hilfreich sind zum Beispiel Tests zur Messung der Lernfähigkeit (s. Genaueres dazu in Kap. 4.1.2), aber auch Verfahren, die das Ausmaß bisher erhaltener Förderung erfassen, etwa durch die Gegenüberstellung besonders förderungsabhängiger und weitgehend förderungsunabhängiger Tests (s. ein Fallbeispiel dazu in Kap. 2.4.3); ebenso wichtig kann es in diesem Zusammenhang sein, ein Testergebnis schichtspezifisch zu relativieren (s. dazu in Kap. 2.10Fairness).
Erläuterung zum Begriff „Potenzial“:
Innerhalb der Psychologischen Diagnostik wird mit Potenzial20 eine Verhaltensweise (Handlung) bezeichnet, die bei optimaler Nutzung der Eigenschaften einer Person und geeigneten biologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist. So spricht man oft von „Leistungspotenzial“, zum Beispiel auch von „Hochleistungspotenzial“ (s. Holocher-Ertl & Kubinger, 2009). Es geht also um Verhaltensweisen, die (in der Gesellschaft) grundsätzlich positiv bewertet werden.
|27|Nichtsdestotrotz spielt die Selektionsdiagnostik, insbesondere innerhalb der Arbeitswelt eine große Rolle. Aber dazu zeigt zum Beispiel Althoff (1984), dass es naiv wäre, zu glauben, man könne bestimmte sozialpolitische bzw. sozioökonomische Bedingungen in der Gesellschaft eher erreichen, würde man die Möglichkeiten der Psychologischen Diagnostik nicht anwenden (s. die entsprechende Argumentation in Präsentation 1.1).
Präsentation 1.1:
Voraussetzungen bei Eignungsentscheidungen (nach Althoff, 1984; S. 145 – gekürzt und mit Korrektur einer missverständlichen Formulierung)
Zwischen Menschen bestehen inter- und intraindividuelle Unterschiede in der Kompetenz zur Bewältigung bestimmter Berufs- und Arbeitsaufgaben.
Einschätzungen dieser Kompetenzunterschiede sind meist ausschlaggebend für personelle Wahlentscheidungen institutioneller oder individueller Art.
Solche institutionellen oder individuellen Wahlentscheidungen sind unausweichlich; d. h. Eignungsdiagnostik und Personalauslese sind „natürliche“ Vorgänge, die mit oder ohne Tests, mit oder ohne Psychologen ablaufen müssen.
Personelle Entscheidungen implizieren stets Prognosen über die Bewährung der Betroffenen bei der Bewältigung bestimmter Aufgaben. Die Vorhersage künftiger beruflicher Leistungen und Verhaltensweisen ist das Ziel jeder Eignungsdiagnostik. Da weder die inneren „Dispositionen“ noch die künftigen inneren und äußeren Verhaltensdeterminanten vollständig messbar bzw. voraussagbar sind, beinhalten Prognosen nur mehr oder weniger hohe Bewährungswahrscheinlichkeiten.