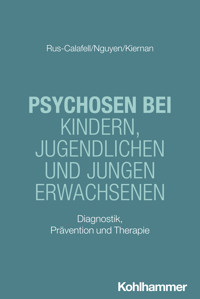
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychosen gehören zu den herausforderndsten psychischen Störungen und sind oft mit Missverständnissen und Stigmatisierung verbunden. Besonders junge Menschen, die klinische Psychosen erleben, haben über die medikamentöse Behandlung hinaus Schwierigkeiten, angemessene psychologische Unterstützung zu finden. Dieses Buch bietet eine praxisnahe und evidenzbasierte Übersicht über Psychosen und deren Behandlung aus einer Kontinuumsperspektive. Es behandelt theoretische Grundlagen, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie speziell für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Geleitwort zur Buchreihe
1 Erscheinungsbild, Entwicklungspsychopathologie und Klassifikation
1.1 Was sind Psychosen?
1.2 Kurze historische und konzeptuelle Einführung
1.2.1 Neurobiologischer Ansatz
1.2.2 Kognitiver Ansatz
1.2.3 Phänomenologischer Ansatz
1.3 Transdiagnostische Sichtweise auf Psychose
1.4 Zum vorliegenden Buch
1.5 Erscheinungsbild psychotischer Störungen
1.5.1 Kontinuumsmodell der Psychose
1.5.2 Prädiktoren und Vulnerabilitätsfaktoren für die Entwicklung einer Psychose
1.6 Klassifikation
1.6.1 Diagnostische Kriterien psychotischer Störungen
1.6.2 Das Clinical Staging Model
1.7 Überprüfung der Lernziele
2 Epidemiologie, Verlauf und Folgen
2.1 Epidemiologie
2.2 Verlauf
2.3 Clinical High Risk der Psychose
2.3.1 Klinische Relevanz von CHR
2.3.2 Risiko für den Übergang in eine psychotische Störung
2.4 Folgen psychotischer Symptomatik im Kindes- und Jugendalter
2.5 Überprüfung der Lernziele
3 Komorbiditäten und Differenzialdiagnostik
3.1 Komorbiditäten
3.1.1 Affektive Störungen
3.1.2 Komorbide Störungen in der neurobiologischen Entwicklung
3.1.3 Traumafolgestörungen
3.1.4 Substanzmissbrauch und -abhängigkeit
3.1.5 Borderline-Persönlichkeitsstörung
3.1.6 Suizidalität
3.1.7 Subklinische psychotische Symptome
3.2 Differenzialdiagnostik bei frühen Psychosen
3.2.1 Affektive Psychosen (bipolare vs. schizoaffektive vs. depressive Störung)
3.3 Überprüfung der Lernziele
4 Diagnostik
4.1 Erstgespräch und Anamnese
4.1.1 Besonderheiten des Erstgesprächs
4.1.2 Verhaltensanalyse
4.1.3 Weitere wichtige Unterlagen und Informationen
4.2 Messinstrumente
4.2.1 Störungsübergreifende diagnostische Interviews
4.2.2 Störungsspezifische Diagnostik
4.2.3 Weitere relevante Faktoren
4.3 Überprüfung der Lernziele
5 Erklärungsmodelle früher Psychosen
5.1 Neurochemisches Modell
5.2 Vulnerabilitäts-Stress-Modell
5.3 Kognitives Modell der Psychose
5.3.1 Kognitives Modell der Paranoia
5.3.2 Kognitives Modell der auditiven Halluzinationen
5.4 Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie bei Psychosen
5.5 Überprüfen der Lernziele
6 Psychotherapie
6.1 Relevante Informationen für den Antrag auf Psychotherapie
6.1.1 Persönliche und medizinische Vorgeschichte
6.1.2 Familiengeschichte
6.1.3 Psychologischer Befund und Diagnostik
6.1.4 Diagnosen
6.1.5 Therapieplan und Prognose
6.2 Kognitive Verhaltenstherapie für Psychosen (KVT-P)
6.3 Umsetzung der Behandlungsphasen
6.4 Therapeutische Beziehung
6.5 Psychopharmakotherapie
6.6 Schwierige Situationen in der Therapie
6.7 Therapiemanuale für frühe Psychosen
6.8 Überprüfung der Lernziele
7 Psychotherapieforschung
7.1 Therapie von frühen Psychosen
7.2 Evidenzbasierte Psychotherapien für frühe Psychosen
7.2.1 Psychoedukation und Normalisieren
7.2.2 Klinische Überwachung
7.2.3 Kognitive Verhaltenstherapie bei Psychose (KVT-P)
7.2.4 Cognitive Remediation
7.2.5 Familieninterventionen (FI)
7.2.6 Peer-Beratung
7.2.7 Unterstützung für Bildung und Beschäftigung (
Educational and Employment Support,
SEE)
7.3 Rückfallprophylaxe
7.4 Medikation bei früher Psychose
7.5 Überprüfung der Lernziele
8 Zusammenfassung und Zukunftsperspektive
8.1 Zusammenfassung
8.2 Zukunftsperspektive
8.2.1 Verbesserung des Zugangs zur Psychotherapie
8.2.2 Fortschritte in Kognitiver Verhaltenstherapie für Psychosen (KVT-P)
8.2.3 eHealth und Frühe Psychosen
8.2.4 Partizipative Forschung
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Klinische Psychologie und Psychotherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Verhaltenstherapeutische Interventionsansätze
Herausgegeben von Tina In-Albon, Hanna Christiansen und Christina Schwenck
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/klinische-psychologie-und-psychotherapie
Die Autorinnen
Mar Rus-Calafell ist Psychotherapeutin und Professorin für Klinische Psychologie und Digitale Psychotherapie an der Ruhr-Universität-Bochum.
Phuong-Mi Nguyen ist Psychotherapeutin und Doktorandin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Digitale Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum.
Grace Kiernan ist Psychotherapeutin in Ausbildung und Doktorandin am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Digitale Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum.
Mar Rus-CalafellPhuong-Mi NguyenGrace Kiernan
Psychosen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Diagnostik, Prävention und Therapie
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-041853-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-041854-7epub: ISBN 978-3-17-041855-4
Geleitwort zur Buchreihe
Klinische Psychologie und Psychotherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Verhaltenstherapeutische Interventionsansätze
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind weit verbreitet und ein Schrittmacher für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen im Erwachsenenalter. Für einige der für das Kindes- und Jugendalter typischen Störungsbereiche liegen empirisch gut abgesicherte Behandlungsmöglichkeiten vor. Eine Besonderheit in der Diagnostik und Therapie von Kindern mit psychischen Störungen stellt das Setting der Therapie dar. Dies bezieht sich sowohl auf den Einbezug der Eltern als auch auf mögliche Kontaktaufnahmen mit dem Kindergarten, der Schule, der Jugendhilfe usw. Des Weiteren stellt die Entwicklungspsychopathologie für die jeweiligen Bände ein zentrales Kernthema dar.
Ziel dieser neuen Buchreihe ist es, Themen der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie und Psychotherapie in ihrer Gesamtheit darzustellen. Dies umfasst die Beschreibung von Erscheinungsbildern, epidemiologischen Ergebnissen, rechtliche Aspekte, ätiologischen Faktoren bzw. Störungsmodelle, sowie das konkrete Vorgehen in der Diagnostik unter Berücksichtigung verschiedener Informanten und das konkrete Vorgehen in der Psychotherapie unter Berücksichtigung des aktuellen Wissenstandes zur Wirksamkeit.
Die Buchreihe besteht aus Bänden zu spezifischen psychischen Störungsbildern und zu störungsübergreifenden Themen. Die einzelnen Bände verfolgen einen vergleichbaren Aufbau wobei praxisorientierte Themen wie bspw. Fallbeispiele, konkrete Gesprächsinhalte oder die Antragsstellung durchgehend aufgenommen werden.
Christina Schwenck (Gießen)Hanna Christiansen (Marburg)Tina In-Albon (Mannheim)
Die Herausgeberinnen
Prof. Dr. Tina In-Albon, Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters sowie Leitung des Instituts für Kinder- und Jugendpsychotherapie und der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche an der Universität Mannheim.
Prof. Dr. Hanna Christiansen, Professur für Klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Philipps-Universität Marburg; Leiterin der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie-Ambulanz Marburg (KJ-PAM) sowie des Kinder- und Jugendlichen-Instituts für Psychotherapie-Ausbildung Marburg (KJ-IPAM).
Prof. Dr. Christina Schwenck, Professur für Förderpädagogische und Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, Justus-Liebig-Universität Gießen. Leiterin der postgradualen Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie.
1 Erscheinungsbild, Entwicklungspsychopathologie und Klassifikation
Fallbeispiel
Noah ist ein 15-jähriger Jugendlicher, der von der Polizei in die Notaufnahme gebracht wurde, nachdem er um 2:30 Uhr morgens auf der Straße gefunden wurde. Noah sagte der Polizei, dass er auf der Suche nach den Illuminaten sei. Er höre, wie sie ihm zuflüstern, dass sie kommen und ihn holen werden. Noahs Eltern berichten, dass er zwei Wochen zuvor aufgehört habe, zur Schule zu gehen und die meiste Zeit in seinem Zimmer verbringe. Sie hören ihn schreien und mit sich selbst reden. Sie beschreiben seltsame Verhaltensänderungen an ihrem Sohn, wie z. B. das Auseinandernehmen seines Laptops, um die Kamera zu entfernen. Er war schon immer schüchtern, hatte in der Grund- und Mittelschule nur wenige Freund*innen und wurde in der dritten Klasse mit einer Leseschwäche diagnostiziert. In den Monaten vor der Untersuchung hat er sich zunehmend zurückgezogen und isoliert. Seine Eltern befürchten, dass er depressiv ist oder Drogen nimmt. Sie versuchten, ihn zum Hausarzt zu bringen, aber er weigerte sich, dorthin zu gehen. Sie riefen das örtliche Krisentelefon an, aber man sagte ihnen, man könne nichts tun, es sei denn, er stelle eine Gefahr für sich oder andere dar.
Lernziele
Sie können die Begrifflichkeiten Wahn, Halluzinationen, Denkstörung, desorganisiertes Verhalten und Negativsymptomatik erklären und voneinander abgrenzen.
Sie können diagnostische Kriterien für psychotische Störungen nach ICD-11 und DSM-5 benennen.
Sie können im Fallbeispiel Noah genannte Vulnerabilitätsfaktoren und die wichtigsten Symptome benennen.
Sie kennen das Kontinuumsmodell der Psychose und die klinischen Implikationen, die sich daraus ergeben.
1.1 Was sind Psychosen?
Psychotische Erfahrungen sind Teil der menschlichen Vielfalt. Das Hören von Stimmen oder die Überzeugung, dass wir von jemandem verfolgt werden (Paranoia), entstehen als Reaktion auf einen bestimmten biografischen Kontext durch eine bestimmte Person. Solche Erfahrungen sind keine pathognomonischen Krankheitssymptome. Sie können vielmehr als eine von verschiedenen Reaktionsweisen auf Probleme oder Erfahrungen einer Person verstanden werden. Ferner kann man sie also eher als Teil der Komplexität des menschlichen Wesens auffassen. Daher ist es wichtig, die Person individuell zu betrachten, die solche Erfahrungen subjektiv durchlebt, um die wahre Bedeutung solcher Erfahrungen zu verstehen.
»Psychose« ist ein allgemeiner Begriff, der sich auf Verzerrungen und Beeinträchtigungen der Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens und des Verhaltens bezieht, die zu einem Verlust des Kontakts mit der konsensuellen Realität führen. Sie ist hauptsächlich durch Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Denkstörungen gekennzeichnet und wird oft von desorganisiertem motorischem Verhalten und negativen Symptomen begleitet (American Psychiatry Association, 2013). Der Begriff kann zu Verwirrungen führen, da er sowohl für diagnostische Kategorien als auch für einzelne Symptome (Erfahrungen) mit unterschiedlichem Schweregrad, Dauer und klinischer Bedeutung verwendet wird. Auf der kategorialen Ebene umfassen die Schizophrenie-Spektrum-Störungen die Schizophrenie, die schizophreniforme Störung, die schizoaffektive Störung, die wahnhafte Störung, die kurze psychotische Störung und die substanz- oder medikamenteninduzierte Störung. Auf der Symptomebene sind psychotische Symptome und psychoseähnliche Erfahrungen (auch ungewöhnliche Erfahrungen genannt, aus dem engl. psychotic-like experiences) ebenso in der Allgemeinbevölkerung anzutreffen und Menschen mit diesen Erfahrungen können eine Behandlung benötigen oder auch nicht.
1.2 Kurze historische und konzeptuelle Einführung
Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann man, die klinische Beschreibung der Psychose zu präzisieren: Emil Kraepelin (1913), dem das Konzept der dementia praecox zugeschrieben wird, und Eugen Bleuler (1911), der die dementia praecox in die Schizophrenie umdefinierte, sind die beiden bemerkenswertesten Vertreter der ursprünglichen Beschreibung der Schizophrenie. Beide beschrieben die gesamte Bandbreite der Symptome, die bei dieser Störung auftreten. Sie zeigten diese anhand konkreter Symptome auf und konstruierten einen Rahmen für ihre Klassifizierung, der das spätere Denken über diese Störung deutlich geprägt hat. Die wichtigste Ergänzung zu ihrem Beitrag war die »Isolierung« der elf Erstrangsymptome von Kurt Schneider (1959), die als pathognomonisch für die Schizophrenie galten. Die heutigen Klassifikationssysteme für Schizophrenie und verwandte Störungen haben ihre Wurzeln in dieser frühen Arbeit, wurden aber im Laufe der Zeit mit dem Bestreben weiterentwickelt, die Reliabilität, Validität und klinische Anwendbarkeit zu verbessern.
In den letzten 30 – 40 Jahren haben verschiedene psychologische Disziplinen, darunter klinische, experimentelle und Neuropsycholog*innen, wichtige Beiträge geleistet, indem sie sowohl im klinischen als auch im wissenschaftlichen Bereich gemeinsam mit Menschen mit psychotischen Störungen und Symptomen arbeiten, um deren Erfahrungen besser zu verstehen. Eine beträchtliche Anzahl von Studien hat biologische, soziale und psychologische Kausalmechanismen für psychotische Symptome nachgewiesen. Daher sollte man mindestens drei verschiedene Perspektiven einnehmen, wenn man die Psychose besser verstehen möchte: die neurobiologische, kognitive und phänomenologische Perspektive (▸ Kap.5).
1.2.1 Neurobiologischer Ansatz
Der neurobiologische Ansatz stützt sich auf konvergierende Erkenntnisse aus der Tier- und Humanforschung. Frühe genetische Studien gingen von einem einzigen Gen für Schizophrenie aus, während spätere Ansätze ein polygenes Modell favorisierten (Gottesman & Shields, 1967; Kendler, 2015). Immer mehr Belege deuten nämlich darauf hin, dass das Schizophrenierisiko eher kontinuierlich und polygen ist, d. h., dass eine große Anzahl häufiger Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs, die häufigste Art genetischer Variationen im menschlichen Genom) jeweils eine sehr geringe Auswirkung haben, wobei seltene Kopienzahl- und Einzelnukleotidvarianten einen noch geringeren Beitrag leisten (Purcell et al., 2014). Studien zur Struktur und Funktion des Gehirns könnten wichtigere Erkenntnisse über mögliche biologische Mechanismen der Psychose liefern. Die einfachste Version des entwicklungsneurologischen Modells der Schizophrenie geht davon aus, dass Gene (Jones & Murray, 1991), die an der Neuroentwicklung beteiligt sind, und/oder Umweltereignisse im frühen Leben (z. B. fötale Hirnentwicklungsanomalien) zu einer abnormen Gehirnentwicklung führen, die eine Prädisposition für das spätere Auftreten einer Psychose darstellt (Church et al., 2002; Murray & Lewis, 1987). Spätere Formulierungen dieses Modells beziehen die Rolle sozialer Faktoren ein, die erst später auf dem Weg zur Störung zum Tragen kommen. Darunter fallen städtisches Aufwachsen, soziale Isolation und Migration, und sie legen eine Interaktion zwischen dem Biologischen und dem Sozialen in einer »Kaskade von zunehmend abweichender Entwicklung« nahe (Bramon & Murray, 2001). Obwohl die Neuroentwicklungshypothese neurokognitive Defizite und einige der neuroanatomischen Anomalien erklären kann, die bei Menschen mit einer manifestierten Psychose zu finden sind, kann sie nicht erklären, wie aus einem entwicklungsauffälligen und sozial isolierten Jugendlichen mit psychoseähnlichen Erfahrungen eine Person mit einer Schizophrenie wird. Die Dopaminhypothese der Schizophrenie geht davon aus, dass die psychotischen Symptome der Störung aus einer Hyperaktivität des mesolimbischen dopaminergen Systems resultieren, das Dopamin unabhängig von Hinweis und Kontext feuert und freisetzt, wodurch Erfahrungen von abweichender Neuheit und Salienz entstehen (Kapur et al., 2005), wie z. B. auditive Halluzinationen (diese Hypothese und andere relevante neurochemische Ansätze werden später näher erläutert, ▸ Kap. 5).
Ein umfassender Überblick über die Literatur würde jedoch den Rahmen dieses Buches sprengen, und klinische Implikationen könnten zu kurz kommen. Nichtsdestotrotz wird in den neurobiologischen Modellen der Psychose (insbesondere der Schizophrenie) die Wechselwirkung zwischen genetischer Anfälligkeit und der Exposition gegenüber Umweltstressoren anerkannt. Aktuelle Modelle gehen davon aus, dass traumatische Erlebnisse und soziale Widrigkeiten (hauptsächlich) in der Kindheit die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen, was zu verschiedenen kognitiven Verzerrungen und Affektstörungen führt, die in Wechselwirkung mit späteren sozialen Stressfaktoren die Störung auslösen (Howes & Murray, 2014).
1.2.2 Kognitiver Ansatz
Der kognitive Ansatz übernimmt den etablierten Ansatz, dass eine Person, die eine Psychose entwickelt, eine prämorbide biopsychosoziale Anfälligkeit besitzt, und ergänzt diesen, indem betont wird, dass vorbestehende Grundüberzeugungen und laufende Bewertungen, sowie Interpretationen von Erfahrungen für die Entwicklung und das Persistieren belastender Positivsymptome entscheidend sind. In einem der ersten Versuche, biologische mit kognitiven und sozialen Faktoren zu verknüpfen, schlugen Broome et al. (2005) vor, dass der Übergang zur Psychose im Allgemeinen als Folge von Funktionsstörungen in präfrontalen und subkortikalen Hirnregionen verstanden wird, die durch stressinduzierte Folgen beeinflusst werden (Broome et al., 2005). Drogenkonsum und chronische soziale Widrigkeiten können die Dopamin-Dysregulierung verstärken. Diese begünstigen zusammen mit dysfunktionalen/verzerrten kognitiven Bewertungsprozessen, die durch negative Erfahrungen entstanden sind (siehe unten und ▸ Kap. 5), bei einer Person mit vorhandenen Anfälligkeitsfaktoren die Entwicklung einer klinisch relevanten Psychose. Nachfolgende, weiter entwickelte kognitive Ansätze zur Psychose betonen mehr die Rolle kognitiver, sozialer und emotionaler Prozesse beim Beginn und Persistieren psychotischer Symptome. Laut diesen Modellen spielen die Interpretation und Bedeutung, die Ereignissen und Erfahrungen gegeben werden, d. h. die Bewertung, eine entscheidende Rolle beim Übergang von ungewöhnlichen Gedanken und Erfahrungen zu psychotischen Symptomen (Freeman, 2016; Tsang et al., 2021). So ist es unwahrscheinlich, dass Personen mit psychotischen Erfahrungen, die sie als positiv und hilfreich bewerten, eine Behandlung in Anspruch nehmen werden. Nach dieser Auffassung befindet sich die Psychose auf einem Kontinuum zusammen mit »normalen« Erfahrungen in der Allgemeinbevölkerung (▸ Kap. 1.5.1, ▸ Kap. 2).
Ergänzend zum kognitiven Modell sollten alle Belege berücksichtigt werden, die für einen entwicklungssoziologischen Ansatz der Psychose sprechen. Die sozio-ökologische Sichtweise konzentriert sich auf frühe Lebensereignisse, das soziale Umfeld und die anschließende Entwicklung der psychologischen Welt und des psychischen Wohlbefindens einer Person. Etwa 8 % der Allgemeinbevölkerung erleben in bestimmten Lebensabschnitten auditive Halluzinationen und andere psychotische Erlebnisse, ohne dass sie eine psychotherapeutische oder psychiatrische Versorgung benötigen (Linscott & Van Os, 2013). Dies ist dann der Fall, wenn eine Person diese Erlebnisse auf bestimmte Weise interpretiert. Ungünstige Lebensereignisse, insbesondere Traumata in der Kindheit, lösen häufig die Bildung dysfunktionaler Bewältigungsmechanismen und verzerrter kognitiver Bewertungen über sich selbst und andere aus (Reininghaus et al., 2016b). Ein offensichtliches Beispiel hierfür ist, sich selbst die Schuld für erlittene Gewalterfahrungen zu geben, sich selbst als schlecht oder andere als feindlich zu betrachten. Bei starker Erregung können emotionale Zustände gleichzeitig eine dissoziative Barriere gegen das Trauma aufbauen und die Funktion wichtiger, an der Psychose beteiligter Neurotransmitter wie Glutamat und Dopamin verändern (Howes & Nour, 2016) und die kortikale Struktur des Gehirns durch neurotoxische Effekte schädigen (Habets et al., 2011).
Eine entwicklungssoziologische Perspektive der Psychose
Soziale Widrigkeiten sind nicht auf Gewalterfahrungen in der Kindheit beschränkt. Kulturelle, politische und demografische Faktoren (Bourque, van der Ven, Fusar-Poli, & Malla, 2012), einschließlich Migrationshintergrund und/oder Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit, sowie Diskriminierung und Armut können vulnerable Personen zu ungesunden Verhaltensweisen wie etwa Cannabiskonsum, missbräuchlichen Beziehungen und schlechter psychischer Gesundheit im Allgemeinen prädisponieren. Diese Verhaltensweisen wiederum können den kognitiven Bewertungsstil des Einzelnen dahingehend verzerren, dass er die Außenwelt und andere Menschen als feindlich wahrnimmt. Folglich betont die entwicklungssoziologische Perspektive der Psychose die Notwendigkeit für Kliniker*innen, sich nicht nur auf intraindividuelle Faktoren zu konzentrieren, die für psychotische Symptome relevant sind, sondern die Person ganzheitlich in ihrem Entwicklungs- und sozialen Kontext besser zu verstehen (Howes & Murray, 2014).
1.2.3 Phänomenologischer Ansatz
Das Modell der basic-self disorder der Schizophrenie (oder der Ipseität Störung, lateinisch ipse – self oder Selbst) postuliert eine Abnormalität der grundlegenden oder minimalen Selbstwahrnehmung, des normalen Ich als Subjekt. Die Ipseität, die im gelebten Körper und im inneren Zeitbewusstsein verankert ist, wird nicht als Entität im eigenen Bewusstseinsfeld erlebt, sondern als unsichtbarer Ausgangspunkt für Erfahrung, Denken und Handeln, als Medium des Bewusstseins, Quelle der Aktivität oder allgemeine Ausrichtung auf die Welt. Es begründet die Ich-Gegebenheit oder Für-mich-Gegebenheit des subjektiven Lebens. Das Modell der Selbst-Störung ist tief in der phänomenologischen Tradition und der Kontinentalphilosophie verwurzelt.
Es wird angenommen, dass die Ipseität- oder Selbst-Störung bei Schizophrenie drei Hauptaspekte aufweist (Sass & Parnas, 2003). Diese drei Faktoren tragen zu einem gestörten Selbstsein bei, das als wesentliches Merkmal von Schizophrenie-Spektrum-Störungen gilt. Der erste wird als Hyperreflexivität (hyperreflexivity) bezeichnet, die sich auf ein übertriebenes Selbstbewusstsein bezieht, bei dem normalerweise implizite und nicht-volitionale Prozesse, wie z. B. das innere Denken, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Daher wird das, was stillschweigend geschieht, explizit. Ein zweiter Prozess, der als verminderte Selbstpräsenz (diminished self-presence) bezeichnet wird, bezieht sich auf eine Abnahme des (passiv oder automatisch) erlebten Gefühls, als Subjekt des Bewusstseins oder als Akteur des Handelns zu existieren. Der dritte Faktor, der gestörte »Griff« oder »Halt« (disturbed grip or hold), bezieht sich auf grundlegende Verzerrungen der Beziehungen zur äußeren Realität und der Art und Weise, wie man äußere Reize erlebt, begleitet von Veränderungen des »Realitätsstatus« der Welt. Man geht davon aus, dass solche Selbst-Störungen in gewissem Maße spezifisch für Störungen des schizophrenen Spektrums und nicht für bipolare Störungen oder andere psychische Störungen sind, und sie haben eine signifikante Vorhersagekraft für den Übergang von unspezifischen Prodromalphasen zur Psychose (Nelson, Thompson, & Yung, 2012). Dennoch bleibt ihre Überschneidung mit nicht-psychotischen Syndromen ein Diskussionsthema, zum Beispiel mit Depersonalisation und Derealisation.
Das Modell der Selbst-Störung ist derzeit kein weit verbreiteter klinischer Ansatz; die Bewertung von Störungen des minimalen Selbst-Erlebens bei Personen mit klinischem Hochrisiko (CHR) oder in der ersten psychotischen Episode könnte jedoch eine verbesserte Spezifität für die Diagnose bieten (was sich wiederum auf die Prognose und die Behandlung auswirkt) und ist daher heutzutage ein Ansatz, der viel erforscht und diskutiert wird (Sass et al., 2018).
1.3 Transdiagnostische Sichtweise auf Psychose
Psychotische Symptome sind keineswegs nur auf Patient*innen mit der Diagnose Schizophrenie beschränkt. Angesichts des Unterschieds zwischen der Prävalenz psychoseähnlicher Symptome in der Allgemeinbevölkerung (ca. 5 – 10 %; McGrath et al., 2015) und der Prävalenz von Schizophrenie (ca. 1 %) ist es nicht überraschend, dass bei vielen, wenn nicht sogar den meisten Menschen mit psychoseähnlichen Symptomen keine Schizophrenie oder sogar andere Psychosen aus dem schizophrenen Spektrum (z. B. schizoaffektive Störung) diagnostiziert werden. Stattdessen wird bei ihnen eher eine üblichere psychische Störung wie eine (unipolare oder bipolare) Depression, Angstzustände oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert – insbesondere bei Personen, die Halluzinationen zusammen mit affektiver Instabilität angeben. Allerdings sagt das Vorhandensein psychotischer Symptome selbst im Zusammenhang mit den häufigeren Störungen einen höheren Schweregrad der Symptome, ein schlechteres Ansprechen auf die Behandlung und eine schlechtere Funktionsfähigkeit voraus (Varghese et al., 2011; Yung et al., 2009). Daher ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, psychotische Erfahrungen zu erkennen und zu behandeln, selbst bei Menschen, die keine psychotischen Störungen haben und Hilfe suchen.
1.4 Zum vorliegenden Buch
Das vorliegende Buch wurde verfasst, um Psychotherapeut*innen in der Ausbildung und Kliniker*innen eine aktualisierte Beschreibung des psychologischen Ansatzes zum Verständnis von Psychose anzubieten und um darzustellen, wie eine Person mit psychotischen Erfahrungen dabei unterstütz werden kann, den damit verbundenen Leidensdruck zu verringern. Um eine ganzheitliche Psychotherapie anbieten zu können, sollte Psychose als ein vielschichtiges Phänomen verstanden werden, das nicht nur im Zusammenhang mit der Diagnose einer paranoiden Schizophrenie auftritt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es trotz der geringen Prävalenz (nicht-affektiver) psychotischer Störungen inzwischen zahlreiche Forschungsergebnisse und klinische Belege dafür gibt, dass a) frühe psychotische Erfahrungen als Prädiktor für die Psychopathologie im Erwachsenenalter (affektiv und nicht-affektiv) betrachtet werden sollten und b) der Schwerpunkt auf Prävention und Früherkennung gelegt werden sollte, um das Risiko des Übergangs zu einer Psychose zu reduzieren (Schimmelmann et al., 2008). Im Falle eines Übergangs verringern eine frühzeitige Erkennung und die Bereitstellung psychologischer Unterstützung die Wahrscheinlichkeit großer Auswirkungen der Störung auf das soziale Funktionieren und die Lebensqualität der Person.
Dieses Buch bietet daher eine aktualisierte Zusammenfassung der wichtigsten Erfahrungen, Symptome und Erklärungsmodelle der Psychose sowie einen genauen Überblick über die klinische Beurteilung und eine Einführung in die kognitive Verhaltenstherapie bei Psychosen, wobei der Schwerpunkt auf den frühen Stadien und dem frühen Beginn der Störung liegt. Wir haben auch einige neuere Diagnostik- und Therapieansätze auf diesem Gebiet aufgenommen, wobei diese aktuell noch erforscht werden.
1.5 Erscheinungsbild psychotischer Störungen
Psychotische Störungen können in vielfältiger Weise in Erscheinung treten. Psychoseähnliche Symptome im Kindes- und Jugendalter müssen zunächst nicht zwangsläufig auf eine Erkrankung hinweisen, wenngleich sie oft von hoher diagnostischer Relevanz sind. Sie liegen auf einem Kontinuum zwischen Phänomenen, die altersgemäß sind und der gesunden Entwicklung zugrunde liegen, bis hin zu Kennzeichen von psychotischen und anderen psychischen Erkrankungen. Psychoseähnliche Symptome sind bei Kindern und Jugendlichen häufig auftretende Phänomene; so geben fast 10 % an, subklinische psychoseähnliche Symptome zu erleben (Healy et al, 2019). Im Folgenden werden zunächst die verschiedenen möglichen Symptome einer psychotischen Erkrankung vorgestellt:
Halluzinationen
Unter Halluzination versteht man eine Wahrnehmung, der kein entsprechender Außenreiz zugrunde liegt, die aber dennoch als realer Sinneseindruck wahrgenommen wird. Hierbei können alle Sinnesreize betroffen sein, am häufigsten treten jedoch auditorische Halluzinationen auf (70 %), bei denen wiederum 50 % der Betroffenen zusätzlich auch unter visuellen Halluzinationen leiden.
Wahn
Als Wahn bezeichnet man eine unkorrigierbare oder nur schwer korrigierbare Fehlbeurteilung von Eindrücken, an die eine Person trotz der Unvereinbarkeit mit prüfbaren Fakten und der in der Gesellschaft mehrheitlich akzeptierten Realität festhält und an der mit starker Gewissheit festgehalten wird. Ein Wahn ist nicht durch den kulturellen oder religiösen Hintergrund oder das Intelligenzniveau der betroffenen Person erklärbar. Im psychopathologischen Befund zählt er zu den inhaltlichen Denkstörungen. Bei einem Wahn wird beispielsweise unterschieden zwischen einem Verfolgungswahn, religiösem Wahn, Beziehungswahn, Größenwahn und Schuldwahn.
Denkstörung
Darunter versteht man eine psychopathologische Veränderung des Denkens, bei der Denkinhalt oder Denkabläufe betroffen sind. Ob eine Denkstörung vorhanden ist, wird basierend auf dem Gesprochenen beurteilt. Dabei wird zwischen formaler und inhaltlicher Denkstörung unterschieden. Eine formale Denkstörung ist beispielsweise gekennzeichnet von verlangsamtem Denken, Perseveration, Ideenflucht, Grübeln oder Vorbeireden. Bei einer inhaltlichen Denkstörung wird unterschieden, ob diese wahnhaft oder nicht wahnhaft ist.
Desorganisiertes Verhalten
Darunter wird ein ungewöhnliches, bizarres Verhalten verstanden, das sich in der Wahl der Kleidung, in sozialer Interaktion und im Sexualverhalten ausdrücken kann.
Störung der Motorik
Darunter werden ungewöhnliche Bewegungen oder Haltungen verstanden, die sich durch übermäßige, sinnlose Bewegungen, Bewegungsunfähigkeit oder starre Haltungen auszeichnen.
Katatonie: gekennzeichnet durch eine unnatürliche, stark verkrampfte Haltung
Stupor: gekennzeichnet durch eine psychomotorische Hemmung des Bewegungsablaufs
Negativsymptomatik
Dieser Begriff fasst eine Gruppe an Symptomen zusammen, die durch Herabsetzung, Minderung und Verarmung psychischer Merkmale einer Person gekennzeichnet sind. Sie sind medikamentös nur schwer zu beeinflussen und umfassen einen reduzierten Ausdruck (Affektverflachung) und Apathie (Avolition, Anhedonie, Asozialität), wobei das Verfolgen zielgerichteter Aktivitäten beeinträchtigt ist.
1.5.1 Kontinuumsmodell der Psychose
Wie auch bei anderen psychischen Störungen zeigt sich im Bereich der Schizophrenie zunehmend die Tendenz, die Schizophrenie als eine Ausprägung auf einem Kontinuum und weniger als kategoriale Unterscheidung von einem Normalzustand zu verstehen (van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul & Krabbendam, 2009). Einige Studienergebnisse geben Hinweise auf eine genetische Überschneidung zwischen der Schizophrenie und anderen psychischen Störungen (Craddock & Owen, 2010).
Wenn ein Merkmal ferner als Kontinuum verstanden wird, so sollte dieses sowohl in klinischen als auch nicht-klinischen Stichproben vorhanden sein (van Os, et al. 2009). Ein systematisches Review von Healy et al. (2019) ergab, dass bei Kindern und Jugendlichen in einer nicht-klinischen Stichprobe durchschnittlich 9.8 % psychoseähnliche Symptome erlebt haben. Dies impliziert, dass das Erleben psychotischer Symptome nicht mit einer psychotischen Störung gleichzusetzen ist. Durch bestimmte Faktoren wie Aufdringlichkeit und Häufigkeit der Symptome, Komorbiditäten, Symptombewältigung, individuelle oder kulturelle Merkmale und Beeinträchtigung durch die Symptome wird aus dem Erleben psychotischer Symptome dann eine psychotische Störung (van Os et al., 2009). Van Os et al. (2009) schlagen deshalb ein Kontinuumsmodell für Psychosen bestehend aus Vulnerabilität für das Auftreten der psychotischen Symptome, Persistieren der Symptome und Ausmaß an Beeinträchtigung durch die Symptome vor.
Das Erleben psychoseähnlicher Symptome ist verbreiteter als vielleicht angenommen, da einige Menschen eine Vulnerabilität bzw. Neigung haben, diese zu erleben (psychosis proneness). Das Erleben psychoseähnlicher Symptome remittiert mit der Zeit in den meisten Fällen spontan. In einigen Fällen überdauert dieses Erleben im Zusammenwirken mit verschiedenen psychologischen und biologischen Faktoren über eine längere Zeit und persistiert (psychosis persistence). Diese Persistenz wiederum ist ein Risikofaktor dafür, dass Menschen eine Beeinträchtigung durch ihre psychotischen Symptome erleben (psychosis impairment).
1.5.2 Prädiktoren und Vulnerabilitätsfaktoren für die Entwicklung einer Psychose
Die Geschichte der Psychologie zeigt wiederholt sich widersprechende Haltungen bezüglich der Ursache(n) für die Entwicklung psychotischer Störungen. Auch die Umwelt-Genetik-Debatte diesbezüglich ist weiterhin nicht abgeschlossen. Als gesichert gilt jedoch, dass von einer multifaktoriellen Entstehung auszugehen ist; die derzeitige Forschungslage spricht am ehesten für ein integriertes biopsychosoziales Modell als Erklärung für die Entwicklung psychotischer Erkrankungen. Dabei ist anzumerken, dass verschiedene Faktoren zu unterschiedlicher psychotischer Symptomatik führen können, was wiederum für die psychotherapeutische Behandlung von Bedeutung ist.





























