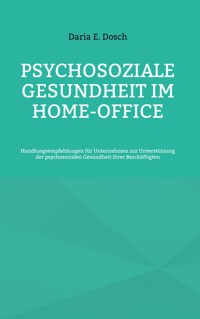
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten sich viele Unternehmen sowie deren Mitarbeitenden erstmalig mit Home-Office auseinandersetzen. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass sich in der Arbeitswelt eine hybride Form zwischen Home-Office und Präsenz-Tagen vor Ort entwickeln wird. Wenngleich diverse Studien sich bereits vor der Pandemie mit Vorteilen und Nachteilen von Home-Office auseinandergesetzt haben, werden psychosoziale Aspekte in der Literatur häufig vernachlässigt. Auch in der Praxis werden psychische Belastungen des Öfteren aufgrund von Unsicherheit und fehlendem Wissen in den Unternehmen nachrangig behandelt. Das vorliegende Fachbuch bietet Handlungsempfehlungen für Unternehmen, um ihre Mitarbeitenden hinsichtlich deren psychosozialer Gesundheit im Home-Office bestmöglich unterstützen zu können. Dafür wurden mittels Experteninterviews Faktoren erhoben, welche die psychosoziale Gesundheit im Home-Office beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass die vorliegende Thematik sehr komplex und darum differenziert zu betrachten ist. Es konnte festgestellt werden, dass die psychosoziale Gesundheit von Menschen ein ineinandergreifendes Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist, welche im Home-Office ebenso individuell wie vielfältig sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1.
Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Forschungsfrage und Forschungsziel
1.3 Aufbau der Arbeit
2.
Theoretischer Teil
2.1 Begriffe und Abgrenzungen
2.1.1 Definition Telearbeit / Home-Office
2.1.2 Definition psychosoziale Gesundheit.
2.1.3 Gesundheit im Arbeitskontext
2.2 Rechtslage Home-Office Österreich
2.3 Belastungs-Ressourcen-Gesundheits-Modell
2.3.1 Belastung und Beanspruchung
2.3.2 Stressoren und Ressourcen
3.
Methodischer Teil
3.1 Themenfindung
3.2 Erhebungsinstrument und Expertenauswahl
3.3 Leitfadenentwicklung
3.4 Datenschutz
3.5 Durchführung der Interviews
3.6 Transkription
3.7 Auswertungsmethode Phase 1
3.7.1 Formulierung eines Mottos
3.7.2 Zusammenfassende Nacherzählung
3.7.3 Stichwortliste
3.7.4 Themenkatalog
3.7.5 Paraphrasierung
3.7.6 Zentrale Kategorien
3.8 Auswertungsmethode Phase 2
3.8.1 Synopsis
3.8.2 Verdichtung
3.8.3 Komparative Paraphrasierung
4.
Darstellung der Ergebnisse
4.1 Soziale Faktoren
4.1.1 Team- und Zugehörigkeitsgefühl
4.1.2 Soziale Unterstützung und Kontakte
4.1.3 Orientierung an Dritten
4.2 Führungsspezifische Faktoren
4.2.1 Vertrauen
4.2.2 Kontaktaufnahme
4.2.3 Feedbackkultur
4.2.4 Beziehungsaufbau
4.2.5 Kommunikation
4.2.6 Wir-Gefühl
4.2.7 Wertschätzung und Anerkennung
4.2.8 Motivation
4.3 Personale Faktoren
4.3.1 Selbstorganisation
4.3.2 Individuelle Lebensverhältnisse
4.3.3 Individualität des Menschen
4.3.4 Räumlichkeiten und Ergonomie
4.3.5 Entgrenzung
4.3.6 Handlungsspielraum
4.3.7 Reflexionsverhalten
4.4 Organisationale Faktoren
4.4.1 Einsatz von Home-Office
4.4.2 Konzept und Unterstützung des Betriebs
4.4.3 Technische Unterstützung
4.4.4 Zugang und Nachvollziehbarkeit von Informationen
4.4.5 Mehrarbeit im Home-Office
4.4.6 Erreichbarkeit im Home-Office
5.
Diskussion der Ergebnisse
5.1 Verknüpfung mit der Theorie
5.2 Handlungsempfehlungen
5.2.1 Einsatz von Home-Office
5.2.2 Vereinbarung der Rahmenbedingungen
5.2.3 Technische Unterstützung und Arbeitsmittel
5.2.4 Arbeitszeitgestaltung
5.2.5 Informationsbereitstellung
5.2.6 Kommunikation und Feedbackkultur
5.2.7 Soziale Unterstützung und Rückhalt
5.2.8 Entwicklungsförderung
5.2.9 Struktur und Routine
5.2.10 Gemeinsame Reflexion
6.
Conclusio
6.1 Fazit
6.2 Reflexion
6.3 Limitationen
6.4 Ausblick und weiterführende Forschungsfelder
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
AOK ............................. Allgemeine Ortskrankenkasse
AZG ............................................... Arbeitszeitgesetz
COVID-19 ........................... coronavirus disease 2019
EDV ......................... Elektronische Datenverarbeitung
ILO ........................ International Labour Organization
IT ............................................. Informationstechnik
MCI ........................... Management Center Innsbruck
OSHA ... Occupational Safety and Health Administration
RIS .................. Rechtsinformationssystem des Bundes
unv. .................................................. unverständlich
VBG ................................ Vertragsbedienstetengesetz
vgl. ......................................................... vergleiche
WHO ............................. Weltgesundheitsorganisation
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ressourcen als Puffer zwischen Belastung und Beanspruchung
Abbildung 2: vereinfachtes Belastungs-Ressourcen-Gesundheits-Modell
Abbildung 3: Auszug Transkription
Abbildung 4: Beispielvorlage Zeiterfassung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Ressourcenkategorien
Tabelle 2: Checkliste „Abklärung der Rahmenbedingungen für Home-Office“
1 Einleitung
Home-Office wurde aufgrund COVID-19 zwangsläufig eine wichtige Arbeitsform in Unternehmen. Dies zeigt eine Studie von Deloitte, der Universität Wien und der Universität Graz, welche im Zeitraum April bis Mai 2020 durchgeführt und bei der 300 Unternehmen in Österreich befragt wurden. Während Home-Office vor der Pandemie in 75 % der Unternehmen in Österreich nur von vereinzelten Personen in Anspruch genommen wurde, gaben während des Lockdowns 80 % der Unternehmen an, dass die Mehrheit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause aus arbeitet (Kellner, Korunka & Kucibek, 2020, S. 4). Auch eine Studie des Fraunhofer Instituts in Kooperation mit der deutschen Gesellschaft für Personalführung, bei welcher sich 500 deutsche Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen beteiligten, bestätigt die Relevanz der Thematik. Dabei gaben 70 % der Befragten an, dass das Personal beinahe komplett oder zum größten Teil im Home-Office tätig ist (Hofmann, Piele & Piele, 2020, S. 6).
Wann die Arbeitswelt wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren kann, ist derzeit nicht abschätzbar. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine hybride Form zwischen arbeiten im Home-Office und in Präsenz-Tagen vor Ort entwickeln wird (Alipour, Falck & Schüller, 2020, S. 36). Zu diesem Schluss kommt auch eine weitere Studie des Fraunhofer Instituts, bei der 42 % der Teilnehmenden angaben, das Home-Office Angebot von Unternehmensseite aus zu vergrößern. 39 % sind sich einig, dass zukünftig mehr Beschäftigte Home-Office einfordern werden und 52 % stimmen voll und ganz zu, dass diese Forderung aufgrund der bewiesenen Machbarkeit in den letzten Monaten nicht mehr leicht auszuschlagen sein wird (Hofmann et al., 2020, S. 10-11).
1.1 Problemstellung
Home-Office wird häufig synonym zu Telearbeit oder mobile working (auch genannt remote working) verwendet. Sowohl bei mobile working als auch bei Home-Office handelt es sich jedoch um eine mögliche Form der Telearbeit. Während bei mobile working von jedem Standort aus gearbeitet werden kann, wird die Arbeit bei Home-Office unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zu Hause verrichtet (Nicolai, 2018, S. 259 & 263).
Bereits vor der Pandemie haben sich Institutionen und Einzelpersonen im Zuge der Arbeitswelt 4.0 und der fortschreitenden Digitalisierung mit den Vor- und Nachteilen von Home-Office auseinandergesetzt. Eine Befragung von etwa 2.000 Beschäftigten im Alter zwischen 16 und 65 Jahren aus dem Jahr 2019 von Seiten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK und des AOK-Bundesverbands (2019, S. 1-2) ergab, dass Home-Office zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führt, da es autonomeres und konzentrierteres Arbeiten als im Büro ermöglicht. Zeitgleich zeigte die Studie die damit einhergehende psychische Belastung auf. Personen, die von zu Hause aus tätig sind, leiden demzufolge öfter an Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafmangel und Erschöpfung als jene, die direkt im Unternehmen arbeiten. Zudem sind Emotionen wie Verärgerung, Lustlosigkeit, Nervosität und Reizbarkeit im Home-Office stärker ausgeprägt.
Nicolai (2018, S. 260) verweist zudem auf den Aspekt der sozialen Isolation. Beschäftigte im Home-Office verlieren den persönlichen Kontakt zu ihren Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen, was zu einem Defizit an Identifikation mit dem Unternehmen und dessen Zielen führen kann.
2017 veröffentlichten ILO und Eurofound Forschungsergebnisse aus fünfzehn Ländern, die sich mit verschiedenen Formen der Telearbeit befasst haben. Wurden beispielsweise ebenfalls Autonomie und Flexibilität als positive Effekte im Home-Office hervorgehoben, so zeigten die Ergebnisse, dass die Beschäftigten zu deutlich längeren Arbeitszeiten neigen als im Betrieb. Ebenso wurde auf die negative Auswirkung der Überschneidung von Privat- und Berufsleben und des daraus höher resultierenden Stresslevels für von zu Hause aus Arbeitenden hingewiesen (Boehmer et al., 2017, S. 57-58). Diese Erkenntnis wird auch von Landes, Steiner, Utz und Wittmann (2020, S. 49) aufgegriffen. Stressbedingte Krankheiten und damit einhergehende Fehltage steigen. Darum ist es essenziell, dass der Arbeitsalltag im Home-Office sowohl von Unternehmensseite als auch von Angestelltenseite aus gesundheitserhaltend gestaltet wird.
Die Literaturrecherche ergab, dass es keine allgemeingültige Definition von (psychosozialer) Gesundheit gibt. Gesundheit wird oft gleichgesetzt mit Abwesenheit von Krankheit, wenngleich die WHO anerkannt hat, dass diese vielfältiger betrachtet werden muss. Ein besonderes Augenmerk soll dementsprechend auf psychosoziale Faktoren gelegt werden, da diese Gesundheit und Krankheit stark beeinflussen (Heim, 1986, S. 282). Wurde bisher erforscht, dass Home-Office zu einer erhöhten Produktivität (Grunau, Ruf, Steffes & Wolter, 2019, S. 4) und Effizienz (Bloom, Liang, Roberts & Ying, 2015, S. 189-190) führt, werden psychosoziale Aspekte in der Literatur deutlich weniger behandelt.
Eine Erhebung durch Lenhardt (2017, S. 6 & 9) zeigt, dass Unternehmen sich selten mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz auseinandersetzen. Wird die Thematik der Psyche aufgegriffen, dann häufig unter dem Aspekt psychischer Störungen oder Erkrankungen, nicht in Form von arbeitsbedingten psychischen Belastungen. Begründet wird dies durch eine starke Unsicherheit auf Unternehmensseite, da diese die Problematik selbst sowie den angemessenen Umgang mit dieser nicht verstehen. Eigentliche Problemursachen werden häufig nicht erkannt.
Negative psychosoziale Auswirkungen von Home-Office Arbeitenden können sich nicht nur schädlich auf die Beschäftigten, sondern das Unternehmen selbst auswirken. Höhere Kosten, fehlende Loyalität, sinkende Motivation und Krankheit sind mögliche Folgen (Holdsworth & Mann, 2003, S. 207–208). Die aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts bestätigt, dass von Seiten der Unternehmen Handlungsbedarf besteht. Über 70 % der befragten Unternehmen sehen das Setzen von Maßnahmen und Strategien, um Entgrenzungserscheinungen entgegenzuwirken sowie die gesundheitlichen Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Auge zu behalten, als wichtig, aber derzeit noch nicht etabliert. Es wird betont, dass die Themen Arbeitszeiten, Selbstmanagement und Führung im Kontext flexibler Arbeitsmodelle aktiv erforscht und gestaltet werden müssen (Hofmann et al., 2020, S. 18).
Aufgrund seiner Aktualität und der damit einhergehenden Herausforderungen bedarf das Thema Home-Office erhöhter Aufmerksamkeit. In der gegenwärtigen Literatur finden sich mehrere Forschungslücken. Es ist wissenschaftlich nicht erforscht, inwieweit sich freiwilliges Home-Office von notgedrungen eingeführtem Home-Office in Hinsicht auf die Gesundheit der Betroffenen unterscheidet. Ebenso ist nicht ausreichend ergründet, wie es jenen Mitarbeitenden geht, die ihr Berufs- und Familienleben getrennt haben möchten und es aufgrund äußerer Umstände nicht können. Auch die Wirkung der derzeit fehlenden, gesetzlichen Rahmenbedingungen im Home-Office auf die Beschäftigten ist ungeklärt. Allgemein stellt sich die Frage, wie sowohl der Arbeitsalltag als auch die Arbeitsbedingungen im Home-Office gesundheitserhaltend gestaltet werden können.
1.2 Forschungsfrage und Forschungsziel
Wie die Problemstellung erkennen lässt, hat Home-Office aufgrund COVID-19 einen großen Part in der Arbeitswelt eingenommen und wird in vielen Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr vollständig wegzudenken sein. Jedoch zeigt sich großer Nachholbedarf hinsichtlich der psychosozialen Gesundheit von Arbeitenden im Home-Office. Im vorliegenden Werk soll somit die nachfolgende Forschungsfrage beantwortet werden:
„Welche Faktoren der Arbeitsgestaltung beeinflussen die psychosoziale Gesundheit von Beschäftigten im Home-Office?“
Mittels Experteninterviews wird erforscht, welche Faktoren der Arbeitsgestaltung Einfluss auf die psychosoziale Gesundheit der Beschäftigten im Home-Office haben. Forschungsziel ist es, anhand der daraus resultierenden Untersuchungsergebnisse gezielte Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeitenden hinsichtlich ihrer psychischen und sozialen Gesundheit bestmöglich im Home-Office begleiten und unterstützen können.





























