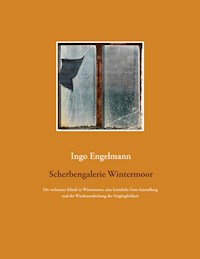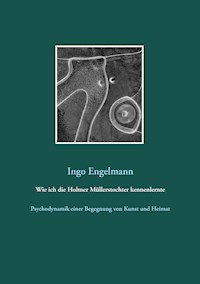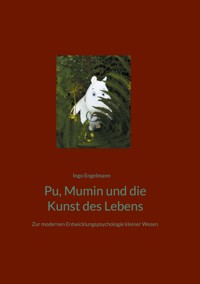
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Lebenskunst von Pu-Bär und den Mumintrolls ist legendär. Sie zeigen dabei wesentliche Merkmale der modernen Entwicklungspsychologie, insbesondere Mentalisierungsaspekte tauchen immer wieder auf. Anhand einer Fülle von Textpassagen mit psychologischen Verknüpfungen zeigt der Autor die Lebenskunst dieser kleinen Wesen aus den bekannten Kinderbüchern von A.A. Milne und T. Jansson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn Pu der Bär mit seinen Freunden aus dem Hundertmorgenwald Abenteuer sucht oder vermeidet, dann macht er das in aller Regel völlig unbedacht und doch mit großer Tiefe. Das passiert ihm einfach so. Es liegt an uns, ob wir daraus Lehren ziehen wollen oder Wurzeln, darüber nachdenken oder uns einfach daran erfreuen. Hier werden erfreuliche Momente herausgegriffen und mögliche Gedanken darüber angedeutet. Wir begegnen modernen Gedanken zu entwicklungspsychologischen Schritten – Mentalisierung, Spiegelung und ähnlichen Unbekannten.
Nach den Pu-Geschichten geht es um die Mumins im Mumintal und umzu. Auch hier geht es um die eingewobene Psychodynamik. Man kann sich über das Leben viele Gedanken machen–oder einfach leben.
Psychologie handelt vom Leben und von Denken und Fühlen. Immer wieder mal kommt die von Therapeuten erdachte Mentalisierungstheorie ins Spiel, die Pu und Mumin vielleicht gefallen hätte, wenn es die zu ihrer Zeit schon gegeben hätte. Einige der Fachbegriffe werden im Glossar am Ende erläutert. Manchmal werden Dinge, die man beim Lesen nicht versteht, erst später erläutert. Manchmal aber auch gar nicht.
*
Ingo Engelmann, geboren 1951, hat als Psychologischer Psychotherapeut und Musiktherapeut jahrzehntelang in der Psychiatrie gearbeitet. Seine Doktorarbeit hat er über Musiktherapie in der stationären Behandlung psychiatrischer Patienten verfasst („Manchmal ein bestimmter Klang“, 2000). Seit vielen Jahren fotografiert er und hat über seine Projekte einer psychodynamisch orientierten Fotografie mehrere Bücher geschrieben („Wie ich die Holmer Müllerstochter kennenlernte. Psychodynamik einer Begegnung von Kunst und Heimat.“ Norderstedt 2019 und „„Scherbengalerie Wintermoor. Die verlassene Klinik in Wintermoor, eine heimliche Foto-Ausstellung und die Wiederentdeckung der Vergänglichkeit.“ Norderstedt 2020). Eine Auswahl seiner Fotos sieht man in dem seit 2012 kontinuierlich geführten Foto-Tagebuch „BilderBlog“ (www.ingoengelmann.jimdo.com).
Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt: Pu der Bär und die Mentalisierung
1.1. Pu der Bär und die Gemeinschaft im Hundertmorgenwald: eine kleine Charakterkunde zur Einführung
1.2. Zweites Kapitel (in dem die Realität besonders schwer erkannt wird, weil man gerade mittendrin steckt)
1.3. Drittes Kapitel (in dem es um eine zentrale Frage geht: Wer bin ich – und muss das unbedingt sein?
1.4. Viertes Kapitel (Ambiwalenz und Pohlarität verstehen)
1.5. Fünftes Kapitel (in dem es um das Fühlen geht, und um sein Gegenteil: Ich fühle mich heute gar nicht)
1.6. Sechstes Kapitel (in dem es um das Wechselspiel zwischen Fremdheit und Kultur geht)
1.7. Siebentes Kapitel (oder: Wenn der Apfel fällt – wo ist dann der Stamm?)
1.8. Letztes Kapitel im ersten Abschnitt (in dem erklärt wird, dass Entwicklungen die Menschen schon immer mehr bewegt haben als Verwicklungen, und ein Missverständnis aufgeklärt wird)
2. Abschnitt: Mental Mumin oder "Total durch den Wind - aber das sind die meisten, die wir kennen"
2.1. Neuntes Kapitel (in dem wir die Muminfamilie und ihre Freunde noch näher kennen lernen)
2.2. Zehntes Kapitel (in dem beschrieben wird, wie man in der Welt ruht – die Muminmutter zum Beispiel)
2.3. Elftes Kapitel (in dem es auch darum geht, wie man sich an der Wirklichkeit abarbeiten muss, vor allem als Vater)
2.4. Zwölftes Kapitel (in dem wir sehen, dass man seinen Weg gehen muss, und Mumin geht schon mal los)
2.5.. Dreizehntes Kapitel (in dem noch mehr Freunde auftreten und jeder ein kleines Kunststück zeigt)
2.5.1.Die narzisstischen Seepferdchen
2.5.2. Dilemma zwischen Als-ob und Äquivalenz: Homsa feat. die Kleine Mü
2.5.3. Die Mymla, die Tochter der Mymla und die Kleine Mü
2.5.4. Das Snorkfräulein und der Kopfstand
2.5.5. Die Misa
2.5.6. Tofsla und Vifsla: Gästsla willkommseln!
2.6. Vierzehntes Kapitel (in dem verschiedene Arten von Entwicklungen vorkommen - auch welche von Namen)
2.6.1. Hemul zu sein ist nicht so einfach (ein Therapiebeispiel)
2.6.2. Die Filifjonka im Sturm )
2.6.3. Überhaupt jemand zu sein ist auch nicht leicht (Ti-ti-uu)
2.6.4. Vom Werden des Eichhörnchens
2.6.5. Onkelschrompel kehrt heim
2.6.6. Hunde und Wölfe (Knick)
2.7. Fünfzehntes Kapitel (in dem das Zusammenleben im Mumintal so etwas wie eine Ordnung erhält)
2.7.1.Weg und Zeit
2.7.2. Gastfreundschaft, Weihnachten und andere Rituale
2.7.3. Die Morra, das Reden und das Fühlen
2.7.4. Bühne als Bild: Das Theater
2.8. Nachbemerkung: Nicht der kürzeste, sondern der schönste Weg
3. Glossar, Literatur
Erster Abschnitt: Pu der Bär und die Mentalisierung
1.1. Pu der Bär und die Gemeinschaft im Hundertmorgenwald: eine kleine Charakterkunde zur Einführung
Pu der Bär
Ist die Hauptperson der Geschichten: ein Bär von geringem Verstand, wie er selbst sagt, aber mit einem riesigen Herzen (und einem kaum einmal wirklich gestillten Hunger auf Honig oder Waffeln mit Kondensmilch). Pu ist uneigennützig bis zur Selbstaufgabe, ein ehrliches Fell und in seiner unaufgeregten Art von solch umwerfender Gewitztheit, dass er immer wieder aufregende Entdeckungen macht. Meistens kann er nichts dazu. Und oft wird ein großartiges Gesumm daraus, oder ein Tideldei, jedenfalls ein Pu-Lied.
Christopher Robin
Ist Pus bester Freund und auch die Hauptperson der Geschichte (denn ihm werden die Pu-Geschichten ursprünglich erzählt, in denen er auch selbst immer mitspielt). Chistopher Robin ist Schutz und Rückhalt in allen Lebensfragen, er kann lesen und überhaupt wäre ohne ihn alles nicht möglich.
Ferkel
Ist ebenfalls Pus bester Freund und in einigen Geschichten des Buches ist es sogar die Hauptperson. Ferkel ist klein, eigentlich rosa und wäre gern etwas mutiger. Aber dadurch kann es die Großen umso besser bewundern, das ist auch schön. Und ohne Ferkel als Gegenüber würde Pu auf die besten Ideen auch gar nicht kommen, also ist Ferkel eigentlich noch mehr Hauptperson als schon angegeben.
Kaninchen
Findet, dass es die Hauptperson ist, aber darüber besteht keine einheitliche Meinung. Kaninchen organisiert sämtliche Suchaktionen, wobei es nicht verhindern kann, dass trotzdem ab und zu jemand gefunden wird. Das passende Kleidungsstück für Kaninchen wäre eine geblümte Kittelschürze. Noch Fragen?
Oile
Ist eine Eule. Sie erzählt lange, lange Geschichten über irgendwelche entfernten Verwandten, die keiner kennt, und ermöglicht damit manchem ein erquickendes Nickerchen. Oile kann schreiben, jedenfalls findet Pu das. Sie kennt komplizierte Wörter, die aber im Hundertmorgenwald eigentlich keiner braucht. Schade.
Känga und Klein-Ruh
Sind das Familienähnlichste, was im Hundertmorgenwald zu finden ist (abgesehen von den Kleinwuslern). Känga ist eine großartige Übermutter, worauf aber keiner wirklich achtet und es ihr also auch nicht übelgenommen wird. Klein Ruh macht immer wieder verbotene Dinge, die dann plangemäß schiefgehen, das ist immer ein Hauptspaß.
Tieger
Kommt als letzter in den Wald, und keiner versteht ihn so richtig, ihn selbst eingeschlossen. Seine Worte versteht man schon, aber warum er immer so angibt, so viel Wind macht, und wen er damit eigentlich beeindrucken will (vielleicht sich selbst?) weiß keiner so genau. Tieger ist auf seine Art (wie eigentlich alle im Hundertmorgenwald) unglaublich zuverlässig. Man muss nur hinterher herausfinden, was man von ihm wollte.
Pu der Bär
1.2. Zweites Kapitel (in dem die Realität besonders schwer erkannt wird, weil man gerade mittendrin steckt)
Hier kommt nun Eduard Bär die Treppe herunter, rumpeldipumpel, auf dem Hinterkopf, hinter Christopher Robin. Es ist dies, soweit er weiß, die einzige Art treppab zu gehen, aber manchmal hat er das Gefühl, als gäbe es in Wirklichkeit noch eine andere Art, wenn er nur mal einen Augenblick mit dem Gerumpel aufhören und darüber nachdenken könnte. Und dann hat er das Gefühl, dass es vielleicht keine andere Art gibt. (13) 1
So beginnt das erste Buch, und so lernen wir Pu kennen: als einen fühlenden Bären. Eduard Bär, das ist nämlich Pu. Er hat einen ganz offiziellen Namen, der in sämtlichen amtlichen Papieren stehen würde, wenn ihm nur einfiele, wozu er die benötigen könnte, und dieser amtliche Name ist Eduard Bär. Bis herausgefunden ist, wozu er den braucht, wird sein offizieller Name so gut wie nie auftauchen und wird immer nur sein Alltagsname benutzt, und der ist Pu. Eduard Bär kann ja beinahe jeder heißen, es gibt allein in Deutschland Dutzende: einer lebt in Mittelfranken, einer in Sulzbach-Rosenberg, einer im Nassauischen und wo sonst noch überall. Christopher Robin hatte mal einen Schwan, den er Pu genannt hatte.
Das war vor langer Zeit, und als wir uns verabschiedeten, haben wir den Namen mitgenommen, weil wir nicht glaubten, dass der Schwan ihn noch wollte. (11)
Und weil Eduard Bär einen aufregenden Namen ganz für sich allein wollte, nannte Christopher Robin ihn „Pu“.
Im Augenblick nimmt ihn seine Realität, die stufenbedingte Traumatisierung, dieses Absteigende-Treppen-Syndrom (ATS) schon sehr gefangen. Aber er lässt sich nicht hindern, das Gefühl zu erahnen, es gebe da auch noch eine andere Realität, weniger stufig, vor allem weniger traumatisierend für den Hinterkopf. Aber wie auch immer, bei einem derartigen Gerumpel kann man sich nur schwer aus der derzeitigen Realität rausfühlen.
Schon in dieser frühen Szene werden wir darauf hingewiesen, dass Pu ein Bär ist, der sich in vielen Phasen seines Tageslaufs in einer Verfassung befindet, die ein kleines Kind im ersten Lebensjahr gut kennt (und die wir alle später immer mehr vergessen, auch wenn wir alle mal da durch mussten). Pu befindet sich auf den (Entwicklungs-) Stufen seines Treppen(ab)ganges im Zustand der primären Repräsentation. Diese Phase frühkindlicher Entwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass unspezifische (in der Regel körperlich begründete) Gefühlszustände vage wahrgenommen werden: da stimmt was nicht (und das kann dann Hunger sein, Kälte oder ein zwischen den Stäben des Gitterbettchens eingeklemmter Körperteil – ein ähnliches Dilemma werden wir bei Pu noch kennen lernen, s. Kapitel 4). Die Reaktion der kleinen Person ist ebenso unspezifisch wie der auslösende Zustand: es wird gebrüllt. Die Eltern werden schon herausfinden, was im Einzelnen denn nun los ist. Das ist eine der ersten und nicht unwichtigsten Elternaufgaben: herauskriegen, warum der kleine Kerl bzw. die Prinzessin schreit. Das hat eine ganz pragmatische Seite, damit es wieder eine Ruhe gibt. Viele Eltern lieben Ruhe. Das hat aber auch noch andere Seiten, die nicht so ins Auge fallen, aber eher noch wichtiger sind. Zum Beispiel: Eltern signalisieren dem kleinen Kind durch Erledigung der „1. Elternaufgabe“, dass es ein Gefühl empfindet. Das Kind kann dieses Gefühl nicht zuordnen, weil es noch keine Ahnung hat, was das ist: ein Gefühl. Aber die Eltern können herausfinden, um welches Gefühl es sich im Rahmen des Eltern-Gefühls-Kategorien-Katalogs handelt. Sie werden dann dem Kind spiegeln, worum es wohl gehen mag, und dabei vielleicht mitteilen, worum es ihrer Meinung nach geht: du hast ja Hunger, und das ist wirklich völlig gerechtfertigt, weil die letzte Mahlzeit schon geschlagene fünf Stunden her ist, und überhaupt ist die Zeit nicht so wichtig, wann man zuletzt was gegessen hat, sondern wer Hunger hat, der hat recht. Na komm, hier ist das Fläschchen. Das Kind also brüllt, und die Eltern spiegeln. Aber man beachte: Pu ist kein Baby. Er geht auf Bärenart vor. Er brüllt nicht, er denkt (oder tut das, was in seinem kleinen Kopf diesem Vorgang am nächsten kommt). Er hätte es auch bleiben lassen können, denn allzu oft kommt er damit nicht weit. So ist das in diesem Stadium des Körperbewusstseins leicht mal, aber das wird sich ändern, später.
Mit der Wahrnehmung und emotionalen Verarbeitung der Realität hat man es also zunächst mal schwer, wie wir sehen. Man kennt sich erst langsam damit aus, nach und nach, und man kann jede Hilfe dabei brauchen. Als Pu einmal (wie immer) Honig braucht und eine Strategie entwickelt, wie er welchen stibitzen kann, fragt Christoph-Robin ihn, ob ihn die Bienen bemerken werden.
„Vielleicht, vielleicht auch nicht,“ sagte Winnie-der-Pu. „Bei Bienen kann man nie wissen.“ Er dachte einen Augenblick nach und sagte: “Ich werde versuchen wie eine kleine schwarze Wolke auszusehen. Das wird sie täuschen.“ (23)
Und im weiteren Verlauf des Projektes teilt er Christopher Robin mit:
„Ich habe den Eindruck, dass sie argwöhnisch sind!“ „Vielleicht glauben sie, dass du hinter ihrem Honig her bist?“ „Daran könnte es liegen. Bei Bienen kann man nie wissen.“ (25)
In Pus Welt sind Vorstellungen wie „der andere“ und dessen mentale Verfassung in diesem Moment noch nicht angekommen: Pu ist zur Entwicklung seiner Strategie darauf angewiesen, sich was einfallen zu lassen und die Wirkung seines Planes experimentell zu erproben. Dabei stößt er schnell auf Paralleluniversen, in denen andere existieren, deren voraussichtliche Verhaltensweisen man nicht so genau ermessen kann. Hier geht es um das Paralleluniversum der Bienen, die man zu täuschen versuchen kann, aber ob es klappt, weiß keiner vorher, denn, bedenke: „Bei Bienen kann man nie wissen“.
In diesem Stadium liegen (noch) keine ausreichenden Kenntnisse darüber vor, wie mein Gegenüber funktioniert. Ich muss äußere Merkmale sammeln, Beobachtungen speichern, Einzelerfahrungen katalogisieren. Daraus kann ich dann mit einiger Wahrscheinlichkeit schlussfolgern, was als nächstes passieren wird. Ich habe zwar in diesem Stadium noch keine Ahnung, warum das passiert, wie das innen drin zusammenhängt, aber ich weiß, was aus der black box herauskommt, wenn ich zum Beispiel eine Attacke auf den Honig der Bienen starte. Psychologen nennen dieses Stadium „teleologisch“.
Neben dem wunderbaren (Honig!), aber unverständlichen (bei Bienen weiß man nie!) Kosmos der Bienen gibt es zahllose weitere Paralleluniversen. Das Wesen der Wuschels und ihrer Pfotenabdrücke beispielsweise bereitet Pu Kopfzerbrechen. Einmal wandert Pu um ein Buschgestrüpp und folgt den Spuren im Schnee. Ferkel fragt ihn, ob er einem Wuschel folge.
„Könnte sein“, sagte Pu. Manchmal ist es das und manchmal ist es das nicht. Bei Pfotenabdrücken kann man nie wissen.“ (44)
Das macht die Welt spannend, aber auch unheimlich: mysteriöse Wesen folgen mysteriösen Lebensplänen, und ob sie dabei bedrohlich oder freundlich sein werden, bleibt zu oft offen (ich denke an Ferkels bibberndbange Frage zum Thema Heffalump: „Kam es, wenn man pfiff? Und - wie kam es?“).
Die Suche nach den Wuschels ist noch in einem anderen Blickwinkel ganz interessant. Pu folgt den Spuren im Schnee, die er nicht genau zuordnen kann, und fragt sich, ob er da wohl einem Wuschel auf der Spur ist. Als er zum zweiten Mal um das Gebüsch herum gegangen ist, sind da plötzlich zwei Spuren. Ist er also zwei Wuschels („wenn es denn eins ist“) auf der Spur? Pu hat nur eine ungefähre Ahnung von Wuschels, irgendwie muss er früher mal was von Wuschels mitbekommen haben, was er jetzt in die Verfolgung der unbekannt wirkenden Spuren einfließen lässt. Das sind „Übertragungsspuren“, wie der Therapeut sagt, also Spuren von etwas, was wir von früher kennen und was sich in die aktuelle Erlebniswelt einfügt. Man weiß dann manchmal nicht so genau, was gerade aktuell los ist und was aus früheren Erlebnissen einfließt und sich mit der gerade herrschenden Realität mischt. Man verliert da leicht den Überblick. Christopher Robin hat es in der Pfotenabdruck-Szene besser: er sitzt auf dem Baum und beobachtet Pu von oben und erkennt, dass der seinen eigenen Spuren im Schnee folgt. Er kann von seinem Überblicksposten her einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die augenblickliche Realität dingfest zu machen. Später wird man in ähnlichen Situationen, in denen man es mit Übertragungsspuren zu tun hat (zum Beispiel wenn es früher mit der Mutter schwer war und sich das immer wieder in die aktuelle Spurensuche einmengt) für die Klärung einen Psychotherapeuten bemühen: der sitzt dann auf dem Baum und hat so einen besseren Überblick.
Nicht immer sind die Grenzen zwischen der unbelebten Natur und den lebenden Wesen samt ihrem Innenleben genau zu ziehen. Die psychologische Theorie ist da aber ganz streng. Zu den in der „Theory of Mind“ (ToM) beschriebenen erwachsenen Fähigkeiten gehört, dass man zwischen belebt und unbelebt unterscheiden kann, wenn man ein halbwegs vernünftiges Wesen mit einem (wenn vielleicht auch mäßig ausgeprägten) Verstand ist. Pu hat da noch ein gutes Stück des Weges vor sich: im obigen Textausschnitt ist er sich (ToM-widrig) nicht so sicher, welche finsteren Absichten diese Pfotenabdrücke im Schilde führen. Man kann nie wissen. Auch Pfotenabdrücke führen ein Eigenleben, man nimmt sich da besser in Acht.
Etwas Vergleichbares erlebt Pu, als er gerade mit der Fremdheit befasst ist, die in Gestalt des kleinen Tieger in den Wald einbricht. Wie soll man aus jemandem schlau werden, der immer angibt wie drei Pfund Schmierseife, dessen Behauptungen aber sämtlich nicht haltbar sind (und dem das dann auch noch überhaupt nichts ausmacht)? Als Pu nach etlichen Verwicklungen mit Tieger zu Känga kommt, um dem neuen Waldbewohner Tieger dort endlich ein Frühstück zu verschaffen, fühlt er sich gleich mit eingeladen. Das gibt Sicherheit.
Und er fand eine Büchse Dosenmilch, und irgendetwas schien ihm zu sagen, dass Tieger sowas nicht mögen, weshalb er sie in eine stille Ecke trug und sich vorsichtshalber dazusetzte, damit sie von niemandem gestört werden konnte. (192)
Die Dosenmilch war einverstanden, und nachdem Pu sich so um sie gesorgt hatte und ihr Einverständnis fand, wurde es noch ein ganz wundervoller kleiner Imbiss. Es steht jedoch zu befürchten, dass ToM sagt: wenn man erwachsen werden will, macht man so etwas nicht - so tun, als wenn die Milch auf Augenhöhe mit einem kommuniziert und man sie gleichzeitig schützen muss wie ein kleines Baby. Das ist ja kindisch. Mit erwachsener Strenge wird einem verboten, in den paradiesischen Zustand zurückzukehren, wo alles noch miteinander verbunden war und sich austauschte, egal ob belebt oder unbelebt. In diesem Zustand verschwimmt alles, wie in einem Ozean, man nennt ihn deshalb auch „ozeanisch“ (Das Unbehagen in der Kultur, Freud 1930). Die Rückkehr zu diesem Zustand wird dann als „regressiv“ bezeichnet, was dann regelmäßig einen leicht abwertenden Beiklang hat. ToM besteht darauf, dass zum Beispiel Kuschelpuppen nicht wirklich leben und allenfalls als Übergangsobjekt eine vorübergehende Bedeutung erlangen. Pu regrediert da dann doch gern mal in den Zustand der direkten Kommunikation mit der Milch und fühlt sich gleich wieder ganz zuhause, und das mit dem fremden kleinen Tieger und dessen Frühstück regelt sich auch noch zu aller Zufriedenheit.
Es macht also gar nichts, wenn man sich nicht immer gleich freiwillig nach den Theorien richtet, die die Psychologen über das Leben aufstellen. Die Mentalisierungstheoretiker sprechen vom oben bereits erwähnten Teleologie-Modus, in dem sich kleine Wesen (neben Ferkel und Bären beispielsweise auch kleine Menschen) im ersten Stadium ihrer Reifung bewegen. Da es noch keine Vorstellung von sich und den anderen als getrennte Wesen gibt, und schon gar nicht von den unterschiedlichen inneren (mentalen) Zuständen, in denen sich die unterschiedlichen Wesen befinden können, ist das kleine Wesen in der Abstimmung seiner Äußerungen mit denen des Gegenübers (z.B. einer Mutter) auf die äußeren, sichtbaren Merkmale angewiesen. Es ist logisch, dass die Mutter auf den Säugling reagiert, man würde da nichts anderes erwarten. Aber umgekehrt - wie kriegt der Säugling es hin, auf seine Mutter angemessen zu reagieren, und zwar differenziert und anscheinend sinngeleitet? Die teleologische (d.h. zielgerichtete) Haltung des Säuglings hilft ihm, aus dem praktischen Erleben eine quasi statistische Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, wie die Mutter funktioniert. Und das Ganze ohne jede Ahnung davon, wie dieser merkwürdige Apparat „Mutter“ eigentlich gebaut ist und was in der Mutter wohl innerlich ablaufen mag. Dieser teleologische Modus ist eine große Kunst, die jeden Tag ein kleines Schrittchen weiter perfektioniert wird, bis er dann durch neue, bahnbrechende Erkenntnisse über die Mutter und über sich selbst abgelöst werden kann. Und so reift man aus dem Teleologie-Modus langsam heraus und wird Schritt für Schritt erwachsen(er). Pu hat Glück, dass er zu Recht aus dem passiven Verhalten der Dosenmilch den Schluss zieht, dass sie nichts dagegen einzuwenden hat, von ihm als Imbiss behandelt zu werden. Eigentlich gilt im Teleologie-Modus: bei Milch kann man nie wissen…
Alles macht weiter, „die Nacht und der Morgen / der Abschied von Gestern / die Freuden und Sorgen / die Zwiebeln im Kühlschrank / Alles macht weiter“ (Blumfeld 2003). Das ist der Weg der Reifung. Pu hat sich zwar noch nicht eindeutig geäußert, wie es mit seiner Intention bezüglich des Erwachsenwerdens derzeit beschaffen ist. Gleichwohl trifft er doch auch Vorbereitungen dazu. Wir können ihn dabei beobachten. Im Reifungsprozess stellt es einen ganz wesentlichen Schritt dar, sich vorstellen zu können, dass man etwas sagt, was gar nicht stimmt, und damit probiert Pu schon mal herum.
Christopher Robin sagte beiläufig. “Heute habe ich ein Heffalump gesehen, Ferkel.“
„Was hat es gemacht?“, fragte Ferkel.
„Einfach so vor sich hin gelumpt“, sagte Christopher Robin. „Ich glaube nicht, dass es mich gesehen hat.“
„Ich habe auch mal eins gesehen“, sagte Ferkel. „Jedenfalls glaube ich, dass ich eins gesehen habe“, sagte es. „Aber vielleicht war es gar keins.“
„Ich auch“, sagte Pu und fragte sich, wie ein Heffalump wohl aussehen mochte. (63f)
Der Wunsch, ebenfalls ein Heffalump gesehen zu haben, wo doch Christopher Robin damit auftrumpfen kann, ruft die verwegensten Wahrnehmungen und Erinnerungen hervor. Oder geht es um Spiegelneuronen, diese kleinen Arbeitsplätze im Gehirn, wo uns das, was wir hören und sehen, als eigenes Erleben erscheint? Wenn wir jemanden in eine Zitrone beißen sehen, ist das Mit-Erleben so stark, dass auch unsere eigenen Speicheldrüsen zu arbeiten anfangen. Ja es reicht schon, sich das Ganze nur vorzustellen (manchmal reicht es schon, davon zu lesen, und der Speichelfluss beginnt – merken Sie es schon?). So könnte man sich also vorstellen, dass Pu von Christopher Robins Heffalump-Erzählung so ergriffen wird, dass er es für ein reales eigenes Erlebnis hält. Ist aber wahrscheinlich falsch, diese Spiegelneuronen-Erklärung. Hier geht es doch wohl schlicht und einfach darum, dass Pu lügt. Okay, Notlüge, könnte man gelten lassen, er möchte nicht als vollkommen ahnungslos gelten. Aber vielleicht ist auch ein wesentlicher Antrieb, dass er rumexperimentiert: mal sehen, was passiert, wenn man die Unwahrheit sagt und keiner merkt es (oder zumindest keiner was dazu sagt). Lügen kann weder der kleine Mensch noch der kleine Bär von Anfang an. Um lügen zu können, muss man innerlich ein Abbild von der Realität herstellen und es umkehren, sozusagen ein Negativ anfertigen. Das reale Abbild ist die Wahrheit, das Negativ die Lüge. Jetzt kann man zwischen beiden hin- und herspringen. Das kann unheimlich Spaß machen, hat aber auch seine Tücken.
Wahrheit und Lüge sind aber längst nicht immer so kategorial gegeneinandergestellt, wie es dem Durchschnittskonfirmanden vorgegaukelt wird. Immer wieder verschwimmen die Grenzen im Niemandsland der verharmlosenden Scheinerklärungen oder verschleiernden Ausreden.
„Meine Rechtschreibung ist nämlich etwas wacklig. Sie ist eine gute Rechtschreibung, aber sie wackelt und die Buchstaben geraten an den falschen Ort.“ (85)
…erklärt Pu Eule, als er sie bittet, ihm beim Geburtstagsgruß für I-Ah behilflich zu sein, und er kann doch weder schreiben noch lesen, nur das P kann er erkennen und denkt dann jedes Mal, das müsse wohl „Pu“ heißen, und also sei er gemeint, auch wenn dort „Pudel“ steht, „Pubärtät“ oder „Pusteblume“. Genauso ein Wackelbild entdeckt man auch bei „ToM“, dem Abkürzungs-Vornamen der „Theory of Mind“. Nicht jede Theorie hat einen so schönen Vornamen, und nicht bei jeder Theorie sind die Buchstaben so wacklig, dass am Ende des Vornamens ein großer Buchstabe landet, obwohl es doch gar keine Großschreibung am Ende eines Wortes gibt. Es ist nicht direkt ein verkehrter Buchstabe am falschen Ort, aber eben doch mächtig wacklig, diese „M“ am Ende von „ToM“. Es muss Pu also nicht peinlich sein, das Wackelbild, wenn große Theorien genauso wackeln, zumindest beim Vornamen.
Auch Ferkel kennt im Niemandsland zwischen unwahr und wahr die grundsätzlichen Unwägbarkeiten, denen wir uns im Leben schon früh immer wieder ausgesetzt sehen.
Das Ferkel saß vor seiner Haustür auf der Erde, blies fröhlich in eine Pusteblume und fragte sich, ob es wohl in diesem Jahr sein würde, im nächsten Jahr, irgendwann oder nie. Es hatte gerade entdeckt, dass es nie sein würde, und versuchte, sich zu erinnern, was „es“ war und hoffte, dass es nichts Schönes war, als Pu erschien. (115)
Ferkel ist in diesem Spiel ganz versunken: abgesunken in eine Sphäre frühkindlichen Seins, als Ursache und Wirkung noch keine enge Verbindung eingegangen waren, ozeanisch, primärprozesshaft (sagen die Psychoanalytiker) wie im Traum. In diesem Welterleben gibt es noch keine Lüge, weil das Eine so wahr ist wie sein Gegenteil. Da hilft nur Hoffen – oder sich auf ein geschmeidiges, flexibles Gleiten einlassen.
Da verfließt noch alles miteinander. In dem Schmelztiegel gibt es aber eine Tendenz, dass sich Ähnliches zusammenfindet und von Andersartigem differenziert wird. Es bilden sich Strukturen, und sie ermöglichen es, Unterschiede festzustellen. Später tritt der Unterschied in den Mittelpunkt, „jede Jeck es anders“ (Kölner Spruchweisheit). Die Ereignisse in dieser aufregenden Welt hinterlassen bei verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Spuren. Insofern ist die Verwicklung in die Realität immer kontextgebunden („es hängt davon ab“ – oder in Abwandlung eines Satzes von Pu: „Bei Wirklichkeiten weiß man nie“). Die Auswirkungen derselben realen Ereignisse sind nicht bei allen, die sie erleiden, objektiv und gleich. Die Unterschiede in der subjektiven Wahrnehmung und Verarbeitung spielen eine wesentliche Rolle in unserer Verständigung und unserem Umgang miteinander („Kommunikation“ und „Interaktion“). Fast alles baut auf den Unterschied auf. Wenn die Mutter frühe Äußerungen ihres Kindes (meist übertrieben) zurückgibt und somit spiegelt, baut sie kleine Unterschiede ein (Markierungen), damit der Säugling merkt: Es ist nicht die Mutter selbst, die hier spricht, sondern die Mutter-als-Spiegel-von-mir-kleinem-Kind führt mir vor, was meine eher banal (anfangs meist körperlich) empfundenen Bedürfnisse für eine tiefere Bedeutung haben können. Dieser Vorgang, der sich viele tausend Mal in den ersten Monaten oder den ersten anderthalb Jahren wiederholt, gehört zum Kern des Mentalisierungs-prozesses, in dessen Verlauf der kleine Mensch lernt, dass er ein eigenständiges, einziges Wesen ist, das sich von allen anderen (womöglich sogar von der eigenen Mutter) unterscheidet und sich Gedanken über sich selbst und sein Gegenüber machen kann: versteht er/sie mich? Was geht in ihm/ihr vor? Ist das vereinbar mit den Vorgängen in mir selbst? Usw.usw.
Die Entwicklung der Eigenheit (Subjektivität) ist ein zentraler Vorgang. Er trifft insbesondere diejenigen kleinen Wesen, die noch eine ganze Menge Wachstum vor sich haben (im Gegenteil zu denjenigen kleinen Wesen, die immer klein bleiben werden wie die meisten von Kaninchens Bekannten- und-Verwandten, überwiegend ziemlich kleine Wusel - aber auch kleine Wesen reifen). Diejenigen, die noch wachsen, haben echt noch ein ziemlich anstrengendes Programm vor sich - wenn sie das geahnt hätten… Aber auch die, die nicht mehr wachsen, die immer ein Teil der Wusel-Gemeinschaft bleiben werden, haben es nicht leicht. Was dabei rauskommen kann, sehen wir am Beispiel der Expotition, die Christopher Robin organisiert, samt Proviant für alle, und die zur Entdeckung des Nordpohls führen soll (darüber mehr im vierten Kapitel).
„Pst!“, sagte Christopher Robin und drehte sich zu Pu um. „Wir kommen gerade an eine gefährliche Stelle.“
„Pst!“, sagte Pu und drehte sich schnell zu Ferkel um.
„Pst!“, sagte Ferkel zu Känga. (…)
„Pst!“, sagte I-Ah mit einer schrecklichen Stimme zu Kaninchen sämtlichen Verwandten-und-Bekannten, und „Pst!“ sagten sie der Reihe nach bis ganz hinten zueinander, bis es den allerletzten erreicht hatte Und der letzte und kleinste Bekannte-und-Verwandte war so erschüttert davon, dass die gesamte Expotition „Pst!“ zu ihm sagte, dass er sich mit dem Kopf nach unten in einer Spalte im Boden vergrub und zwei Tage dort blieb, bis die Gefahr vorüber war, und dann in großer Eile nach Hause ging und mit seiner Tante ein stilles Leben führte, und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er heute noch. Er hieß Alexander Käfer. (119)
So entscheiden sich Schicksalswege, und aus all den kleinen Einzelschicksalen wird Wirklichkeit gewoben, und Geschichte... Alexander Käfer erlebt in dieser kleinen Szene hautnah etwas mitten aus dem mentalisierungsbasierten Therapiekonzept. Er gerät nämlich in eine emotionale hochaufgeladene Verfassung, die ihn erschüttert. Ob er mentalisieren will oder nicht (wenn er sich diese Frage denn überhaupt stellt) ist völlig egal – es geht nicht. Er kann nur noch aus der Situation aussteigen und gräbt sich dazu in den Boden ein, was eine ganz normale Käferreaktion auf emotionale Erschütterungen dieser Art ist. Menschen tun dies seltener, sie müssen andere Wege finden, aus dieser zu erregten Konstellation auszusteigen. Sie stellen bestimmte Hirnareale ab, gehen mit einzelnen Hirnarealen bezüglich der Umwelt „offline“, und zwar bevorzugt bei solchen, mit denen sonst kommuniziert, Realität geprüft und nachgedacht wird. Diese Bereiche im präfrontalen Kortex (der vorderen grauen Hirnrinde) werden ausgeschaltet, und andere Bereiche regeln das Weitere in internen Kreisbahnen innerhalb des Gehirns, die nicht mehr mit der umgebenden Realität rückgekoppelt werden: das Verhalten kann dann hysterisch wirken, bizarr und unsinnig oder schlicht unverständlich. Darüber kann man sich in dem Augenblick genauso wenig verständigen wie mit Alexander Käfer, wenn er kopfüber im Boden verschwunden ist (weg ist weg, ob körperlich oder mental). Dann muss man eine Zeitlang in diesem stand-by-Zustand bleiben (bei Alexander Käfer waren es zwei ganze Tage), ehe das Leben weitergehen kann.
Mentalisieren ist das Zuordnen von Bedeutungen zu emotionalen Wahrnehmungen bei mir und anderen, und es kann als eine Art Puffer genutzt werden, wenn mir Dinge zu nahe kommen und mich zu sehr aufregen. Alexander Käfer wäre es besser bekommen, wenn er über das „Pssst“ hätte sprechen können, um nicht zu sehr aufgepeitscht zu werden. So bleibt ihm nur, aus der Realität der Expotition auszusteigen und mit seiner Tante ein geruhsames Leben zu leben (was nicht heißt, dass dies nicht vielleicht der angemessenste Weg war, aus den verschiedenen Optionen für sein Käferleben eine angenehme, realisierbare und erträgliche auszuwählen). Alexander entscheidet sich aber auch, an der Entdeckung des Pohls nicht teilzuhaben, und bleibt sozusagen vor der Entdeckung der Pohlarität menschlichen Empfindens (die uns später noch beschäftigen wird) stecken. Nun gut: man kann nicht alles haben. Wir sehen: Mentalisieren oder nicht - das ist keine Frage von Pu oder nicht Pu, von Käfer oder nicht, sondern vor der Alternative stehen alle ununterbrochen, und wir bilden da keine Ausnahme...
„Wenn du morgens aufwachst, Pu“, sagte Ferkel schließlich, „was sagst du dann als erstes zu dir?“
„Was gibt’s zum Frühstück?“, sagte Pu. „Was sagst du, Ferkel?“
„Ich sage: ‚Ich frage mich, was heute Aufregendes passieren wird‘“, sagte Ferkel.
Pu nickte gedankenschwer.
„Das ist dasselbe“, sagte er. (156)
Die Realität ist, es wurde weiter oben schon festgestellt, aufs Heftigste subjektiv gefärbt. Ob wir in der Wirklichkeit sind oder nicht, ist nie so ganz sicher – oder ob es meine Realität ist oder deine, und wer das zu entscheiden hat und ob man Widerspruch einlegen kann und bei wem. Ob das Ganze nicht ein Traum ist, werden wir möglicherweise erst am nächsten Morgen wissen.
Abends, nach der Gutenachtgeschichte, sind wir jedenfalls wie immer eingeschlafen,
und Pu, der noch ein bisschen länger wach auf seinem Stuhl neben unserem Kopfkissen sitzt, denkt Große Dinge über Gar Nichts, bis er ebenfalls die Augen schließt, den Kopf sinken lässt und uns auf den Zehenspitzen in den Wald folgt. Dort erleben wir immer noch verzauberte Abenteuer, noch wunderbarer als alle, die ich dir bisher erzählt habe; aber jetzt, wenn wir morgens aufwachen, sind sie verschwunden. (163f)
So wie jeder Traum zu Ende geht (normalerweise gefolgt von einem Aufwachen und einem guten Frühstück), so geht denn auch irgendwann die Geschichte der Freunde von Pu und Christopher Robin zu Ende. Warum sollte diese Enttäuschung erst am Schluss dieses Abschnitts eingestanden werden? Es ist doch von Anfang an klar! Irgendwann sind die beiden Pu-Bücher zu Ende. Christopher Robin wird in die Realität der großen weiten Welt eintreten. Christopher Robin wird fortgehen.