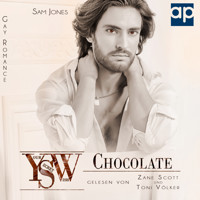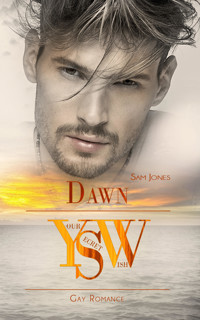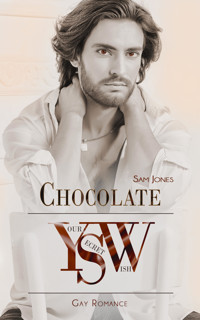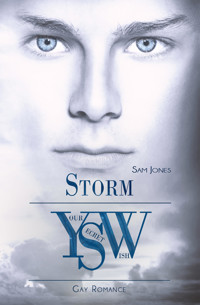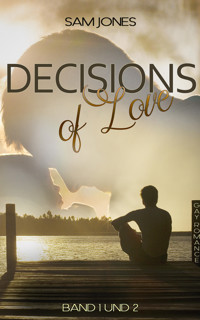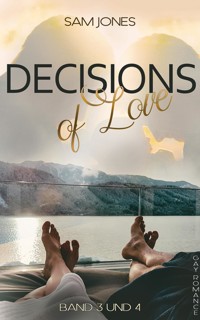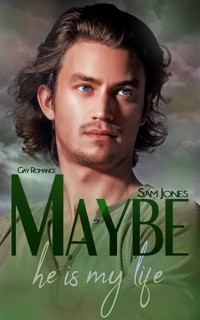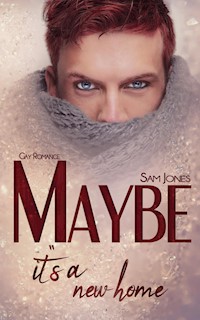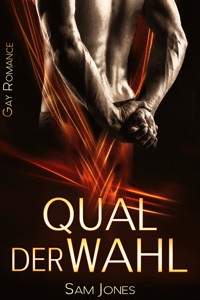
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Noah Benett ist jung, schwul, hat Geld und jede Menge Spaß. Als er jedoch dem geheimnisvollen Dorian begegnet, öffnet sich für ihn eine Tür zu einem Lebensstil, den er bis jetzt abgelehnt hat.
Doch selbst die Flucht in eine Beziehung zu einem anderen kann nicht verhindern, dass Dorian immer mehr Macht über Noah gewinnt. Unstillbares Verlangen und niemals dagewesene Sehnsüchte zwingen Noah eine Entscheidung auf, die nur er treffen kann.
Eine Wahl, die sein Leben vielleicht für immer verändern wird. Zwischen den beiden Männern und eigentlich auch zwischen zwei Leben!
Das ist ein abgeschlossener Roman!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Qual der Wahl
© 2019/ Sam Jones
www.facebook.com/SamJonesAutorIn/
Alle Rechte vorbehalten!
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.
Umschlaggestaltung:
Sam Jones/ Bilder: istock.com; pixabay.com
Bildmaterial Buchlayout
istock.com, pixabay.com
Erst Lektorat/ Korrektorat
Valeska Réon / Elke Preininger
Lektorat/ Korrektorat
Elke Preininger
Erschienen im Selbstverlag
Karin Pils
Lichtensterngasse 3–21/5/9
1120 Wien
Dieser Roman wurde unter Berücksichtigung der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst, lektoriert und korrigiert. Es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Orte, Events, Markennamen und Organisationen werden in einem fiktiven Zusammenhang verwendet. Alle Handlungen und Personen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Markennamen und Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer. Das Buch enthält explizit beschriebene Sexszenen und ist daher für Leser unter 18 Jahren nicht geeignet.
2. Auflage
Dieses Buch möchte ich all denjenigen widmen, die niemals aufhören, sich selbst neu zu entdecken. Sucht nach dem, was euch glücklich macht, egal, was andere davon halten!
Kurzbeschreibung:
Noah Benett ist jung, schwul, hat Geld und jede Menge Spaß. Als er jedoch dem geheimnisvollen Dorian begegnet, öffnet sich für ihn eine Tür zu einem Lebensstil, den er bis jetzt abgelehnt hat. Doch selbst die Flucht in eine Beziehung zu einem anderen kann nicht verhindern, dass Dorian immer mehr Macht über Noah gewinnt. Unstillbares Verlangen und niemals dagewesene Sehnsüchte zwingen Noah eine Entscheidung auf, die nur er treffen kann. Eine Wahl, die sein Leben vielleicht für immer verändern wird. Zwischen den beiden Männern und eigentlich auch zwischen zwei Leben!
Das ist ein abgeschlossener Roman!
Vorwort
Lieber Leser!
Qual der Wahl ist eine Gay Romance, doch einer der Haupt-Protagonisten ist dominant. Somit haben die in der Story beschriebenen erotischen Szenen teilweise BDSM Charakter, alle Handlungen sind jedoch freiwillig und von beiden Partnern gewollt!
Kapitel 1
»Guten Morgen, Herr Benett.«
Und täglich grüßt das Murmeltier, besser gesagt Alfred, mein Butler. Zuvor hatte er natürlich geklopft, was von mir wie immer ignoriert worden war. Ist ohnehin egal, er wäre so oder so eingetreten.
Sein weißhaariger Kopf erscheint in meinem Blickfeld, welches recht eingeschränkt ist, da mein Körper bis auf ein Auge unter meiner Decke versteckt liegt. »Ich hoffe, Sie haben wohl geruht?«, fragt er förmlich, als hätte er nicht schon meinem Vater die Scheiße vom Hintern gewischt. »Darf ich Ihnen als Erster zu Ihrem Ehrentag gratulieren?«
»Morgen, Alfred. Danke, dass Sie daran gedacht haben«, erwidere ich artig, so wie man es von mir erwartet. Zumindest ein paarmal am Tag versuche ich, standesgemäß zu funktionieren.
»Es ist ein wunderschöner Tag, Herr Benett.« Alfred geht zum Fenster, öffnet die schweren Vorhänge und lässt die Sonnenstrahlen herein.
»Es ist August. Warum sollte das Wetter nicht schön sein?«, maule ich vor mich hin, während ich mich müde an den Rand der Matratze schiebe.
»Ich habe mir erlaubt, Ihnen zur Feier des Tages eine Überraschung vorbereiten zu lassen. Sie werden sie am Frühstückstisch finden. Haben Sie bereits Pläne, was sie heute zu unternehmen gedenken? Ich frage nur, damit ich Ihnen die entsprechende Garderobe zurechtlegen kann.« Alfred verschwindet in meinem Ankleidezimmer, und ich verdrehe die Augen.
»Ich würde mir gern selbst aussuchen, was ich anziehe«, rufe ich ihm hinterher.
»Sie belieben zu scherzen. Das haben Sie von Ihrem Vater. Der hat auch gerne seine Späßchen mit mir getrieben. Ich erinnere mich an einen Morgen, da war er ungefähr sechzehn. Herr Rudolf Benett, Gott hab ihn selig, hatte bestimmt, dass Ihr Vater ihn zu einem Essen begleiten dürfte. Weshalb ich ihm einen Anzug zurechtlegte.« Alfred klingt höchst amüsiert, und ich bin genervt – jetzt schon – und es ist erst halb neun Uhr morgens. »Schlussendlich gab es Streit, weil Ihr Vater sich spontan für eine leichte Baumwollhose und ein T-Shirt entschied, ganz entgegen meinem Vorschlag.« Erneut ein Lachen, dann kommt Alfred wieder. »Ihre Kleidung ist bereit, und ich habe Ihnen frische Handtücher zurechtgelegt.«
»Danke«, erwidere ich, weil er ohnehin keine andere Antwort akzeptieren würde.
»Darf ich Sie also in etwa einer halben Stunde unten erwarten?« Seine Augenbraue wandert hoch – ein untrügliches Zeichen, dass die in eine Frage verpackten Worte eher als Anweisung gedacht sind.
Erneut antworte ich brav: »Natürlich, Alfred. Ich kann es kaum erwarten.«
Nun zieht sich seine Stirn in Falten, bevor er tief seufzt. »Danke, Herr Benett.«
Als er endlich verschwunden ist, klettere ich aus dem Bett. Ich bin nackt und gedenke es auch zu bleiben. Ich muss ohnehin unter die Dusche, warum sich also zwischenzeitlich textilmäßig belasten?
Zu allererst tapse ich ans Fenster, um Alfreds Wetterbericht zu prüfen. Tatsächlich strahlt die Sonne vom Himmel und lässt die Bäume im Garten leuchten. Es gibt verdammt viele davon da unten, weil es eben ein riesiges Anwesen ist, auf dem die enorm große Villa steht, in der ich mich befinde. Sie gehört mir – also die Villa. Seit heute sogar offiziell. Denn ich habe Geburtstag. Es ist mein neunzehnter, doch ich bin mir nicht sicher, ob ich diesem Tag freudig oder deprimiert gegenüberstehen soll.
Mit dem heutigen Tag gelte ich als Alleinerbe des Benett-Vermögens. Das wäre ja grundsätzlich eine tolle Nachricht. Hätte ich jemals Geldsorgen gekannt, gehörten sie nun der Vergangenheit an. Hatte ich aber nicht. Ich bin reich. Stinkreich. So wie davor meine Eltern. Also verdanke ich meinen Reichtum deren Dahinscheiden vor nicht ganz vier Jahren. Und das ist ja eher weniger erfreulich.
Sicher hat auch das damit zu tun, dass ich dem heutigen Tag gegenüber ein bisschen negativ eingestellt bin. Ein zweiter Grund ist, dass ich generell nicht so gut klarkomme mit meinem Ehrentag. Schuld daran sind, laut eines sündhaft teuren Therapeuten, einige dieser Tage aus meiner Vergangenheit. Es hatte schöne Feiern gegeben. Groß, angeberisch, teuer, aber die Erinnerung an die anderen hält mich bis heute gefangen. Einsame Stunden, in denen meine Eltern anderweitig beschäftigt waren, und ich mit einem lächerlichen Papierhut auf dem Kopf mit unseren Hausangestellten, oder später den Au-pairs, meinen Kuchen verzehrt hatte.
Ein Seufzen kriecht in mir hoch, doch ich lasse es nicht heraus. Es ist so lange her, warum noch darüber nachdenken? Egal wie schlecht sie vielleicht ihre Rolle als Eltern ausgeübt hatten – was würde ich dafür geben, wenn sie jetzt hier wären.
Pünktlichst, also genau neunundzwanzig Minuten später, spaziere ich, gehüllt in ausgewaschene Jeans und graues T-Shirt mit blauem Harley-Davidson-Schriftzug, in das Esszimmer. Meine schwarze Mähne trage ich aufgelockert mit ein paar Tupfern Gel. Ich liebe diesen Frisch-aus-den-Federn-Look. Gepaart mit meinen hellblauen Augen bringt mir das regelmäßig interessante Angebote auf dem abendlichen Fleischmarkt.
Auf dem Tisch, direkt vor meinem Platz, steht ein Mini-Törtchen mit einer golden schimmernden Neunzehn drauf, was mich grinsen lässt. Das hat sicher Hannah, unsere Köchin, extra für mich gebacken, obwohl sie weiß, dass ich es nicht essen werde. Ich bringe sie zur Verzweiflung mit meiner Kalorienzählerei. Das ist zumindest meine Interpretation ihrer sich ständig wiederholenden Worte: »Wenn der Herr nicht bald einmal ordentlich isst, wird er noch vom Fleisch fallen.«
Sie hat ja keine Ahnung, wie es ist, mit einem Bauchansatz einen willigen Partner zu suchen. Gerade in der Schwulencommunity ist ein gepflegter, attraktiver Körper mehr Kapital, als jede Million am Konto es sein kann.
Alfred steht am Kopf der Tafel, bereit, mir den Stuhl zurechtzurücken. Er mustert mein Outfit, das natürlich nicht jenes ist, das er bereitgelegt hat. Seine Augenbrauen zucken missbilligend nach oben. Verbalen Tadel ernte ich nicht. Das würde seine Kompetenzen überschreiten – ich liebe es wirklich, Diener zu haben.
»Wünschen Sie heute ein Omelett, Herr Benett?« Er zieht es vor, gleich die lösbaren Dinge zu erörtern.
»Ja. Nur Eiweiß, bitte.« Ich begebe mich zu meinem Sessel und setze mich, natürlich in angemessener Geschwindigkeit, die zulässt, dass Alfred seinen Part dieses Bewegungsablaufes mitmachen kann. Rücksichtnehmen nennt man das – auf mich und ihn. Ich hatte nämlich schon mal versucht, das Platz-Nehm-Ritual zu beschleunigen. Eine schmerzhafte Erfahrung, weil der Stuhl noch zu weit hinten gestanden und mir so gepresste Eier eingebracht hatte.
»Darf ich vorschlagen, dass Sie das gewohnte Rezept um ein wenig Schinken erweitern?« Alfred steht nun neben mir.
»Nein, danke«, antworte ich, so wie ich es eigentlich immer tue. Schweinefleisch ist mir verhasst, und Putenschinken ist so trocken, dass ich beim Verzehr stets das Gefühl habe, er würde mir spätestens zehn Minuten später in pulverisierter Form wieder aus den Ohren stauben.
»Dann werde ich Hannah Bescheid geben.« Bevor er das tut, schenkt mir Alfred natürlich noch eine Tasse Kaffee ein.
Ich bedanke mich höflich, nehme sie in die Hand und probiere einen Schluck. Er ist heiß und stark, genauso wie ich ihn liebe. Mit einem zustimmenden Brummen übertrage ich diese Feststellung in eine für meine Umgebung verständliche Form.
Alfred weiß das zu schätzen, murmelt ein »gerne« und entfernt sich diskret.
Kaum sind seine Schritte verklungen, sind andere zu hören. Tippelnd, versucht leise. Wahrscheinlich Rosie, unser Hausmädchen. Das ist ihre Art, sich durchs Haus zu bewegen. Ob anerzogen oder angeboren, sie kann das wirklich gut. Unmöglich zu zählen, wie oft ich schon buchstäblich über sie gestolpert bin beziehungsweise sie mir einen Herz-rutscht-in-die-Hose-Moment beschert hat, weil sie plötzlich vor mir auftauchte.
Übrigens, sie ist verknallt in mich. Dass ich schwul bin, scheint ihren Eifer, mir zu gefallen, dabei nicht zu stören. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie es tatsächlich noch nicht gerafft hat. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich kaum etwas unternehme, um diesen vermeintlichen Irrtum zu entkräften. Im Grunde gefällt es mir nämlich so, denn dadurch ist mir wenigstens stets ihre uneingeschränkte Ergebenheit sicher. Als Ausrede kann da ganz gut herhalten, dass sich das alles ohnehin ändern wird, sobald ich mal einen Lover mit nach Hause bringe.
Dieser Gedanke bringt mich zu einem Thema, welches in den letzten Wochen an Dringlichkeit gewonnen hat: Ich brauche einen Mann. Also, nicht, dass ich keinen Sex habe – das nicht – aber ich finde, es wird Zeit, mir etwas Festes zu suchen. Und was bietet sich da besser an, als eine Geburtstagsfeier, zu der die halbe schwule Gesellschaft Wiens eingeladen ist? Scheiße, wahrscheinlich wird Rosie spätestens heute Abend kapieren, dass ich kein potentieller Heiratskandidat für sie bin.
»Alles Gute zum Geburtstag, Noah.« Rosies schüchterne Stimme lässt mich aufsehen. Sie befindet sich an der Tür und lächelt mich an.
»Danke, Rosie.« Ich schenke ihr ebenfalls ein Lächeln, und sofort überzieht ein Rotschimmer ihre Wangen. »Wirst du heute Abend hier sein. Bei der Party?«, frage ich, innerlich Bezug auf meine eben getroffene Feststellung nehmend.
Leider kommt die Arme nicht dazu, meine Neugier in diesem Punkt zu befriedigen, denn genau in dem Augenblick kehrt Alfred zurück und straft sie mit einem strengen Blick. Er mag es nicht, wenn sie sich hier aufhält, während der Essenszeiten.
Sie wird noch röter, findet aber den Mut, mich ein letztes Mal anzusehen – mit strahlenden Augen. »Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Noah«, haucht sie, dann verschwindet sie.
Alfred serviert mir mein Omelett. Eine Cocktailtomate in Blütenform geschnitzt liegt daneben auf dem Teller, ich lächle zu ihm nach oben. »Sagen Sie Hannah bitte, dass ich mich sehr gefreut habe.«
»Gerne, Herr Benett. Ich werde mich zurückziehen. Es ist noch einiges zu erledigen, für heute Abend.« Er platziert, dekorativ aufgefächert, drei Zeitungen neben meinen Teller und entfernt sich.
Er ist schon ein Unikat. Ein Butler wie einem Buch entsprungen. Weißhaarig, mittelgroß mit Pausbacken und diesen Schlupflidern, die den Augen jenen eigenen müden Ausdruck geben. Er trägt immer – und damit meine ich immer – einen Anzug. Ich befürchte, er legt ihn nicht einmal zum Schlafen ab. Es gab Gelegenheiten, da hab ich ihn nachts um zwei aus den Federn geklingelt, und auch da war er in mausgrauen Polyester gehüllt.
Ich genieße mein Omelett und trinke drei Tassen Kaffee dazu. Währenddessen blättere ich in der Tageszeitung, doch es steht nichts darin, was mich interessiert. Auch die anderen beiden bringen keine neuen Erkenntnisse. Vielleicht würden sie das, wenn ich in der Lage wäre, die Börsenkurse zu lesen. Bin ich aber nicht. Und so beginne ich mich zu langweilen, was einen dringenden Plan erfordert, wie ich mir den Tag bis zu meiner Geburtstagsfeier totschlagen kann. Meine Freunde werden erst später kommen, es wird wirklich Zeit, mir jemanden anzuschaffen, der mich auch tagsüber unterhält – im Notfall sogar ein Hündchen. Es dauert nicht lange, da fällt mir eine Möglichkeit ein. Danach handelt es sich nur mehr um Minuten, bis ich mich beschwingt auf den Weg mache.
Der Spa-Salon »Diskret« ist mein Ziel. Ich bin gern dort, besuche die Sauna und lasse anschließend meinen Körper trimmen. Damit ist keine sportliche Betätigung gemeint. Die ausschließlich männliche Belegschaft ist Meister darin, jedes unerwünschte Haar zu entdecken und zu entfernen, Poren zu reinigen, und was man sonst noch tut, um einem schwulen Body die gewünschte Ästhetik zu verschaffen.
Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ist eine abschließende Massage von Stephan. Er ist unglaublich und beschert mir regelmäßig einen Ständer. Das ist natürlich nicht tragisch, denn er kümmert sich auch darum – gehört in diesem Salon zum First-Class-Service.
Also drehe ich mich auf den Rücken, als er denselben vollends entspannt hat, und präsentiere ihm meinen erigierten Schwanz.
»Da freut sich ja jemand sehr, mich zu sehen«, lacht er, greift sich aber zeitgleich die Gleitgel-Tube und drückt eine ordentliche Portion in die Handfläche. »Wonach steht dir der Sinn?«, erkundigt er sich, während er seine Finger um meine Härte wickelt.
»Das ist schon ganz gut. Danke.«
»Okay.« Er beginnt mich zu streicheln, auch hier weiß er, wie fest der Druck zu sein hat.
Ich schließe die Augen. So kann ich mir besser vorstellen, dass ich nicht dafür bezahle, dass mir gerade einer runtergeholt wird.
Eigentlich ist es ja lächerlich, denn wenn mir an etwas nicht mangelt, dann an Sexangeboten. Aber – ob der gemeine schwule Mann das nun versteht oder nicht – auch Überschuss kann zu Langeweile führen. Vielleicht greife ich deshalb in letzter Zeit lieber auf Stephans Hände respektive – übrigens ebenso talentierten – Mund zurück. Das weicht von der Normalität ab, die darin besteht, mir im Darkroom beziehungsweise in der Sauna das Hirn rauszuficken oder morgens in fremden Betten wach zu werden.
Es dauert nicht lange, bis ich meinen Höhepunkt erreiche. Stephan macht mich danach sorgfältig sauber, und sobald ich die Augen wieder öffne, trifft mich sein fragender Blick. »Möchtest du noch eine Fußreflexmassage?«
Ich verneine. Fürs Erste bin ich zufrieden.
Eine Viertelstunde später verlasse ich den Salon. Mein neuer weißer Ferrari steht vor der Tür, bereit, mich zu bringen, wo auch immer ich hinwill. Dieses Gefährt habe ich mir übrigens selbst zum Geburtstag geschenkt. Irgendwelche Vorteile muss es letztendlich haben, der Alleinerbe eines Großunternehmens zu sein. Ich steige ein, lenke ihn in Richtung Zuhause. Vielleicht sollte ich noch ein Mittagsschläfchen einplanen. Schließlich möchte ich für heute Abend fit sein.
Leider schaffe ich es nicht einmal bis in mein Zimmer. Alfred fängt mich auf halber Strecke ab.
»Herr Benett?«, ruft er mir hinterher, wenn auch in gedämpfter Lautstärke.
Mein Nacken knackt, als ich mich umständlich zu ihm zurückdrehe. »Ja, Alfred?«, erkundige ich mich, als hätte ich nur auf sein Auftauchen gewartet.
»Die Cateringfirma ist jetzt da. Die, die wir, statt der üblichen, auf die Empfehlung Ihres Freundes genommen haben.« Er versucht, neutral zu klingen, trotzdem kann ich zwischen den Zeilen lesen, wie sehr ihn diese Missachtung der Traditionen meinerseits erzürnt hat.
»Und sie entspricht nicht Ihren Vorstellungen?«, rate ich also munter drauf los.
»Es ist wohl besser, wenn Sie sich selbst ein Bild machen«, erwidert er mysteriös.
Mir entkommt ein Seufzer, bevor ich ihm recht missmutig in die Küche folge. Mich jetzt um solche Dinge zu kümmern, geht mir ziemlich gegen den Strich. Lieber wäre mir das geplante Schläfchen gewesen, um mich danach ausgeruht meiner Schönheitspflege widmen zu können. Schließlich möchte ich heute Abend geil aussehen.
Drinnen empfängt mich eine Hektik, die mir sofort zusätzlich auf den Magen schlägt. Wenn ich auf die Schnelle richtig gezählt habe, wuseln hier gerade etwa sieben Typen durch den Raum. Ganz abgesehen von Hannah und Rosie, und obwohl unsere liebe Köchin circa dreißig Quadratmeter ihr Reich nennen darf, für insgesamt elf Leute ist das etwas wenig.
»Noah!« Simon, der Typ, der mir von Samuel, meinem Vor-vier-Wochen-Fick empfohlen wurde, streckt mir freudig seine Hand entgegen. »Schön, dich wiederzusehen.«
Irgendwie hatte ich ihn blond in Erinnerung. Ist er aber nicht. Er hat wohl von Natur aus rote Haare, woraus die Blondierung ein blasses Orange gemacht hat. Auch ansonsten ist er eine kleine Mogelpackung. Auf den ersten Blick wirkt er schlank, jedoch sind hier und da Pölsterchen, die seine lockere Kleidung gern verschwinden lassen würde. Dafür ist sein Gesicht ausgesprochen hübsch. Es hat sehr weiche, freundliche Züge. Doch was bei einem jüngeren Exemplar süß rüberkäme, gibt ihm, in Anbetracht der geschätzten dreißig Jahre, die er bereits auf dem Buckel hat, nur einen etwas tuntigen Touch. Trotzdem finde ich ihn wahnsinnig sympathisch.
»Hallo, Simon«, begrüße ich ihn mit einem breiten Lächeln. »Brauchst du die wirklich alle?« Mein Blick gleitet über die Schar von Männern. Einen bunteren Haufen hab ich selten gesehen. Vier von ihnen sind gerade dabei, Lebensmittel aus ein paar Kisten dekorativ auf der Arbeitsfläche zu verteilen. Hannah steht überfordert daneben und ist offensichtlich sogar zu baff, um sich zu beschweren.
Ein sehr dünnes, kleingewachsenes Exemplar von Mann hält ein Notizbuch in der Hand und schreibt eifrig, was ihm der neben ihm stehende Kerl diktiert. Er ist groß. Ich schätze mal mindestens eins neunzig. Und wenn der Rest von ihm so ansprechend ist wie der knackige Hintern, der in seiner Jeans steckt, ist es gut möglich, dass ich in spätestens zehn Sekunden am Sabbern bin.
»… bleiben bis zur Party. Dorian übernimmt die Bar. Tony und Alex werden das Essen rumreichen.« Etwas peinlich berührt bemerke ich, dass ich nur das Ende von Simons Erklärung mitbekommen habe, also lächle ich erst mal unverbindlich.
Er erwidert mein Lächeln. »Ich werde die Vorbereitungen überwachen, Dorian sorgt dann dafür, dass den restlichen Abend alles nach Plan läuft.«
Das ist das zweite Mal, dass er diesen Namen erwähnt, und die Art, wie er ihn ausspricht, macht klar, dass es wohl jemand ist, der ihm etwas bedeutet. »Und Dorian ist …?«, erkundige ich mich daher neugierig.
»Herr Benett«, meldet sich Alfred zu Wort. »Benötigen Sie meine Unterstützung? Sonst würde ich mich um die restlichen Vorbereitungen kümmern.«
Es ist offensichtlich, dass er sich hier drin unwohl fühlt. Umgeben von, seiner Meinung nach, nicht standesgemäßen Leuten, die gerade dabei sind, die Organisation des Geburtstagsfestes seines Schützlings an sich zu reißen. Im Grunde meint er es ja nur gut mit mir. Das weiß ich natürlich. Nur sind ihm, oder besser mir, eben seine altmodischen, verschrobenen Ansichten im Weg.
Etwas widerstrebend wende ich mich ihm zu – immerhin muss ich dafür meine Augen von dem knackigen Arsch am anderen Ende der Küche nehmen. »Ich hab das im Griff, Alfred. Danke!«, entlasse ich ihn nur zu gern aus seinen Pflichten hier.
Er deutet ein Nicken an, sendet seine visuelle Abneigung ein letztes Mal Richtung Simon und zieht sich schließlich zurück.
Mein Blick schweift durch den Raum, trifft auf Hannah, die sich mittlerweile gefangen und begonnen hat, in ihren Töpfen zu rühren. Ich habe keine Ahnung, was sie da kocht, aber wahrscheinlich will sie mich vor der Party noch abfüttern – das wäre zumindest typisch für sie.
Mir fällt meine unbeantwortete Frage von eben ein, also wende ich mich wieder Simon zu. »Dorian?«, erinnere ich ihn.
Seine Augen bekommen diesen eigenen Glanz, der ihn als furchtbar verliebten Idioten outet. »Dorian ist mein Geschäfts- und Lebenspartner«, erklärt er das Offensichtliche. Dabei sieht er über seine Schulter zurück auf den großen Typen mit dem knackigen Po.
Ich blicke ebenfalls hinüber – besagter Partner steht immer noch mit dem Rücken zu uns, was mich allerdings nicht stört. Wie bereits erwähnt, ist seine Rückansicht sehr, sehr präsentabel.
»Dorian«, piepst Simon so leise, dass ich bezweifle, dass es durch den Raum zu hören ist. Der Angesprochene scheint jedoch neben einem Prachtarsch auch über ein äußerst feines Gehör zu verfügen, denn er dreht sich augenblicklich um. Und mir schießt das Blut in den Schwanz.
Ich habe noch nie einen so attraktiven und gleichzeitig unnahbaren Mann gesehen wie ihn. Sein Antlitz ist durch und durch männlich, doch das Highlight darin sind eindeutig zwei wie Diamanten funkelnde, graue Augen. Was um den bereits gepriesenen Arsch und dieses ausdrucksvolle Gesicht gewachsen ist, zeigt deutlich, dass ihm der Körperkult sehr wichtig ist. Er ist kein Muskelprotz, das nicht, aber er ist kräftig gebaut und man kann erkennen, dass es nicht Fett ist, was das Mehr ausmacht.
Ich schlucke, als ich mich – völlig untypisch – als Letztes auf das Paket fokussiere, das da zwischen seinen Beinen zu Hause ist. Wow! Er ist Linksträger, was deutlich an der vielversprechend wirkenden Ausbuchtung zu sehen ist.
Es dauert etwas, bis ich meine Augen von besagter Beule losreißen kann, doch als ich es tue, begegnen sie den seinen. Darunter sitzt ein wissendes, spöttisches Lächeln, das wohl meiner, fast schon peinlich offensichtlichen, Musterung seinerseits geschuldet ist. Das ärgert mich. Ich hasse es, ertappt zu werden.
Leider kommt es noch schlimmer, denn Dorian ist nicht der Einzige, dem mein augenscheinliches Interesse aufgefallen war. Einer der Jungs, die gerade mit dem Geschirr beschäftigt sind, beobachtet uns mit einem amüsierten Zug um den Mund. Das steigert meinen Ärger zu einer ausgewachsenen Wut. Meine Miene wandelt sich von einer bewundernden in eine strenge, vernichtende. Na gut, dann find ich ihn eben scharf – aber ich bezahle heute Abend für euch, also arbeitet gefälligst und lasst mich bestaunen, was immer ich möchte,soll sie ausdrücken.
Was bei dem halben Hähnchen funktioniert, kostet Dorian jedoch nur ein schiefes Grinsen. Das hält sich auch auf seinem schönen Gesicht, als er sich mir nähert und schließlich direkt vor mir stehen bleibt.
»Möchtest du mir unseren Auftraggeber nicht vorstellen?« Seine Augen liegen noch auf mir, doch seine Aufforderung gilt Simon, der beim Klang seiner Stimme sofort den Kopf beugt, so als würde er einen Diener machen.
Nun bin ich amüsiert – wow – es ist offensichtlich, wer bei den beiden den Ton angibt.
»Noah Benett, das ist Dorian Delaney.« Simons Stimme ist mit einem Mal piepsig hoch, was mich noch mehr erheitert.
»Dorian …« Selbstsicher strecke ich die Hand aus. »Nenn mich bitte Noah.«
Er ergreift sie, und als wir uns das erste Mal berühren, schlägt bei mir buchstäblich der Blitz ein. Es kribbelt. Von der glücklichen Fingerspitze des Mittelfingers, die als Vorreiter das Vergnügen hatte, mit diesem absolut heißen Mann in Kontakt zu treten, bis zu einer anderen Spitze, die etwa in der Mitte meines Körpers liegt.
»Noah. Freut mich.« Mein Name rinnt von seinen Lippen wie Honig. Wie kann ein solch großer Kerl so sanfte Töne herausbringen? Meine Kopfhaut überläuft ein Schauer, der sich weiter über meinen Nacken und meinen Rücken ausbreitet.
Simon hat immer noch den Blick gesenkt, das sehe ich aus meinen Augenwinkeln. Dorian blickt ihn nun an, sehr eindringlich, wie mir vorkommt.
»Hast du nichts zu tun, Simon?« Die Sanftheit seiner Stimme ist weg, nun klingt er nur mehr wie der Boss – der alleinige Boss.
Ein Flüstern ist zu hören, auch wenn ich nicht sicher bin, hört es sich verdammt nach einem »Doch, Sir« an.
Ich stutze ein bisschen und taxiere Dorians Gesicht. Es ist entspannt, aber seine Augen haben den Ausdruck gewechselt. Es wirkt nun härter. Strenger. Erneut schießt mir das Blut in die Lenden.
Simon sucht schleunigst das Weite – also eigentlich stellt er sich nur ans andere Ende des Küchentresens –, vermeidet jedoch jeglichen Augenkontakt mit Dorian. Der setzt eine ziemlich zufriedene Miene auf. Mir fällt auf, dass er immer noch meine Hand hält, doch irgendwie habe ich keine Lust, sie ihm zu entziehen.
»Alles Gute, Geburtstagskind.« Wieder geht mir seine Stimme unter die Haut.
Ich sehe ihm ins Gesicht, oder genauer gesagt in die Tiefe seiner grauen Iriden. »Danke«, lautet meine außerordentlich geistreiche Antwort.
»Wie alt bist du geworden, Noah?« Es macht ein wenig den Eindruck, als würde er sich glänzend amüsieren, trotzdem habe ich das Gefühl, es interessiert ihn tatsächlich.
»Neunzehn«, erwidere ich artig.
Seine Stirn zieht sich zusammen, dann fährt er fahrig mit seiner Hand durch seine dunkelbraunen Haare. Sie sind glatt, nur an den Enden leicht gelockt, was mir verrät, dass er sie wohl zum Glattsein zwingt. »Wirklich? Neunzehn?« Er klingt geschockt.
»Ja. Warum?«, frage ich, über seine offensichtliche Enttäuschung erstaunt.
»Du bist zu jung«, sagt er, rümpft kurz die Nase, dreht sich um und geht.
Und ich stehe da wie bestellt und nicht abgeholt.
Kapitel 2
»Hallo. Mein Name ist Noah Benett und ich bin ein Unentschlossener.«
»Hallo, Noah!«, erwidert Mo, mein bester Freund, in einem perfekt monotonen Singsang, der jede Selbsthilfegruppe neidisch gemacht hätte.
Wir liegen auf meinem Bett, warten darauf, dass die Minuten verstreichen. Unten tobt bereits der Bär, zumindest lassen die Geräusche, die zu uns nach oben dringen, das vermuten. Die Geburtstagsfeier zu meinem Neunzehnten ist also in vollem Gange – auch ohne mich.
»Ich denke ja nicht, dass es Gruppen für Unentschlossene gibt«, stellt Mo fest. Er hebt seinen rechten Arm, betrachtet interessiert, wie die Rüschen an seinem Ärmel sich bewegen, wenn er denselben hin und her schwenkt. Er ist schon ein Unikat.
Mo heißt eigentlich Morten, so wie der süße Typ aus dieser norwegischen Boyband, die mal in den Achtzigern ein paar Hits hatte. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass seine Mum in ihrer Jugend furchtbar verknallt in den Popstar war. Das werde ich nie verstehen, warum benennt man seinen Sohn nach einem Mann, den man niemals haben kann? Frauen – das ewige Rätsel des Universums. Ob aus diesem Grund, oder einfach nur so, Mo hasst seinen Namen, weshalb es unter Todesstrafe verboten ist, mehr als nur die ersten beiden Buchstaben zu benutzen. Er sieht auch nicht wirklich aus wie das nordische Schnuckelchen. Na ja, vielleicht gibt es eine klitzekleine Übereinstimmung im Bereich der Nase.
Mo und ich kennen uns seit etwa einem Jahr. Wir hatten mal eine Achtundvierzig-Stunden-Affäre, die endete, als ich ihn vollgedröhnt bei einer Nummer mit einem der Kellner aus dem Why auf der Toilette erwischt hatte. Danach haben wir uns gehasst, für drei oder vier Tage, dann noch einmal gefickt und jetzt sind wir richtig dicke Freunde. Allerdings ohne Benefits. Auch wenn der Sex mit ihm sehr gut war, es tut uns nicht gut, die Grenzen zu überschreiten.
Heute trägt er schwarze Lederhosen und eine weiße Bluse mit riesigen Rüschen am Revers und an den Ärmeln. Die Augen sind übertrieben schwarz geschminkt und seine dunkelblonden Haare mit Gel festgeklatscht, nur im Nacken kräuseln sich ein paar Locken. Lächelnd neige ich meinen Kopf zur Seite. »Du siehst aus wie ein äußerst schwuler Mozart.«
»Na ja …« Er sieht belustigt an sich hinunter. »… das Mo passt ja schon mal.«
»Und ich?« Ich werfe ihm einen auffordernden Blick zu, der jedoch von ihm mit einer gehörigen Portion von Verständnislosigkeit erwidert wird. »Wie seh ich aus?«, konkretisiere ich also, obwohl ich im Grunde weiß, dass ich fantastisch aussehe.
Der Stoff meines grauen Hemdes ist leicht durchscheinend, sodass meine Brustwarzen-Schmuckstücke gut zu sehen sind. Platinstäbe, die ich mir vom Geburtstagsgeld meiner einzig lebenden Verwandten gekauft habe. Tante Pascale, die jüngere Schwester meiner Mum. Ich hab sie noch nie gesehen, würde das Bild am Treppenaufgang nicht existieren, ich wüsste nicht einmal, wie sie aussieht.
Dafür entschädigt mich der Scheck, der, seit ich hier in Wien bin, zweimal im Jahr eintrifft. Pünktlich zu Weihnachten und eine Woche vor meinem Geburtstag. Warum auch immer denkt sie, dass er auf den 6. August fällt. Immerhin enthält ihr Kuvert neben dem Geld stets einen mindestens fünf Seiten langen Brief. Den muss ich mir allerdings von einer Nachbarin übersetzen lassen – einer Französin, die vor sechzig Jahren hier nach Österreich gezogen war. Mein Französisch ist nämlich beschissen. Also nur in Hinsicht auf das Sprachtalent, ansonsten ist meine Zunge sehr talentiert.
Tante Pascale lässt sich gern über ihr Rheuma und ihre gierigen Freunde aus, die nur auf ihr Geld scharf sind. Und dann ist da noch das schrecklich heiße Wetter in Nizza. Mal ehrlich, wie dekadent muss man sein, den Ruhestand in Südfrankreich zu verbringen und die viele Sonne zu bekritteln?
Trotzdem freue ich mich über ihre Briefe. Wirklich. Gibt es mir doch zumindest den Anschein, immer noch eine Familie zu haben. Sonst ist da nämlich niemand. Meine Großeltern sind tot. Geschwister gab’s nur bei Mum – eben Tante Pascale. Sie war übrigens die Einzige aus Mums Sippe, die mit ihr Kontakt gehalten hatte, nachdem sie mit knapp achtzehn Hals über Kopf mit meinem Vater nach Amerika verschwunden war.
»Du siehst immer toll aus, Schatz.« Mos Antwort reißt mich aus meiner Überlegung.
»Danke«, erwidere ich, und im gleichen Moment fällt mir wieder Dorian ein. Dieser Arsch. Dem hab ich eindeutig gefallen, dennoch hat er mich abgekanzelt, als wäre ich ein Lausejunge, den er mit der Hand in der Zuckerdose erwischt hat. Der Gedanke drückt meine Laune sofort nach unten, was scheinbar auch von Mo bemerkt wird. Er dreht nämlich plötzlich sein Gesicht in meine Richtung, seine Augen sind leicht zusammengekniffen.
»Was ist denn, mein Schöner?«, erkundigt er sich leise. Er kennt mich einfach zu gut. Natürlich spürt er, dass mich etwas beschäftigt.
»Ich hab’s satt, allein zu sein«, erkläre ich ihm also.
Seine perfekt gezupfte Augenbraue zuckt hoch. »Ich kenne niemanden, der weniger allein ist als du!«
Ich ziehe meine Stirn in Falten, um zu demonstrieren, dass ich ihm nicht ganz folgen kann.
In Reaktion darauf verdreht er die Augen. »Na, mal ehrlich: Du hast Diener um dich, immer. Und egal wo du hingehst, findest du binnen zwanzig Minuten einen Kerl zum mit nach Hause nehmen. Beziehungsweise, mit dem du zu ihm gehst, denn zu dir darf ja keiner.«
Ich grinse. »Du schon.«
»Ja. Ich schon.« Auch er lächelt.
»Ich will eine Beziehung. Jemanden, der für mich da ist.«
Meine Ausführung amüsiert ihn sichtlich. »Eine monogame?«
»Na ja. Vielleicht nicht ganz«, schränke ich ein.
Er lacht kurz, spricht dann schmunzelnd weiter. »Ist gar nicht so schlimm.«
Ich ziehe meine Nase kraus. »Weiß nicht.«
»Mach einfach, wie du glaubst, mein Schöner.« Er lenkt seinen Blick zur Zimmerdecke.
»Gefall ich dir wirklich? Ich meine, du nennst mich immer so, aber …« Ich breche ab, nicht ganz sicher, was ich eigentlich fragen möchte. Dafür weiß ich, was ich gern hören will, vielleicht sogar muss.
»Du bist einer der schönsten Männer, die ich jemals persönlich getroffen habe, Noah.« Nun klingt er ernst, sieht jedoch immer noch nach oben. »Damals, im Why. Ich wollte dich so sehr, dass ich dachte, ich dreh durch, wenn ich dich nicht haben kann.«
»Aber du hast mich betrogen.«
»Manchmal ist es zu viel, wenn man bekommt, was man unbedingt will.« Das ist einer seiner typischen philosophischen Sprüche. Undurchsichtig und vage. Dehnbar in alle Richtungen.
Ich schnaufe.
»Schmoll nicht, du schöner Mann.« Er schmiegt sich an mich, umschlingt mich mit seinen Armen. »Ich hab dich lieb, Noah. Das weißt du, oder?«
»Ja«, maule ich, dann setze ich versöhnlicher hinterher: »Ich dich auch.«
Wir schweigen kurz, dadurch wird mir bewusst, dass immer noch die Musik von unten zu uns nach oben dröhnt.
»Bereit für die Party?«, frage ich also.
»Bereit, wenn Sie es sind, Sir«, erwidert Mo, verschmitzt grinsend.
Sein »Sir« bringt Dorian wieder zurück in meinen Kopf, wo er aber ehrlicherweise ohnehin den ganzen Nachmittag über herumgespukt hat. Es hat schon eine Ähnlichkeit mit Kopfschmerzen, wie mich der Gedanke an ihn quält. Auch jetzt, während Mo und ich die Treppe nach unten gehen.
Du bist zu jung, hat er gesagt.
So als wäre das eine Krankheit, oder anders, eine freigewählte Lebensform. Ich kann doch nichts dafür, wie alt ich bin.
Noch immer ärgere ich mich, dass mich seine Aussage derart aus der Fassung gebracht hat. Nicht mal eine bissige Antwort hab ich ihm an den Kopf werfen können. Nein – ich hab ihn einfach abziehen lassen, mit seinem kleinen, geilen Arsch wackelnd.
Innerlich seufzend schicke ich ein Stoßgebet zum Himmel, dass ich es trotz der in mir kochenden Wut geschafft habe, zumindest im Gesicht cool zu bleiben. Leider ahne ich nur zu gut, wie sinnlos dieser Wunsch ist. Sicher hat er ganz genau mitbekommen, wie tief mich seine abschätzige Bemerkung getroffen hat. Wenn ich dran denke, dass ich ihn gleich wiedersehen werde, zwickt es ein wenig in meinem Bauch. Na toll, somit ist es amtlich. Er hat mir doch tatsächlich meine Party versaut.
Im Salon angekommen, sehe ich mich erst mal um, während Mo sich aufmacht, um uns Drinks zu besorgen. Nicht sehr überrascht stelle ich fest, dass die Schwulenclubs der Stadt heute wohl nur mäßig gefüllt sein werden, denn der Großteil unserer kunterbunten Community scheint hier zu sein. Was ja kein Wunder ist. Ich bin gern unterwegs, daher kenne ich genügend Leute – und einer Party ist schließlich niemand abgeneigt.
»Sally ist da. Er hat einen Neuen, der in einer dieser schicken kleinen Anwaltskanzleien im ersten Bezirk arbeitet.« Mo steht mit zwei Mai Tais vor mir und hält mir eines der Gläser entgegen. »Der Typ ist ein absolutes Arschloch, aber er bezahlt ihm die Miete für seine Wohnung, damit er sie behalten kann, wenn er zu ihm in sein Ringstraßen-Appartement zieht.« Zum Ende hin bekommt seine Stimme einen selbstherrlichen Klang.
Ich schmunzle. »Jedem das seine.« Mein neugieriger Blick geht auf Wanderschaft. Sally – eigentlich Sandro – hat sich an einen Armani-Anzug geklammert. Genau genommen an den etwa zwei Meter großen knochendürren Typen, der darin steckt. Es ist ein aalglatter Managerheini mit perfekt frisierten Haaren. Seine Miene ist derart arrogant, dass ich gern hineintreten würde – einfach nur so. Wie unser kunterbunter Kugelfisch zu so einem Affen passt, ist mir ein Rätsel. Okay – um bei der Wahrheit zu bleiben –, Sally ist nicht kugelrund, nur ein wenig mollig. Aber er ist nun einmal eine richtige kleine Tunte. Scharfzüngig, laut, schrill – kurz – ich liebe ihn! Doch er ist sicher niemand, den man an der Seite dieses Yuppies erwartet.
Er trägt seine blonden Haare lang, meistens zu einem Zopf gebunden, hat braune Kulleraugen und ein schönes, fast androgynes Gesicht. Sally meine ich. Sein neuer Typ sieht natürlich auch gut aus, aber auf eine unspektakulär offensichtliche Art. Da ist nichts Fesselndes oder Faszinierendes an ihm. Vielleicht wäre ein Fick möglich gewesen, wenn ich ihn mal im Why getroffen hätte. Wobei ich bezweifle, dass er der Typ ist, der einem den Arsch hinhält.
»Würdest du mit einem vögeln, nur weil er Geld hat?« Mo lehnt sich neben mich gegen das Bücherbord. Auch sein Blick ist auf das ungleiche Paar gerichtet.
»Hab ich nicht nötig«, erwidere ich lapidar – das Thema ist mir für heute Abend zu anstrengend.
»Ja, weil du selbst Geld wie Heu hast.«
»Der eine hat’s, der andere nicht.« Ich ziehe an meinem Strohhalm. Der Drink ist stark und löst dieses geile Prickeln in meinem Magen aus.
»Du bist ein arroganter Arsch, nicht besser als der Anwaltstyp.« Mo trinkt ebenfalls.
»Trotzdem liebst du mich«, stelle ich überheblich fest.
»Ja. Das stimmt. Apropos Liebe …« Er hält seine Hand mittig vor unsere Gesichter. »JoJo hat mir einen Ring gekauft. Was sagst du?« Von jetzt auf gleich ist seine Stimme um fünf Oktaven höher.
Ich versuche, seinem Finger die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken, obwohl mich im Moment alles andere mehr interessiert als das Ding, das aussieht, als wäre es aus einem Überraschungsei geschlüpft. Der Reif ist silbern, und da funkelt ein absolut unechter Stein in seiner Mitte.
»Schön«, sage ich, was Mo zum Lachen bringt.
»Schön billig, meinst du wohl.« Er grinst breit. »Aber es ist schon süß, dass er ihn gekauft hat, oder?«
Die beiden sind jetzt seit drei Monaten ein Paar. Eine schwule Ewigkeit sozusagen.
»Ja. Ist es«, gebe ich zu. JoJo – eigentlich Jonas – ist wirklich ein Glücksgriff. Bis auf seinen Job. Er ist Nachtwächter im naturhistorischen Museum, was für das Genießen des für uns typischen Nachtlebens ja nicht gerade förderlich ist.
»Noah. Alles Gute.« Ein feuchter Schmatz landet auf meiner Wange. Leider kann ich mich beim besten Willen nicht an den Namen des Typen erinnern, der ihn mir aufgedrückt hat – oder daran, ihn eingeladen zu haben. Wahrscheinlich ein Bekannter eines Bekannten. Mein Lächeln ist neutral – seines ebenfalls.
»Mickey sagte, ich kann mitkommen. Du hast doch kein Problem damit?«, erkundigt er sich lässig.
Hab ich nicht, was wohl vor allem daran liegt, dass ich auch Mickey nicht kenne – glaub ich zumindest. »Nein. Keineswegs«, erwidere ich daher.
»Na dann. Mickey wartet auf seinen Drink.« Der Gute deutet mit der Bierflasche zu seiner Linken Richtung Fenster.
Mich an meine Gastgeberpflichten erinnernd, sehe ich hinüber. Dort steht eine Gruppe Jungs, einer davon lächelt mir zu, als er meinen Blick bemerkt. Augenblicklich klärt sich das Rätsel. Mickey ist Michele, ein Typ, den ich aus der Sauna kenne. Der kleine Lockenkopf neben ihm strahlt mich ebenfalls an. Er kommt mir irgendwie bekannt vor, doch ich habe jetzt keine Lust, mich mit ihm zu beschäftigen. Ich möchte tanzen, also drücke ich Mo mein Glas in die Hand und begebe mich auf die Tanzfläche.
Der DJ ist wirklich gut. Er mischt Oldies mit modernem Beat, was den meisten Gästen äußerst gut gefällt. Ich genieße ein paar Lieder, ohne mich großartig um die Menschen rund um mich zu kümmern. Irgendwann strecke ich jedoch die Hände ein wenig mehr zur Seite. Schon schieben sich Finger zwischen meine, ziehen mich näher und wundervoll harte Ausbuchtungen von diversen Hosen drücken sich gegen meinen Arsch. Das und auch der Rhythmus der Musik bringt mich zum Schwitzen, und der Verlust des Wassers verschafft mir eine knochentrockene Kehle.
Blinzelnd sehe ich mich um, finde die Bar ein Stück hinter der Mauer von tanzenden Männern, die mich umgibt. Kaum habe ich das Ziel vor Augen, wird der Durst noch größer. Daher schiebe ich mich hektisch durch die Menge, und als ich die provisorisch aufgebaute Wasserstelle erreiche, fühle ich mich ein wenig, als wäre ich in der Wüste auf eine Oase gestoßen.
»Mai Tai«, krächze ich, und was soll ich sagen? Das »kommt sofort«, das ich als Antwort erhalte, lässt meinen Nacken kribbeln. Es ist ja jetzt nicht, als hätte ich vergessen, dass er hinter der Bar stehen würde. Verdrängt ist da vielleicht das bessere Wort.
Dorian macht sich mit einem Lächeln in den Mundwinkeln daran, mir den gewünschten Drink zu mischen. Dabei verlassen mich seine Augen nur, wenn es unbedingt sein muss. In mir drängt alles danach, etwas zu sagen, daher mache ich den Mund auf und lasse es einfach raus: »Mich würde da was interessieren. Du und Simon seid also Partner. Warum ist er dann zu Hause?«
Das weiß ich übrigens, weil ich vorhin einen der Gourmetlöffel herumtragenden Kellner nach ihm gefragt habe.
Dorians Augenbraue klettert ein Stückchen hinauf, ansonsten passiert nichts, vor allem erfolgt keine Antwort, also spreche ich weiter. »Und du bist noch hier. Ihr habt doch genug Leute. Warum musst du als Chef hinter der Bar stehen? Ich meine, das kann doch nicht die Erfüllung des Lebens sein, oder?«
Dieses Mal lächelt sein Mund wirklich, seine Augen werden jedoch starr und ich bekomme Bauchdrücken.
»Möchten Sie auch ein paar Nüsse dazu, Herr Benett?«, fragt er, ohne auf meine kleine Ansprache einzugehen.
Ich blinzle verwirrt. »Nein. Ich will keine Nüsse. Aber es würde von höflichen Umgangsformen zeugen, auf meine Frage zu antworten.«
Nun sticht sein Blick regelrecht zu, was seltsame Dinge mit meinem Magen anstellt. Der zieht sich nämlich zusammen.
»Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Arbeitsvertrag einen Passus enthält, worin steht: Es ist vereinbart, dem hochnäsigen, eingebildeten Rotzlöffel, der Sie angestellt hat, alle Fragen ohne Einwände zu beantworten«, erwidert Dorian mit leiser Stimme. Trotzdem geht sie mir durch und durch, und dieses Mal nicht im positiven Sinn. Es weckt Erinnerungen in mir. An mich, etwa sechsjährig, bibbernd vor meinem Vater stehend, weil ich wieder mal nicht nach Wunsch funktioniert hatte.
»Aber die höflichen Umgangsformen«, wende ich dennoch, wenn auch sehr kleinlaut, ein.
Sein Blick wird noch intensiver. »Darauf scheiß ich.«
»Äh – O-kay.«
Mein Mai Tai landet vor meiner Nase auf dem blank polierten Tresen, Dorian dreht ab und fragt den jungen Mann, der plötzlich wie durch Zauberhand neben mir steht, nach seinen Wünschen. Ich kenne den Typ nicht. So langsam habe ich überhaupt das Gefühl, auf einer fremden Party zu sein, nicht auf meiner eigenen.
»Du trinkst ohne mich?« Mo ist ebenfalls auf mysteriöse Weise wie aus dem Nichts aufgetaucht. Er grinst dümmlich, was mir verrät, dass es eher er ist, der ein oder zwei Drinks allein gekippt hat.
»Hey, Freund«, ruft er Richtung heißen Barkeeper. »Wärst du wohl so nett, und würdest mir auch so ein Ding hier mixen?« Er deutet auf mein Glas, und Dorian, der noch den Cocktailshaker für den anderen hin und her schwingt, lächelt freundlich. »Gern. Nur einen Augenblick Geduld, bitte.«
Täusche ich mich, oder ist diese Antwort von ihm besonders süßlich ausgesprochen? Ich versuche, ihn zu taxieren, was er mir erschwert, indem er betont geschäftig sein eigenes Tun beobachtet. In Seelenruhe bereitet er erst einen rosafarbenen Cocktail für den unbekannten Gast von vorhin und dann Mos Mai Tai zu.
Als kleine Entschädigung sehe ich mir ebenfalls seine Hände an, oder besser seine Finger. Sie sind lang und sehr feingliedrig. Nichts, das man erwartet, wenn man den restlichen Körper ins Gesamtbild mit einbezieht. Er trägt einen seltsamen Ring am rechten Ringfinger, doch bei genauerer Betrachtung erkenne ich, dass es sich um eine Tätowierung handelt. Einen Schriftzug, den ich aber leider, bedingt durch seine Bewegungen, nicht entziffern kann.
»Danke!« Mos Stimme schreckt mich auf. Ich blicke hoch, direkt in Dorians, für Mo lächelndes Gesicht. Nun ist es um etliche Nuancen heller.
»Darf es sonst noch etwas sein?«, fragt er höflich.
»Nein. Du hast mich absolut glücklich gemacht. Vorerst.« Mo nimmt sein Glas, prostet erst ihm, danach mir zu und marschiert von dannen.
»Ein Freund von dir?«, erkundigt sich Dorian, nun auch für mich wieder ganz der weltmännische Barmann.
Ich möchte ihm sagen, dass er sich seine neutrale Plauderei in den göttlichen Arsch schieben kann, tu ich aber natürlich nicht. Stattdessen präsentiere ich mein arrogantestes Lächeln. »Ja. Wir haben mal gefickt und so hat sich eine nette Freundschaft ergeben.« Mein Versuch, ihn zu schockieren, schlägt fehl. Wäre auch verwunderlich gewesen, wenn das funktioniert hätte.
»Sex ist eine wunderbare Grundlage für eine ehrliche, zwischenmenschliche Beziehung, ohne zu viel Gefühl zu investieren.« Er schnappt sich ein Geschirrtuch und beginnt damit, Gläser zu polieren.
»Ach ja?« Meine Lippen kräuseln sich, um meinen Zweifel zum Ausdruck zu bringen. »Dann ersetzt das Ficken das Vertrauen, oder wie?« Bereit, mich doch auf eine philosophische Diskussion einzulassen, schiebe ich meinen Arsch auf einen der Hocker und ziehe meinen Mai Tai vor mich, um mir den Trinkhalm mit dem Mund zu schnappen. Während ich zu saugen beginne, fangen mich Dorians Augen ein.
»Wenn man es richtig macht, ja«, meint er nach kurzem Zögern.
»Also lebst du ohne Liebe? Ich dachte, du bist mit Simon zusammen.« Jetzt bin ich neugierig geworden.
Ein spöttischer Zug verzieht Dorians volle Lippen. »Wir sind Partner. Im Geschäft und im Privatleben.«
»Private Partner? Wie darf ich mir das vorstellen?« Mein Mai Tai hat jede Faszination für mich verloren, ich kann nur ihn anstarren.
»Ich glaube nicht, dass dich mein Privatleben etwas angeht.« Der pappige Ton soll mich wohl in die Schranken weisen, doch da kennt er mich schlecht.
Ich bin ein verwöhnter ichbezogener Pinkel – ich lasse mich nicht so leicht verschrecken. »Was ist Dorian überhaupt für ein Name? Wo bist du her?«, setzte ich meine Befragung daher frech fort.
Sein Blick huscht umher, als könne er damit irgendjemand beschwören, an die Bar zu kommen und ihn aus dem Gespräch erlösen. Diesen Gefallen tut ihm aber keiner, also fügt er sich, wenn auch murrend. »Mein Vater kommt aus England, meine Mutter aus Österreich. Und ich meine erkannt zu haben, dass du ebenfalls einen leichten Akzent besitzt.« Das Grau seiner Augen ist plötzlich verschwunden, sein Blick so dunkel, dass mich fröstelt. Ich spüre meinen Atem schneller werden – was macht dieser Kerl nur mit mir?
»Das liegt daran, dass ich in den USA aufgewachsen bin«, gebe ich zu. »Mein Vater war von hier, meine Mum aus Frankreich, aber wir haben bis zu ihrem Tod in Boston gelebt.« Was weiß ich, warum ich ihm das erzähle? Interessanterweise scheint ihn das wieder etwas zu entspannen.
»Wann war das? Also, wann sind sie gestorben?«
»Vor vier Jahren. Heute hab ich offiziell alles geerbt, auch diese Villa hier. Und die Firma.« Meine Mundwinkel ziehen sich hoch. »Ich bin nämlich reich, weißt du?«
»Scheint so.« Upps – seine Laune ist wieder im Keller – und da soll einer mitkommen.
»Ich kann dir, also euch, sicher einige Jobs vermitteln«, bemühe ich mich um Wiedergutmachung.
»Nicht notwendig. Ich habe auch genug Geld …« Ein letzter vernichtender Blick trifft mich, der mir durch und durch geht. »Ich mach Pause«, teilt er mir danach mit, und irgendwie klingt er gerade gar nicht, als würde er für mich arbeiten.
»Seit wann stehst du auf böse Jungs?«, fragt Mo und nickt versteckt in Dorians Richtung. JoJo, der dank einer frühzeitigen Ablöse durch seinen Kollegen nun ebenfalls eingetrudelt ist, sieht interessiert hinüber. »Oh. Er ist groß, oder?«
Ich lasse meine Augenbrauen tanzen. »Na hoffentlich ist er überall groß.«
»Ich dachte, du bist lieber aktiv?« Mo schlingt einen Arm um JoJo, den anderen um mich.
Mein Kopf sinkt wie von selbst auf seine Schulter. »Aber deshalb darf ich doch damit spielen, oder?«
Die beiden lachen, und ich mit ihnen.
»Er sieht ständig zu dir«, raunt mir JoJo zu. Seine blonden Haare hängen ihm ins Gesicht, deshalb habe ich so meine Zweifel, ob ich seiner Beobachtungsgabe allzu viel Glauben schenken kann. Trotzdem riskiere ich einen Blick – wieder einmal.
Den ganzen Abend konnte ich meine Augen nicht länger als fünf Minuten davon abhalten, nach Dorian zu suchen. Er fasziniert mich, in gleichem Maß, wie mich unser seltsames Gespräch von vorhin durcheinandergebracht hat. Ist er nun Simons Freund oder nicht? Führen sie eine offene Beziehung? Meinte er das? Dass er grundsätzlich gern mal fremdvögelt – aber eben nicht mich, weil ich zu jung bin?
Dorian sieht zu uns, und für etwa eine Sekunde bin ich sicher, dass er uns gehört hat. Was natürlich nicht sein kann – wir stehen am anderen Ende des Raumes. Über die Entfernung weg verhaken sich unsere Blicke. Er wirkt irgendwie unzufrieden, dann schüttelt er leicht den Kopf und wendet sich ab.
Ich seufze. »Er hat ein Problem damit, dass ich noch nicht älter bin«, kläre ich meine Freunde auf.
Mo lacht. »Was ist denn das für ein Spießer? Wen kümmert, wie alt du bist, wenn du willig bist?«
»Na ja. Spießer würde ich ihn nicht nennen. Er ist tätowiert. So ein alberner Ring an der rechten Hand. Hab ich vorhin gesehen, als er mir den Drink gereicht hat.« In JoJos Augen ist eine Tätowierung gleichbedeutend mit einer Karriere im Knast. Als er mitbekommen hatte, dass meine Nippel gepierct sind, hätte er Mo beinahe den Umgang mit mir verboten. In Erinnerung daran schmunzle ich.
»Tattoo oder nicht. Was zur Hölle hat dein Alter damit zu tun, ob er dich geil findet oder nicht?« Mo versteht es nicht, und ich ja eigentlich genauso wenig, was ich deutlich zeige, indem ich meine Schultern hüpfen lasse.
»Er ist um einiges älter als wir. Vielleicht möchte er nicht ins Gespräch geraten. Männer, die sich einen Toy Boy halten, werden oft schief angesehen.« JoJos Erklärung, so wahr sie im Grundsatz auch ist, bringt mich nun endgültig zum Lachen.
Mo ebenfalls. Wir kichern um die Wette, und die Ausrede, dass die drei oder vier Mai Tais daran schuld sind, will ich einfach nicht gelten lassen.
»Ihr seid solche Idioten.« Der Vernünftige der Runde löst sich aus unserer Reihe und stellt sich demonstrativ einen Meter weg. Das heizt die vorherrschende Heiterkeit natürlich nur noch mehr an.
»Nachschub, die Herren?« Der heiße Barkeeper ist so abrupt aufgetaucht, dass mir mein Herz buchstäblich in die Hosen rutscht. Dort pocht es allerdings aufgeregt weiter, oder ist es etwas anderes, das so extrem auf seine plötzliche Nähe reagiert?
JoJo widmet Dorian sein eigens für Höflichkeitssituationen reserviertes, halbherziges Lächeln. Normalerweise strahlt er mit der Sonne um die Wette, jetzt erreichen seine Mundwinkel nicht einmal die erste Base. »Vielen Dank. Aber ich denke, die beiden Idioten haben ohnehin genug«, teilt er mit.
Mir ist mein Kichern vergangen, dafür wird Mos noch heftiger.
Ich sehe ihn an. Mit einer stummen Bitte auf meinem Gesicht, sich zusammenzureißen, was er aber ignoriert – natürlich.
»Noah? Möchtest du wirklich nichts mehr?« Dorians eindringliche und vor allem direkt an mich gerichtete Frage überrascht mich so sehr, dass ich automatisch nicke.
»Warum kommst du nicht mit in die Küche, ich könnte dir einen Kaffee machen?«
Erneut nicke ich – wie ein verdammtes hypnotisiertes Karnickel.
Er greift nach meiner Hand und zieht mich mit sich fort. Während die Gesichter meiner Gäste an mir vorbeiziehen, frage ich mich, was der Umschwung seiner Stimmung jetzt wieder soll. Einmal »Herr Benett« und »Sie«, dann »Noah« und »du«. Freundlich, herrisch. Verächtlich, einfühlsam. Beleidigt und beleidigend. Dieser Typ ist echt ein riesiges Fragezeichen für mich.
Wir verlassen den Salon, und kaum im Korridor angekommen, wird Dorian noch schneller. »Vielleicht doch besser …« Er sieht über die Schulter zu mir zurück, lässt mich zu meinem Bedauern aber los. »… wo ist dein Schlafzimmer?«
»Oben«, japse ich. Gleichzeitig ärgere ich mich wegen der Offensichtlichkeit, mit der er mich einschüchtert.
Ihm hingegen scheint das zu gefallen. »Zeig mir wo, Noah.« Ein leiser Befehl.
Ich gehorche. Warum auch immer gehorche ich? Ich erkenne mich nicht wieder. In Dorians Gegenwart fühle ich mich wie ein Kind – und zwar eines, das unartig gewesen ist.
Vor meinem Schlafzimmer angekommen, bleibe ich stehen. Dorian mit mir, doch er hält mich zurück, als ich weitergehen will. Verwirrt sehe ich ihn an, seine Miene ist ein Meer der Zweifel.
»Was ist?«, frage ich also.
Er antwortet nicht, stattdessen beugt er sich zu mir, bis seine Lippen nur mehr einen oder zwei Millimeter von meinen entfernt sind.
Ich kann ihre Wärme fühlen. Meine Finger kribbeln, wollen ihn berühren, doch noch dringender will ich ihn küssen. Mein Kopf ruckt nach vorn, und endlich spüre ich seinen Mund auf meinem.
Wir seufzen beide.
Etwas stupst gegen meine Unterlippe – es ist Dorians Zungenspitze und ich lasse sie nur zu gern ein. Hitze steigt in mir auf. Er berührt mich, seine Hand streicht fest über meinen Rücken. Fast zu fest, aber das ist egal. Der Druck, mit dem er mich an sich presst, lässt meinen Atem stocken. Oder ist es doch sein Kuss? Seine Zunge wagt sich weiter vor. So schüchtern hätte ich sie nicht eingeschätzt. Ich begrüße sie mit meiner – ein sanftes Hallo, das ihm einen leisen Laut entlockt.
Ermutigt lege ich meine Hände auf seine Brust. Sie ist fest und warm, unter dem weißen Hemd – ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Dorians Rechte ruht nun auf meinem Arsch, seine Linke an meinem Steißbein. Er zieht mich noch näher, lässt mich spüren, was seine schwarze Stoffhose kaum mehr verbergen kann. Oh Gott, ist das geil. Mir entkommt ein Stöhnen, dann vertiefe ich unseren Kuss, versuche meinerseits, meine Zunge in seinen Mund zu drängen.
Leider hat mein Vorstoß die komplett gegenteilige Wirkung, denn er schreckt augenblicklich mit einem scharfen Einatmen von mir zurück. Gleichzeitig lässt er mich los und bringt etwa einen Meter zwischen uns.
»Dorian …«, bringe ich heraus, breche aber ab, als er ein energisches »Nicht« hervorstößt.
»Was?«, stammle ich, lege meine Hand an meine Stirn und versuche zu verstehen, was hier gerade vor sich geht.
»Du bist unheimlich niedlich, Noah. Aber …« Er entfernt sich rückwärtsgehend ein paar Meter. Worte kommen keine mehr über seine Lippen, stattdessen verzieht er sie zu einem traurigen Lächeln.
»Dorian. Was soll das?«, frage ich perplex.
»Wenn es für Sie in Ordnung ist, werde ich jetzt gehen, Herr Benett. Meine Jungs werden klar Schiff machen, wenn die Feier vorüber ist.«
Seine Worte treffen mich, wie ein Baseballschläger den wehrlosen Ball. »Was?«, bringe ich irgendwie hervor.
»Es war mir ein Vergnügen, Ihre Geburtstagsfeier auszurichten, Herr Benett. Ich hoffe, Sie empfehlen uns weiter.«
Dann geht er, und ich bleibe zurück.
Fassungslos.
Planlos.
Und mit einem hammerharten Schwanz.
Fünf Minuten später begebe ich mich wieder nach unten in den Salon. Von Dorian ist nichts zu sehen. Ein glatzköpfiger Typ steht nun hinter der Bar. Ich bewege ungläubig meinen Kopf hin und her. Das kann doch nicht wahr sein.
Ein Arm legt sich um meine Mitte. »Da bist du ja.« Es ist Sally. Um das zu erkennen, hätte ich nicht mal seine Sing-Sang-Stimme hören müssen, der süßliche Duft seines viel zu großzügig aufgetragenen Parfums ist Indiz genug.
»Amüsierst du dich?«, frage ich ihn.
»Ja. Sehr. Du hast dich wieder mal selbst übertroffen.« Er haucht mir ein Küsschen auf die Wange und lehnt dann seinen Kopf an meine Schulter.
»Wird dein Ringstraßen-Yuppie nicht eifersüchtig, wenn wir hier so kuscheln?«, erkundige ich mich süffisant. Langsam, aber sicher legt sich der Druck, den Dorians abrupter Abgang in mir hervorgerufen hat, und meine gute Laune kehrt zurück.
»Andreas musste schon weg. Er hat morgen früh ein Meeting«, erklärt er mir ernsthaft.
Ich verdrehe die Augen. »Ein Meeting. Am Sonntag?«
»Ja. Wenn man einen wirklich wichtigen Job hat, kann das schon mal vorkommen.«
»Oder man ist nur ein kleines Rädchen in einem großen, großen Getriebe und muss daher die Drecksarbeit machen, während die wirklich wichtigen Leute ihr Wochenende genießen können.«
Gekränkt zieht er seine Nase kraus. Diese Geste kenne ich nur zu gut. Das macht er immer, wenn ich recht habe und er nicht. Verbal bestätigt bekomme ich das natürlich nicht. Stattdessen lässt er mich los und verschränkt schmollend die Arme vor der Brust.
»Ach komm schon, Schatz.« Ich schiebe ebenfalls meine Unterlippe vor und neige den Kopf, während ich ihm ins Gesicht blinzle. »Wir wollen doch nicht streiten. Ich habe doch immer noch Geburtstag.«
»Du bist so blöd manchmal«, beschwert er sich, allerdings nur mehr halbherzig.
»Das war ja keine lange Nummer.« Mo ist neben mir aufgetaucht, JoJo hängt an seiner Seite.
Ich blase die Luft aus. »Hast du ihn runterkommen sehen?«, frage ich.
»Nein«, lautet die knappe Antwort von JoJo. Mo grinst nur dämlich. »Also kein superschneller Quickie – er hat tatsächlich einen Rückzieher gemacht.«
»Wer sagt das?«, kontere ich, doch selbst ich kann hören, wie schwach meine Stimme klingt.
»Niemand, aber dein immer noch steifer Schwanz erzählt es mir.« Er deutet auf die deutlich sichtbare Beule in meiner Hose.
Die anderen folgen seinem Beispiel. Sallys Blick weilt besonders lange auf meiner jeansverpackten Härte, dann seufzt er. »Sieht vielversprechend aus, warum haben wir zwei eigentlich nie gefickt?«
»Weil du nicht mein Typ bist«, kontere ich angepisst. »Könnten wir uns jetzt bitte anderem zuwenden?«
»Schon gut. Bist du immer so gereizt, wenn du untervögelt bist?« Sally schaltet wieder in den Schmollmodus.
»Lass ihn, Prinzessin. Das Beste ist, wir suchen ihm einfach einen Ersatz.« Mo versucht das – oder besser mein – Problem praktisch zu lösen. Er lässt seinen Blick durch den Saal schweifen.
Ich halte von dieser Option im Moment recht wenig. Klar verlangt es mich nach Erleichterung, doch die kann ich mir im Notfall auch nachher selbst verpassen. »Ich hol mir einen Drink«, erkläre ich daher und mache mich auf in Richtung Bar.
Zu meinem Missfallen folgen mir die drei. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich gerade lieber allein sein möchte. Vielleicht weil es mich immer noch anpisst, dass ich von diesem scharfen Barkeeper abgewiesen worden bin. Na ja – ehrlicherweise ist er der Besitzer oder zumindest Mitbesitzer der Catering-Firma. Trotzdem ist er ein arrogantes Arschloch. Mich erst so heißzumachen und dann zu verschwinden.
»Vier Mai Tai«, bestellt Mo, kaum dass wir bei dem Ersatz-Glatzkopf-Barmann angekommen sind.
»Drei. Ich bevorzuge ein Glas Weißwein«, korrigiert ihn Sally lächelnd.
»Na dann. Ein Glas Chardonnay für die Dame«, ätzt Mo, lässt sich auf einem der Hocker nieder und zieht mich auf den neben sich. »Nun sag schon. Warum hat er dir so ein Rohr verpasst und dann nicht weitergemacht?«
»Wenn ich das wüsste«, gebe ich kleinlaut zu.
Mo beugt sich näher zu mir herüber. »Er ist ein Idiot, Noah. Schnapp dir einfach einen anderen und fick den Ärger weg.«
Ich sehe ihn an. Ist das sein Ernst? Seine Miene zeigt mir deutlich: Ja. Ist es.
JoJo umschlingt Mo von hinten. »Was heckt ihr zwei denn schon wieder aus?«, erkundigt er sich amüsiert.
»Wir suchen ein Abreaktionsprojekt für Noah.« Mos Erklärung bringt seinen Schnuckel zum Grinsen.
»Wie wär’s mit dem Süßen da drüben? Der sabbert ihn doch geradezu an.«
Wir folgen seinem Deut mit dem Kinn. Dort stehen Mickey und drei andere Typen. Erneut fällt mir auf, dass der Kleinste unter ihnen mir irgendwie bekannt vorkommt. Scheinbar ist er auch der, den JoJo für mich auserkoren hat. Zumindest lässt sein verträumt gehauchter Kommentar das vermuten: »Er sieht ein bisschen wie ein Engel aus, oder?«
»Haben Engel nicht blonde Haare?«, wirft Sally ein. Er spielt abwesend mit dem Stiel seines Weinglases.
»Wer will denn schon einen Engel vögeln?«, stellt Mo fest. Auch er hält bereits seinen Cocktail in den Händen, also greife ich mir meinen ebenfalls.
Der Lockenkopf lächelt mich an, ich lächle zurück. Daraufhin legt er den Kopf schräg und zieht seine Nase kraus. Wirklich niedlich.
Genussvoll ziehe ich an meinem Strohhalm. Noch einmal wandern meine Gedanken zu Dorian. Zu seiner machtvollen Stimme, den fesselnden Blicken und der Wirkung, die er, warum auch immer, nun mal auf mich hat. Doch er wollte nicht. Mich nicht. Also schiebe ich ihn zur Seite, so wie mein Glas ebenfalls. Dann stehe ich auf, um mir den kleinen Engel aufzureißen.
Kapitel 3
Meine Zunge ist pelzig und der Geschmack rund um sie ekelhaft. Ich kann die Augen nicht öffnen, doch auch ohne Helligkeit brennen sie wie Feuer. In meinem Kopf herrscht Krieg. Ich fühle mich, als hätte ich ihn bereits verloren und wäre anschließend ausgekotzt worden. Also liege ich mit geschlossenen Lidern da. Darüber grübelnd, wie genau ich in diesen Zustand geraten bin.
Langsam fallen mir einige Details ein. Ich meine damit Dinge, außer den Tatsachen, die mit reichlich Alkohol und einer Demütigung durch Mister-Sexy-Barkeeper zu tun haben. Nachdem mich Dorian gestern mit einem pochenden Ständer und gebrochenem Stolz hat stehen lassen, musste ich einfach noch die Sau herauslassen. Bis fünf Uhr morgens hatten der ein oder andere Mai Tai meine Laune wiederhergestellt. Zum Glück blieben, als sich die Party gegen vier auflöste, Mo, JoJo, Sally und dieser wirklich süße Lockenkopf über. Sie leisteten mir bis zum bitteren Ende Gesellschaft. Das wurde von mir mit einer abschließenden Flasche Champagner gewürdigt. Und danach hatte wohl der berühmte Filmriss zugeschlagen.
Nach der Müdigkeit meiner Glieder zu schließen, kann es noch nicht später als Mittag sein. Mo und JoJo schlafen im Nebenzimmer, Sally im Gästezimmer im Westflügel, und der niedliche Kleine – ich riskiere ein Auge – ja, der liegt neben mir. Nackt. Und mit einem ziemlich zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht. Ich versuche, mich an seinen Namen zu erinnern, aber irgendwie ist da nichts. Außer ein paar– wenn auch äußerst ansprechende – Bilder, die mir recht plastisch erzählen, wie viel Spaß wir beide heute Nacht hatten.
»’n Morgen«, nuschelt er. Sein Lächeln ist immer noch da, doch jetzt strahlen seine Augen ebenfalls.
»Morgen«, erwidere ich, während ich mich auf meine Unterarme aufstütze, dabei bemühe ich mich, nicht in seine Richtung zu atmen. Das ist keine Option. Zumindest nicht, bevor ich Zähne geputzt habe.
»Wie fühlst du dich?«, erkundigt er sich fürsorglich.
Ich rümpfe die Nase. »Ich war wohl ziemlich hinüber. Gestern.«
»Ja. Ein wenig.« Er sieht süß aus, wie er so verträumt zu mir nach oben guckt.