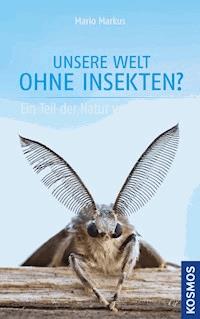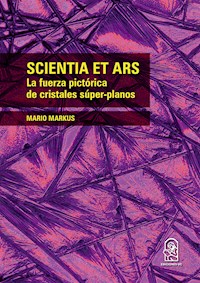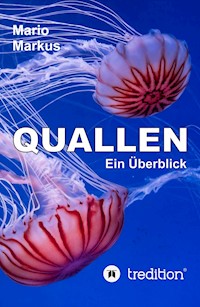
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vor 3,8 Milliarden Jahren sind die ersten lebenden Zellen auf der Erde entstanden. Gefüge aus mehreren Zellen, darunter Quallen, gibt es seit 540 bis 640 Millionen Jahren. Die Quallen haben seitdem ihre Tentakel, ihre Fortbewegung und Millionen kleine giftige "Spritzen", mit denen sie Beute töten oder sich verteidigen. Sie haben einen Mund, Augen, Geschlechtsteile und einen Magen, aber keine Lunge und kein Herz. Es gibt männliche und weibliche Quallen. Zwei Nobelpreise sind verliehen worden, aufbauend auf der Forschung mit Quallen. Einer ging 1913 an Charles Richet und Paul Portier für ihre Untersuchung der Anaphylaxie, einer extrem starken allergischen Reaktion des Immunsystems. Als Optimum benutzten sie dabei das Gift einer Qualle. Der andere Nobelpreis ging 2008 an Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien für die Entdeckung des Proteins GSP in einer Qualle, welches, wenn es mit einem anderen Protein gekoppelt in einen Organismus injiziert wird, anzeigt, wo sich das zweite Protein normalerweise anlagert. Dazu beleuchtet man mit UV-Licht und schaut nach grüner Fluoreszenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mario Markus
Quallen
Copyright: © 2021 Mario Markus
Lektorat: Christa Hornemann
Buchsatz: Sabine Abels
Titelbild: © Shutterstock. Autor: H. Tanaka
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-40886-9 (Paperback)
978-3-347-40887-6 (Hardcover)
978-3-347-40888-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Ich danke herzlich Christa Hornemann für ihr wertvolles Lektorat und Sabine Abels für das Buchlayout.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort – Eine Zeitreise
Der Mythos der Medusa
Pflanze oder Tier?
Allgemeines über Quallen
Cnidaria
Nickend aber schwach
Corymorpha nutans
Auf dem Kopf stehende Qualle
Cassiopea andromeda
In 7000 Meter Tiefe: Die Kronenqualle
Periphylla eoriphylla
Fest vor Kanada verankert: Die Stielqualle
Manania handi
Rekordschwimmer in der Arktis
Aglantha digitalis
Büsche von Federn
Aglaophenia pluma
Ein Auge an jedem Tentakel
Bougainvillia superciliaris
Federn im Indischen Ozean
Gattya humilis
Die Fingerhutqualle
Linuche aquila
Eine steife und eine biegsame Form
Halecium
Die historisch erste Begegnung mit Quallen in der Tiefsee
Livernaria janetae
Seit 1921 verschollen
Craspedacusta iseana
Lieber pirschen als auf Beute warten
Solmissus
Die gefürchtete Amakusa-Feuerqualle
Sanderia malayensis
Ein Mund in jedem Arm
Catistylus mosaicus
Millionen Euro Verluste durch den Suez Kanal
Rhopilema nomadica
Nobelpreis für die Entdeckung eines Quallenproteins
Aequorea victoria
Das zweitlängste Tier der Welt: eine Qualle
Praya dubia
Gigantischer Teppich auf der Meeresoberfläche
Chondrophoren
Ein wahrlich unsterbliches Tier
Oceaniidae
Alle Koloniemitglieder durch Röhren verbunden
Solanderiidae
Stapel von Platten
Milleporidae
Große Beute wird vor dem Essen außen verdaut
Rhizostomae
Sehr selten Sex
Limnomedusae
Ein Staat von Quallen
Siphonophorae
Gelbes, grünes oder violettes Meer
Semaeostomeae
Ein fallendes Netz
Cyanea lamarckii
Quallen als Parasiten von Quallen
Narcomedusae
Muskelprotze
Trachymedusae
Die »Löwenmähne ist schuld« sagt Sherlock Holmes
Cyanea capillata
Ein Hospiz für Fische
Cotylorhyza tuberculata
Effiziente Augenlinsen
Aurelia aurita
Erbrechen nach Berührung
Pelagia noctiluca
Milliarden Quallen rund um Japan
Stomolophus nomirai
Nur gefilterte Nahrung
Rhizostoma octopus
Invasion in Mexiko
Phyllorhiza punctata
Zuerst männlich, dann zwittrig, dann weiblich
Chrysaora hysoscella
Atypische Körperform: Eine »Monster-Qualle«
Rhopilema virrilli
Der Magen halb so groß wie der Körper
Aequorea forskalea
Die »Quallenblüte«: Ein schwimmender Teppich aus Millionen von Quallen
Rhizostoma pulmo
Die Stiche können psychiatrische Folgen haben
Gonionemus vertens
Unfähig zu schwimmen
Stauromedusae
Nur der Kopf ragt aus dem Polypenrohr
Coronatae
Augen fast so gut wie beim Menschen
Chironex flexkeri
Quallen als Nahrung
Rhizostomae und andere
Eine besondere Delikatesse
Rhopilema esculenta
Süßwasserquallen
Craspedacusta sowerbii
Die Segelquallen
Velella velella
Endlich Frieden: Kleben statt Stechen
Anthoatecata
Mund-zu-Mund Fortpflanzung
Stomolophus meleagris
Eine Qualle mit Balztanz
Cubozoa
Rippenquallen: Ohne Giftnesseln geht es auch
Haeckelia
Ein Tier mit insgesamt nur 300 Megabyte
Hydra viridissima
Ferngesteuerte Killerkugeln
Cassiopea xamachana
Nachtaktive Quallen
Copula sivickisi
Quallen fressen Quallen
Berroe cucumis
Die Seestachelbeere: Verhasst in der Nordsee
Pleurobrachia pileus
Bekämpfung von Quallenplagen mit Quallen
Bolinopsis infundibulum
Quallen als wirtschaftliche Verbrecher
Mnemiopsis leidyi
Das »Gefühl des nahenden Todes«
Carukia barnesi
Meisterhaftes Schwimmen und Senkrechtstart
Aurelia labiata
Krebse im Magen fressen Schädlinge auf
Chrysaora colorata
Perfekt würfelförmiger Kopf
Carybdea marsuppialis
Neuerdings exklusiv in Neuengland
Chrysaora quinquecirrha
Brutpflege
Chrysaora fuscescens
Ist es eine Art oder zwei, drei, vier oder fünf?
Mastigias papua
Krebse huckepack
Phacellophora camtschatica
Quallen im Kino
Quallen in der bildenden Kunst
Ewiges Leben?
Werden uns die Quallen besiegen?
Quallen halten Einzug in der Lyrik
Literatur
Bildautoren
Über den Autor
Vorwort – eine Zeitreise
Quallen gehören zu den ältesten mehrzelligen Wesen auf unserem Planeten. Wir haben es somit wahrlich mit einer Zeitreise zu tun.
Funde in den USA, in Illinois und Utah, aus dem Proterozoikum (vor 250 bis 541 Millionen Jahren) werden auf ein Alter von 550 Millionen Jahre geschätzt. Sie werden noch durch Funde aus dem Neoproteozoikum (vor 1.000 bis 541 Millionen Jahren) aus China übertroffen, die auf ein Alter von 635 bis 577 Millionen Jahre geschätzt werden. Doch diese Angaben sind umstritten, da auch die C14-Methode zur Datierung nicht immer zuverlässig ist. Unumstritten ist allerdings das Stattfinden der sogenannten Kambrischen Explosion, die vor 541 Millionen Jahre geschah und aus der letztendlich alle uns bekannten Tiere hervorgingen.
Sehr unsicher ist auch der Stammbaum bzw. die Reihenfolge der Erscheinung mehrzelliger Tierarten: Schwämme, Gewebetiere, Hohltiere, Nesseltiere usw.
Man lese dieses Buch jedenfalls mit dem Gefühl, dass wir es hier mit Repräsentanten einer Zeit zu tun haben, in der Lebewesen von einzelnen Zellen zu organisierten, miteinander kommunizierenden Wesen wurden. Es ist in dieser Hinsicht auch ein Buch der Genesis der Tiere. Es bleibt die Frage: Wie fanden die Zellen zueinander und differenzierten sich so weit aus, dass sie durch eine große Zahl verschiedener Aufgaben ihrer Zellgemeinschaft dienen können.
Der Mythos der Medusa
Medusen, so wie sie in diesem Buch beschrieben werden, benennt man nach einer weiblichen Gestalt aus der griechischen Mythologie. Diese Gestalt, die detailliert in Ovids Metamorphosen beschrieben wird, war sowohl schön, wie auch giftig. Ihr Haupt war bedeckt von Schlangen und ihr Blick verwandelte die Menschen in Gestein.
Perseus, ein Sohn des Zeus, wurde beauftragt, die Medusa zu enthaupten. Um nicht in einen Stein verwandelt zu werden, sah er Medusa als Spiegelbild in seinem Schild während er sie mit seinem Schwert enthauptete. Aus dem verbleibenden Rumpf sprangen Pegasus, ein fliegendes Pferd, und Chrysaor, ein Krieger mit einem goldenen Schwert. Der abgetrennte Kopf der Medusa lebte weiter. Elemente dieses Mythos findet man in echten, biologischen Quallen wieder. Ihre erwachsenen, sich geschlechtlich fortpflanzenden Formen nennt man Medusen. Die Griechen hatten diese Lebewesen genau beobachtet – das Wissen wir aus den Schriften des Aristoteles. Die Schlangen auf dem Kopf und die Schönheit der mythologischen Medusa entsprechen jeweils den giftigen und teilweise tödlichen Tentakeln und der Schönheit dieser Lebewesen. Das Entstehen von Wesen nach dem Schlag des Perseus beobachtet man bei Quallen in einer ihrer Lebensetappen, nämlich der Strobilation (Siehe Kapitel »Allgemeines über Quallen« in diesem Buch), in der sich scheibenweise junge Quallen abtrennen und sich dann zu erwachsenen Tieren entwickeln. Das Weiterleben des Kopfes im Mythos entspricht der erstaunlichen Eigenschaft der Quallen, deren Körperteile nach einer Trennung weiterleben. Bei Quallen geht es allerdings noch so weit, dass jeder der getrennten Teile den fehlenden Teil regeneriert, ein Vorgang der den Griechen in ihrem Mythos wohl nicht passte.
Pflanze oder Tier?
Aristoteles (384–322 v. Chr.), der einen Teil seines Lebens an der Ägäischen Küste verbrachte, hatte oft die Gelegenheit, Quallen zu beobachten. Er nannte sie Aealephs, was auf Griechisch »Nadeln« bedeutet, anspielend auf die giftigen Nadeln der Quallen. Er stellte die Frage, ob es sich um Pflanzen oder Tiere handele und ließ die Frage offen. Was ihn verwirrte war, dass er keine Blutgefäße sah, wie es auch bei Pflanzen der Fall ist, aber eine erstaunliche Empfindlichkeit bei Berührungen, wie bei Tieren.
Plinius der Ältere (24–79 n. Chr.) schloss sich der incertae sedis, das heißt dem Rätsel von Aristoteles an und dies tat sogar auch noch viel später Carl von Linné (1707–1778). Ein philosophisches Urteil kam dann von dem Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788), der die Trennung von Tieren und Pflanzen verneinte und angesichts der Quallen, Anemonen und Korallen, so wie einzelnen, getrennt betrachteten Eigenschaften von Tieren und Pflanzen, ein Kontinuum zwischen Tieren und Pflanzen postulierte.
Der nächste Schritt wurde 1800 durch Napoleon möglich. Er schickte ein Schiff um die damals noch unerforschte Terra Australis, der heutigen Antarktika, unter der Leitung von Francois Péron (1775–1810). Von der Besatzung mit 24 Mann kamen nur sechs zurück. Péron und auch Napoleon interessierten sich unter anderem für die rätselhaften Quallen, die während dieser Fahrt untersucht wurden. Péron hatte drei Jahre Medizin studiert und brach das Studium ab, doch er besaß genug Kenntnisse, um Quallen zu sezieren und festzustellen, dass sie zwar ein Netz von Nerven besitzen, aber kein dichtes Netzwerk, dass man als Gehirn bezeichnen kann. Auch haben sie kein Körperteil, dass man, physiologisch betrachtet, als Kopf bezeichnen könnte.
Es folgten die Untersuchungen von Christian Ehrenberg (1795–1876), Professor der Zoologie in Berlin. Er stellte als erster fest, dass Quallen einen Muskelring besitzen und – bis dahin übersehen – typischerweise 24 Augen. Diese befinden sich in symmetrisch angeordneten Gliedern rund um die Mundöffnung. Meistens sind es sechs Augen pro Glied, so dass ein für den Menschen beneidenswerter Überblick möglich ist. Es gibt allerdings auch Arten, bei denen ein Auge am Ende eines jeden Tentakels ist. Sein definitives Urteil war: Es sind Tiere.
In der Reihe der Quallenforscher war dann der norwegische Geistliche und Biologe Michael Sars (1805–1869) an der Reihe. Ihm verdanken wir das Wissen über die Metamorphose der Quallen: Die ausgewachsene, schöne Meduse, die Eier freilässt, die daraus entstehenden Larven, sie sich zu Polypen wandeln und die Abtrennung von Scheiben (Strobilation) im oberen Teil der Polypen. Jede Scheibe entwickelt sich zu einer Meduse. Dabei pflanzen sich die Medusen meistens geschlechtlich und die Polypen durch Knospung fort. Sars bestätigte das Urteil von Ehrenberg, dass es sich bei Quallen um Tiere handelt.
Doch ein neuer Grund für Streit trat auf: Die beeindruckende Eigenschaft von Quallen riesige Kolonien zu bilden. Ein Beispiel ist die sehr giftige Portugiesische Galeere Physalia physalis. Dies wird detaillierter im Kapitel »Ein Staat von Quallen« in diesem Buch besprochen. In diesen Kolonien übernehmen die einzelnen Individuen verschiedene Aufgaben: Bewegung, Vermehrung, Verdauung, Reaktion auf äußere Berührung und Schwimmen. Die Individuen sind über Kontakte ihrer Nerven vernetzt. Hier stellt sich nicht mehr die alte Frage »Pflanze oder Tier?«, sondern eine völlig neue Frage: »Individuen oder Verband?« Man diskutierte dies mit einer quasi-soziologischen Haltung, die nicht weit entfernt von der Soziologie des Menschen liegt. Thomas Henry Huxley (1825–1895), der für die Akzeptanz des Darwinismus eintrat und dadurch für viele Menschen bekannt wurde, vertrat die Ansicht, dass es sich um Individuen handelt, die zweckmäßig kooperieren. Louis Agassiz (1807–1873), einer der ersten renommierten US-Wissenschaftler, sprach von der Kolonie als wäre sie ein einziger, großer Organismus. Der Deutsche Mediziner und Naturforscher Ernst Haeckel versuchte den Streit zu schlichten, indem er von der Existenz eines Kontinuums zwischen Individuum und Verband sprach. Solch einem Kontinuums-Gedanken begegneten wir schon weiter oben bei der Frage »Mensch oder Tier?« in den Gedanken des Forschers Georges-Louis Leclerc de Buffon.
Allgemeines über Quallen
Quallen gehören zum Stamm der Nesseltiere. Andere Stämme sind zum Beispiel die Mollusken, auch Weichtiere genannt und die Wirbeltiere. Große Nesseltiere, zum Beispiel jene der Klasse der Schirmquallen, haben keine Fressfeinde, so dass sie an der Spitze der Nahrungskette stehen.
Nesseltiere werden in fünf Klassen unterteilt:
1. Die Blumentiere (7500 Arten). Zu ihnen gehören die Seeanemonen und die Korallen. Sie kommen in diesem Buch nicht vor.
2. Die Stielquallen (50 Arten).
3. Die Würfelquallen (50 Arten).
4. Die Schirmquallen (200 Arten) mit den Ordnungen Kranzquallen, Fahnenquallen und Wurzelmundquallen.
5. Die Hydrozoen (3500 Arten).
Früher zählte man noch die Rippenquallen zum Stamm der Nesseltiere. Heute werden sie als eigener Stamm betrachtet, der mit den Nesseltieren wahrscheinlich nicht nah verwandt ist. Der alten Tradition folgend, werden sie in diesem Buch trotzdem so behandelt als wären sie Nesseltiere. Dieser Stamm sowie die oben aufgeführten Klassen 2., 3., 4. und 5. werden in diesem Buch beschrieben, nicht aber die Klasse 1, da sie schon in mehreren guten Büchern beschrieben worden ist.
Die wichtigste und namensgebende Eigenschaft der Nesseltiere ist der Besitz giftiger Nesseln, welche diese Tiere in Nesselkapseln erzeugen. Die Kapseln enthalten einen spiralförmig gewickelten Faden aus festem Material, der mit einem Druck von ca. 150 bar in das Opfer hineingestoßen wird. Die Nesseln dienen dem Beutefang und der Verteidigung. Im Allgemeinem werden die Nesselkapseln nach Gebrauch abgestoßen und durch neue Kapseln ersetzt.