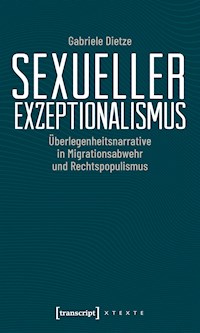Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik der Geschlechterverhältnisse
- Sprache: Deutsch
Nach der Corona-Pandemie sind heute zwei Narrative dominant: im allgemeinen Diskurs ein Nichts-mehr-davon-wissen-wollen, im populistischen Diskurs eine Politisierung der Einschätzung des staatlichen Umgangs mit Covid-19 als Symptom eines angeblichen Systemversagens. Das Buch will der Amnesie des kulturellen Gedächtnisses über die Pandemiewirklichkeit entgegenwirken: Es rekonstruiert damalige Affekt- und Gefühlslandschaften am Beispiel von autofiktionaler Literatur, Hollywood-Blockbustern wie »Barbie« oder deutschen Fernsehformaten wie dem »Tatort«. Entgegen der Annahme, man habe schnell zur alten Normalität zurückgefunden, lassen sich dort zentrale Verschiebungen in den Domänen Freiheit, Liebe, Alter und Tod einer Neuen Normalität beobachten: Es werden zerstörerische Momente der okzidentalen Freiheitswut problematisiert, der Mythos der romantischen Liebe als Herrschaftsform herausgefordert, und man begegnet einer neuen Akzeptanz des Alters und einer Rückholung des Sterbens ins Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Dietze
Quarantäne-Kultur
Fiktionale Echoräume von Covid-19
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Nach der Corona-Pandemie sind heute zwei Narrative dominant: im allgemeinen Diskurs ein Nichts-mehr-davon-wissen-wollen, im populistischen Diskurs eine Politisierung der Einschätzung des staatlichen Umgangs mit Covid-19 als Symptom eines angeblichen Systemversagens. Das Buch will der Amnesie des kulturellen Gedächtnisses über die Pandemiewirklichkeit entgegenwirken: Es rekonstruiert damalige Affekt- und Gefühlslandschaften am Beispiel von autofiktionaler Literatur, Hollywood-Blockbustern wie »Barbie« oder deutschen Fernsehformaten wie dem »Tatort«. Entgegen der Annahme, man habe schnell zur alten Normalität zurückgefunden, lassen sich dort zentrale Verschiebungen in den Domänen Freiheit, Liebe, Alter und Tod einer Neuen Normalität beobachten: Es werden zerstörerische Momente der okzidentalen Freiheitswut problematisiert, der Mythos der romantischen Liebe als Herrschaftsform herausgefordert, und man begegnet einer neuen Akzeptanz des Alters und einer Rückholung des Sterbens ins Leben.
Vita
Dr. Gabriele Dietze, geboren in Wiesbaden, war nach ihrem Studium der Germanistik und Philosophie in Frankfurt/M. von 1980 bis 1990 Lektorin für Gegenwartsliteratur im Rotbuch Verlag. Sie forschte und lehrte an der Humboldt Universität zu Berlin in Kulturwissenschaft, Gender- und Medienstudien. Zuletzt war sie Gastprofessorin am Dartmouth College.
In this wake-up call for our existence,the pandemic can be regarded as a gift.But are we ready to accept it? Can we act on it?Can we unlearn our habitual practicesand imagined modes of expertise,and in this process, acquire a new humility?Rustom Bharucha
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einleitung
Fiktionen einer Kultur der Quarantäne
Von den Schwierigkeiten, eine Pandemie zu erzählen
Nicht verstehen
Intersektionalität
Vier Metanarrative
A Freiheit
B Liebe
C Alter, Sterblichkeit und Tod
D Gerechtigkeit
Verschiebungen
Gedächtnispolitik
Forschungsübersicht
Kapitelstruktur
Coda
1.
Unheimliche Präsenz
Sehen und Zeigen
Tatort Pandemie
DIE DRITTE HAUT
DER FEINE GEIST
HEILE WELT
Lockdown – Lockout – Lockin
Big Screen
THE MENU – Das letzte Abendmahl
TRIANGLE OF SADNESS - Schiffbruch mit Marx
Klassenverachtung Techno-Eliten und Unsterblichkeit
THE GLASS ONION - Elon Musk und Freunde
2.
Zerbrochene Spiegel
Autofiktion als Archiv für Alltagserfahrung
Das ohnmächtige Ich
Gekränkte Freiheit – Spuren von Quer
Neuverhandlung von Geschlechtergerechtigkeit
Die Wut, die bleibt – Ein feministisches Manifest
Wellen - Caring Masculinity
Autofiktion-Autobiographie-Autotheorie
3.
Romantische Tragödie – Lockdown Love
Liebe – Strategie und Versprechen
Genregeschichte als Zeitgeschichte
Lockdown Love
Quarantäne als moralische Anstalt
LOCK DOWN LOVE
TOGETHER
In Serie gehen
Die Dramedy
Die neue Corona-Frau
You can’t quarantine Love
Finale Lösung
4.
Weiße Scham – I Can’t Breathe
Die Ermordung von George Floyd
Affektbrücke Weiße Scham
Whiteness als Kategorie
Der Mann, der nicht aus seiner Haut kann
Racial Reckoning in der Workplace-Sitcom SUPERSTORE
Racial Reckoning in der Mittelklasse – Dramaserien
THIS IS US – Ein Familiendrama
THE GOOD FIGHT – Ein legal Drama
5.
Sterben lernen
Anamnese
Der Tod in der Krankenhausserie
Rahmungen
NEW AMSTERDAM
THE RESIDENT. ATLANTA MEDICAL – Plastik-Repräsentation
GREY’S ANATOMY – Blindcasting
Zwischen Tod und Leben – Der Hades
Eine Krankengeschichte
Burntcoat
6.
Der Wert des Lebens
Moralische Ökonomie des Lebens
Schutzwürdigkeit des Alters
Alt gegen Jung
Mercy Killing
The Madness of Crowds
Heilige Einfalt
Zeitgeschichte
Den Tod ins Leben holen
7.
Vergessene Völkermorde und postkoloniale Verwerfungen
Der andere Sozialdarwinismus
Ein vergessener Völkermord
Vulnerabilität und Betrauerbarkeit
The Obliging Robber – Systemische Missverständnisse
CORONA. FEAR IS A VIRUS – Postkoloniale Diaspora
Homebound – Der Marsch der Kastenlosen
Postkoloniale Kritik
8.
Post-pandemische Zwischenbilanzen
›New Normal‹ oder Back to ›Old Normal‹
Post-pandemische Erzählung vom Sterben
STERBEN
Der Tod und die Liebe
BARBIE
Romcom nach der Liebe
WHAT HAPPENS LATER
Post-pandemische Ungleichheit – RichPorn
SUCCESSION – WHITE LOTUS
SALTBURN
Variationen von Resilienz und Trost
Stoisches Trotzdem – Die Gäste
Versöhnungsangebot – CHARITÉ (2024)
Fazit
Gerechtigkeit
Freiheit
Liebe
Tod, Sterben, Alter
Konsequenzen
Schlussbemerkung
Dank
Literatur
Fernsehserien
Kinofilme
Fernseh- und Streamingfilme
Einleitung
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer berühmten Fernsehansprache an die Nation im März 2020, die Pandemie sei eine der bedeutendsten Krisen nach dem zweiten Weltkrieg,1 andere sprachen von »Zeitenwende«2 oder einem Epochenbruch.3 Im Globalen Norden wurden zentrale Rahmenbedingungen – Sicherheit, Wohlstandsversprechen und Planbarkeit – des ›In-der-Welt-Seins‹ in Frage gestellt. Der Globale Süden war unterschiedlich betroffen, insbesondere Brasilien, Südafrika und Indien hatten sehr spezifische Katastrophen zu verwalten. Viele Bevölkerungen sahen sich in Gefahr, frühzeitig an einem bis dato unbekannten Virus sterben zu müssen, persönliche Bewegungsfreiheit einzubüßen, Sozialkontakte zu verlieren und nicht zuletzt ihre materielle Situation nicht mehr zu überblicken. Grundvoraussetzungen ihrer Existenz waren mit einem Mal nicht mehr gegeben.
Staatliche Pandemieregime versuchten Todesgefahr und soziale Notlagen zu mildern, mit unterschiedlichem Erfolg und nach unterschiedlichen Möglichkeiten, aber die Basisunsicherheit war nicht aus der Welt zu schaffen. Zwar gab es Wellen von Solidarität und Empathie, die Mitmenschlichkeit gegen das Zerbrechen der bekannten Welt zu stellen versuchten, aber immer wieder mischten sich Schock, Panik, Verzweiflung und Hilflosigkeit in die verschiedenen Gefühlslagen. Und ein Teil der Bevölkerungen kanalisierte seine Unsicherheit in Wut und Zorn auf die Regierungen, deren Regeln zu Ansteckungsvermeidung sie als staatlichen Terror empfand und als Versuch, unter dem Vorwand der Pandemie einen Überwachungsstaat aufzubauen.
Gleichzeitig keimte mit der überraschend schnellen Entwicklung eines Impfstoffs die Hoffnung auf, dass das Inferno bald ein Ende finden (könnte) und die Menschheit gestärkt aus dieser Erfahrung herauskommen werde. Von vielen unterschiedlichen Quellen und Positionen wurde die Erwartung geäußert, dass man aus der Erfahrung lernen wolle und ein neues Gefühl für Gemeinschaft entwickeln sollte.4 Diese Erwartung wurde zwar weitgehend enttäuscht, aber man hätte vermuten können, dass die Auseinandersetzung mit einem dermaßen einschneidenden Erlebnis anhalten und in einigen Sektoren des gesellschaftlichen Lebens zu Veränderungen führen würde.
Diese Hoffnung hat sich, zumindest auf der bewussten Ebene, nicht erfüllt. Im Gegensatz zur Informationsüberflutung der akuten Zeit war es nach dem Abklingen der Pandemie schwierig, überhaupt Erwähnungen von Covid-19 zu finden. Diese Seltsamkeit registrierten auch Medien, die vorher kaum ein anderes Thema gekannt hatten. Kornelius Stefan nahm bereits 2022 in der Süddeutschen Zeitung ein schwindendes Interesse wahr: »Der Umsatz an Sachbüchern sank. Donald Trumps Wütereien und die Pandemie wurden vor zwei, drei Jahren noch gierig aufgesaugt, jetzt verweigert sich das Publikum. Krisen-Overload, maximale Zuladung erreicht.«5 »Schon vergessen?«, titelte Maren Keller im März 2023 im SPIEGEL und schreibt: »Vor drei Jahren begann offiziell der erste Lockdown. Damals dachten Sie, Corona werde Ihr Leben verändern und heute wollen Sie am liebsten alles schnell abhaken?«6
Neben dem Nichts-mehr-davon-wissen-Wollen verstärkte sich auch die Verleugnung der Realexistenz der Pandemie, die sich schon während ihrer Dauer in der sogenannten Hygiene- und Querdenkerbewegung7 geäußert hatte. Konservative und Rechtspopulisten riefen nach Untersuchungsausschüssen und Tribunalen zu den ›Fehlern‹, die bei einer angeblichen Überschätzung der Covid-19-Pandemie vom ›System‹ gemacht worden seien und die Bevölkerung durch ein unnötig strenges Regime bevormundet und kontrolliert hätten: Der AfD Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer sagte:
Ein ganzes Land in Stillstand zu versetzen, führt schon nach kurzer Zeit für viele Menschen und Unternehmen zu zum Teil irreversiblen Folgewirkungen: psychischen Belastungen durch Freiheitsbeschränkungen, Betriebsschließungen, finanziellen Notlagen durch Entlassungen, von Eingriffen in Bürgerrechte und Eigentum ganz zu schweigen.8
Beide post-pandemische Corona-Reaktionen, diejenige des Nichts-mehr-davon-wissen-Wollens und diejenige der Systemschuld, haben gemeinsam, dass sie eher mit Leugnung der Pandemie, als mit einer Auseinandersetzung zu tun haben. Die Verweigerung verdankt sich dem Wunsch, zu einer alten Normalität zurückzufinden. Die erste Arbeitsthese der folgenden Untersuchung ist, dass es post-pandemisch diese ›Alte Normalität‹ nicht mehr gibt, sondern dass sich viele vor-pandemische Weltverhältnisse in wichtigen Arenen des Alltagslebens geändert haben, etwa im Verhältnis zum Alter und zum Tod, dem, was man unter Gerechtigkeit und Freiheit versteht oder was man sich von der Liebe erwartet.
Fiktionen einer Kultur der Quarantäne
Die erwähnten Veränderungen, die eine so genannte Neue Normalität begleiten,9 sind zum großen Teil nicht bewusst, sondern finden im Vorbewussten statt. Auffindbar oder nachlesbar sind diese Prozesse nicht in der Rekonstruktion der ›Fakten‹ der Pandemie, sondern, so meine zweite Arbeitsthese, in Fiktionen, die zeitgleich mit der Pandemie entstanden sind. Ich möchte diese Behauptung mit der Analyse einer - wie ich sie nenne – Kultur der Quarantäne untermauern, die ich aus zeitgenössischen fiktionalen Texten zu eruieren versuche. Eine solche ›Kultur der Quarantäne‹ soll aus der Sichtung von ca. 400 Romanen, Erzählungen, Filmen, Fernsehserien in mehreren Sprachen, die während der Pandemie entstanden sind, nachgezeichnet werden.
Dieser nicht unerhebliche Korpus von Corona-Fiktionen ist bislang in ihrer Breite kaum gesichtet.10 Das Projekt dieses Buches ist es demnach, mittels einer literarischen Archäologie von Corona-Fiktionen eine Erkundung von pandemischen Seelenlandschaften zu unternehmen. Dazu ist besonders die sogenannte autofiktionale Literatur geeignet, die ja das problematische ›Ich‹ zum Gegenstand hat (Kapitel 2 – Zerbrochene Spiegel). Hier drängt die Pandemie als Schock in die Prosa des Alltags ein und verändert die Protagonist:innen. Beispielsweise registriert Sandy, die Ich-Erzählerin von Ali Smiths Autofiktion Companion (2022), wie sich eine solche Veränderung an ihr vollzieht und wie sie sich gleichzeitig weigert, diese Veränderung anzuerkennen:
I kept myself going partly by pretending like the rest of us that everything was fine, if awful, in fact so much had shifted that I was pretty sure I wasn’t the person I had once been.11
Smith beschreibt damit eine der Absichten dieser Untersuchung. Diese hat zum Ziel, über die Analyse von literarischen und visuellen Umbrüchen jene Veränderungen zu rekonstruieren, die in der allgemeinen Rhetorik der gelungenen Rückkehr zur Alten Normalität vergessen wurden. Welche aber – sozusagen hinterrücks – trotzdem wirksam geworden sind. Es geht also darum, an ausgewählten Problemkomplexen Spuren der Umgehung, Neupositionierung und Ersatzbildung aufzufinden, die für die post-pandemische Zeit, also für eine Neue Normalität, von Belang sind. In einem Schlusskapitel ›post-pandemische Fiktionen‹ werden einige Artefakte untersucht, in denen diese Spuren zu veränderter Realitäts-Wahrnehmung und -Anerkennung geführt haben.
In Corona betreffenden Fiktionen stehen geliebte und gepflegte Vorstellungen davon, was das jeweilige Leben ausmacht, im Widerspruch zu ihrer realen durch die Großkrise angegriffenen Verfasstheit: Ideen von der Souveränität und Freiheit des Individuums, von der Liebe als herrschaftsfreiem Raum eines irdisch herstellbaren Glücks,12 von der Gerechtigkeit, die sich mit dem ›Fortschritt‹ schon herstellen wird, und von Krankheit und Alter als technisch korrigierbarem Sonderzustand und damit der letztendlichen Überwindung des Todes.13Insofern ist dem amerikanischen Schriftsteller Charles Chowkai Yu zuzustimmen, der schreibt: »What the coronavirus outbreak reveals is not the unreality of our present moment, but the illusions it shatters.«14
Als Quellen wird, wie bereits erwähnt, nicht auf Realien wie Reportagen oder Zeugnisse und Erfahrungsberichte zurückgegriffen, sondern auf Fiktionen. Philosophische und sozial- und kulturwissenschaftliche Kommentare zur Zeit werden die Analysen zwar begleiten aber nicht strukturieren. Die Wahl von künstlerisch gestaltetem Material als Primärquelle beruht auf der Einschätzung, dass jede Fiktion Alltagswahrnehmung nicht nur in Texte und Bilder verwandelt, sondern darüber hinaus Visionen entwickelt, die ein komplexes Verstehen von Gegenwart und Zukunft ermöglichen. Nach Salman Rushdie besteht die Kunst der Fiktion darin, »Dinge zu erfinden, die nicht wahr sind. Aber man muss sie so erfinden, dass sie wahr werden«.15
Fiktionen, die ein unerhörtes Ereignis (wie die Pandemie) in ihrem Kosmos berühren, mobilisieren also Visionen und Fantasien. Sie erspüren Atmosphären, lassen nachempfinden, was verloren ist, und erahnen Vorzeichen des Neuen. Der Rückgriff auf Fiktionen motiviert sich, so gesehen, darüber, dass sie häufig die Grundlage von neuem Denken sind. So schreiben die Metaphernforscher und kognitiven Psychologen George Lakoff und Daniel Johnson:
Kunstwerke bringen neue erfahrene Gestalten hervor und deshalb neue Kohärenzen. Vom Standpunkt der Erfahrung aus betrachtet, ist ein Kunstwerk generell eine Sache der auf der Imagination beruhenden Rationalität und ein Medium, das neue Realitäten zu schaffen vermag.16
Zudem sind Fiktionen für nachfolgende Generationen ein unschätzbares Archiv der Gefühlswelt der Pandemie und von Konfliktwissen für künftige Überlebenskrisen.
Valeria Luiselli gibt in einem Interview des Harvard Magazine zu Protokoll, wie zentral das in Literatur eingefangene Pandemie-Wissen für künftige Generationen sein wird:
In that sense, it offers but one layer of a historical narrative that only comes to view much, much later, and once many, many, many perspectives have been added. If you think of this as a kind of literary archaeology, the first novels about COVID-19 written during the pandemic are a kind of primary-source archive that later might be built on.17
Luisellis Befund kann allein damit bestätigt werden, mit welcher Intensität in der Covid-19-Zeit auf literarische Texte, die frühere Epidemien und Pandemien beschreiben oder erfunden haben, zurückgegriffen wurde. Plötzlichen erlebten alte Romane wie Das Dekameron von Boccaccio (geschrieben 1353 als Reaktion auf die Pest, erstveröffentlicht 1470) oder Klassiker der Moderne wie Die Pest (1947) von Camus Auflagenrekorde.
Von den Schwierigkeiten, eine Pandemie zu erzählen
Erinnerungen, die haften bleiben, sind immer mit einer schlüssigen Narration verbunden. Eine solche scheint für eine Pandemie schwierig zu sein. Krankheiten überhaupt und Pandemien im Besonderen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Elizabeth Outka, hätten keinen Plot mit handlungsfähigen menschlichen Agierenden und seien deshalb nicht oder nur schlecht erzählbar.18 Es fehle sowohl an ›narratability‹, also der Möglichkeit, einen Erzählbogen zu spannen, als auch an ›tellability‹, Erzählbarkeit, also an sinnhaften Höhepunkten, wie etwa dem heroischen Soldatentod.19 Mit dieser Schwierigkeit verbinde sich die generelle Unmöglichkeit, überhaupt über Krankheit zu schreiben.
Outka bezieht sich dabei auf Virginia Woolf, die sich in dem apokryph erschienen Aufsatz »On Being Ill« gewundert hatte, dass der dramatische Zustand einer möglicherweise tödlichen Krankheit (sie sagt, Grippe) keinen Platz in den großen Themen der Literatur wie Liebe, Kampf und Eifersucht gefunden habe. Woolf kommt zum Schluss, dass es sich hier um ein Problem des literarischen Schreibens überhaupt handele. Das Englische habe in Fragen von Krankheit keine reiche Sprache. Virginia Woolf schreibt: »The public would say a novel devoted to influenza lacked plot.«20 In der modernen Narrationsanalyse würde man das die Unmöglichkeit eines Emplotments nennen. Nach Silke Meyer ist Emplotment »die Konstruktion eines sinn- und bedeutungsvollen Handlungsverlaufes durch die Umsetzung der Ereignisse in eine sequenzielle Struktur«.21
Die Kargheit des literarischen Echos auf die Spanische Grippe von 1918-1920 zeigt, dass für diese weltumspannende Seuche kein Narrativ entwickelt wurde. Die Covid-19-Pandemie dagegen hat durchaus kurzfristig eine Notwendigkeit, das Entsetzen zu erzählen, erzeugt. Die Herausgeber:innen des Decameron Project, einer schnell publizierten Anthologie des New York Times Magazine von Covid-Storys, schrieben: »Our inboxes filled with letters to the editor remarking on the solace provided by these tales.«22 Autor:innen klagen in den Texten zwar, dass sie eigentlich das Thema vermeiden wollen, aber einfach nicht daran vorbeikommen.
Der Brite Ian McEwan sagt in einem Interview, dass er definitiv nicht über die Pandemie habe schreiben wollen, sie aber wie ein riesiger Baumstamm auf seinem Weg gelegen habe und deshalb nicht zu umgehen gewesen sei.23 Die Interviewerin spekuliert, dass der vielfach geäußerte Unwille von Autor:innen, über Corona zu schreiben, daran liegen könne, dass es sich um eine langweilige Apokalypse (»boring apocalypse«) gehandelt habe, da untätig im Lockdown zu sitzen nun mal keine packende Geschichte ergäbe.24 Die oben benannte Schwierigkeit des ›Emplotments‹ von Krankheitserzählungen kommt hinzu. Möglicherweise liegt hier der Grund dafür, dass in Corona-Fiktionen direkte Schilderungen der Krankheit eher Seltenheitswert haben.25
Auch wenn von der Unlust des Publikums zu lesen ist, dass es genug von Corona hat, und Autor:innen zu Protokoll geben, dass sie sozusagen gegen ihren Willen und ihre Einsicht das Thema aufgegriffen haben, ist vielfach etabliert, dass für Menschen Erzählen eine Lebensnotwendigkeit ist, um Komplexität zu reduzieren,26 Furcht zu bekämpfen27 oder schlicht, um zu überleben. »Diejenigen, die Geschichten erzählen, überleben«, ist der erste Satz eines vielbeachteten britischen Corona-Romans, Burntcoat (2021) von Sarah Hall.28
Für Kommunikations-Theoretiker:innen und Philosoph:innen ist Erzählen eine zentrale Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Der Mensch ist ein homo narrans29 oder ein »storytelling animal«, ein Geschichten erzählendes Tier.30 Insofern quellen hinter der geäußerten Unlust und Absicht, das Thema zu vermeiden, worin sich die post-pandemische Verdrängung schon ankündigt, doch immer wieder Geschichten hervor. Nach Samira El Ouassil und Friedeman Karig liegen unter jedem Erzählen Narrative, die einen kulturellen Kern beinhalten, der ihnen überindividuellen Sinn gibt und sie ihren Adressaten verständlich macht.
Erzählungen über frühere Seuchen konnten auf solche sinnstiftenden Narrative zurückgreifen. Die biblische Erzählung von den ägyptischen Plagen war mit dem Narrativ der Strafe Gottes unterlegt, weil der Pharao das Volk Israel nicht ziehen lassen wollte. Die religiöse Sinngebung hielt sich sehr lange in den Geschichten über Seuchen und Plagen, zum Beispiel etwas abgewandelt noch 1842 in der Novelle »Die schwarze Spinne« von Jeremias Gotthelf.31 Der Teufel hatte den Bewohner:innen eines Dorfes, das unter einem bösen Ritter litt, versprochen, ihnen zu helfen, wenn sie ihm ein neugeborenes ungetauftes Kind überlassen würden. Die Dorfbewohner:innen düpierten den Teufel, indem sie das vorgesehene Kind kurz vor der Übergabe tauften. Der Teufel schickte aus Rache schwarze Spinnen ins Dorf, die Feldfrucht, Vieh und Mensch verdarben. Die Strafe Gottes fällt in diesem Narrativ komplexer aus als im Alten Testament. Er überlässt sie dem Teufel, mit dem die guten Christen nicht hätten paktieren dürfen.
Schulkindern des 20. Jahrhunderts fällt es dagegen schwer, der Geschichte von der Schwarzen Spinne noch einen ›Sinn‹ abzugewinnen, erinnert sich der Erzähler von Martin Meyers Roman Corona (2020), als er Gotthelfs Geschichte las, um die gegenwärtige Pandemie besser zu verstehen.32 Die Schüler hätten sich der frommen Erklärung des Lehrers nicht anschließen wollen. Auch der Covid-19-Pandemie kann kein verbindlicher Sinn mehr verliehen werden.33 Insofern tritt etwas ein, das Samira El Ouassil und Friedemann Krug »narrative Heimatlosigkeit« nennen.34 In Corona-Fiktionen – sei es in der Literatur oder in visuellen Medien – findet somit ein Erzählen gegen einen desorientierenden Sinnverlust statt.
Nicht verstehen
Es kann kein Sinn verliehen werden, wenn nicht verstanden werden kann, was geschieht, wenn das Fassungsvermögen überstiegen ist.35 Ein solchermaßen unbegreifbares Phänomen kann dann zwar nicht kohärent erzählt werden, aber es kann sich zeigen »als die Unterbrechung oder der Zusammenbruch des Prozesses der Signifikation«.36 Nicht selten werden in Corona-Fiktionen Personen eingeschränkten geistigen Fassungsvermögens wie Kinder und demente Alte als Protagonist:innen eingesetzt. Eine der wenigen literarischen Verarbeitungen der Spanischen Grippe, Sie kamen wie die Schwalben von William Maxwell von 1937, ließ den Schmerz des Grippetodes der Mutter aus der Perspektive zweier kleiner Jungens erzählen, die die Ungeheuerlichkeit ihres Verlustes auf gleicher Ebene mit zerbrochenen Spielsachen und versäumten Footballterminen verhandeln.
Einer solchen Verschmelzung eines aufgewühlten Geisteszustandes des Erzählenden mit dem der kindlichen Protagonisten, die das Entsetzen noch nicht in weniger und mehr bedeutende Unglücke hierarchisieren können und wollen, haben sich auch Verfasser:innen von späteren Covid-Fiktionen bedient. Auch sie haben Handlungsträger:innen gewählt, die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind oder freiwillig regredieren. Alejandro Zambra schreibt seine Covid-Story »Screen Time«37 aus der Perspektive eines Mannes, der über die Isolation und Einsperrung während der Pandemie so verzweifelt, dass die einzige Tätigkeit, die ihm noch Freude macht, darin besteht, den ganzen Tag mit seinem kleinen Sohn zu spielen, und der sich damit sozusagen als Kind einer quälenden Wirklichkeitswahrnehmung entzieht.
Daniel Mason paart in »The Wolves of Circassia«38 einen kleinen Jungen mit ADS-Syndrom mit seinem dementen Großvater und lässt beide in endlos wiederholten Geschichten aus der Pionierzeit der Herzchirurgie zusammenfinden. Dabei nimmt eine Altenpflegerin aus Tonga die Erzählperspektive ein. Sie verzweifelt als Essential Worker (unverzichtbare Arbeitskraft, die von den Corona-Regeln, die Mobilität einschränken ausgenommen wurden) an der Mehrfachbelastung von Lockdown einerseits und der gefährlichen Pendler:innenstrecke andererseits, die sie täglich zurückzulegen hat, und dem Dauerparlando des Großvater-Enkel-Duos. Währenddessen schweben die beiden ›alternativ Begabten‹ in heiterer Ruhe über den Dingen.
Kinder und demente Alte zu Protagonist:innen zu machen, spiegelt den Einbruch der Pandemie in den Rationalismus der Spätmoderne oder – um einen Begriff der katalanischen Philosophin und Zivilisationskritikerin Marina Garcés zu wählen – des ›Solutionismus‹,39 der vorgibt, für jedes Problem eine Lösung zu haben, und dabei notwendigerweise die Weltwahrnehmung auf lösbare Probleme reduziert. Nicht-Verstehende Protagonist:innen in Covid-Fiktionen repräsentieren die Unbegreifbarkeit der Pandemie im Allgemeinen. Corona-Fiktionen zielen überhaupt eher selten auf große Sinnfragen, sondern sie schildern die Mikropolitik, die Beziehungen der Menschen untereinander und die sozialen Bedingungen, unter denen sie leben, und wie diese mit der Pandemie korrespondieren. Spätestens hier tauchen Fragen von Macht und Gerechtigkeit auf.
Intersektionalität
Pandemien treffen alle, aber sie treffen alle verschieden. Die Corona-Pandemie hat soziale, geschlechtliche, ethnische und lokale Unterschiede genauer, schärfer und konsequenter hervortreten lassen, als man sie in Zeiten, wo die Frage von Leben und Tod nicht durch einen Virus entschieden werden konnte, wahrnehmen wollte. Oder anders gesagt, Corona hat Machtstrukturen sowohl sichtbar gemacht als auch in Bewegung gebracht. Einiges an weißer bürgerlicher Selbstgefälligkeit und Ignoranz bekam Risse, und bei vielen schien – jedenfalls kurzfristig – ein Bewusstsein von sozialen Ungleichheiten auf, was die NGO Oxfam so treffend mit Covid-19 als »Ungleichheitsvirus« bezeichnet hat.40
Bei manchen Autor:innen regte sich angesichts der neuen Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit Scham und der Wille, zu einer Veränderung beizutragen. Andere Teile der weißen Bevölkerung wurden von der Angst ergriffen, dass die neue Deutlichkeit sozialer Abgründe dazu führen könnte, Privilegien zu verlieren, und wandten sich aggressiven populistischen Politiken zu, die sie selbst und nicht die diskriminierten Anderen zu Opfern stilisierten. Inzwischen haben einige Zeitdiagnostiker zu Recht einen Zusammenhang zwischen post-pandemischen Erfolgen populistischer Parteien und dem Corona-Schock hergestellt.41
Um das Spannungsfeld von Ungleichheiten und Privilegien auszuloten, arbeitet diese Studie mit intersektionalen Analysen. Die politische Philosophin Nadja Meisterhans fasst zusammen, warum eine intersektionale Analyse der Pandemie nötig ist.
Das Ausblenden der strukturellen Ursachen multipler und miteinander verflochtener Krisen ist jedoch einer der Hauptgründe, warum das Pandemiegeschehen intersektionale Ungleichheiten und Machtasymmetrien weltweit verschärft und strukturell benachteiligte gesellschaftliche Gruppen in geradezu nekropolitischer Weise von populistisch agierenden Regierungen im Stich gelassen, teilweise sogar zu Sündenböcken gemacht werden.42
Der etwas sperrige Begriff Intersektionalität stammt aus der Rassismus- und Geschlechterforschung und sagt zunächst aus, dass man unterschiedliche Sektoren/Sektionen (Bereiche, Kategorien) menschlicher Existenz zusammendenken sollte, zum Beispiel Klasse, Geschlecht »Rasse«/Ethnizität und Sexualität. Jede Person setzt sich aus Klassen-, Geschlechts- und Ethnizitätsmerkmalen zusammen, von denen einige in der Hierarchie der sozialen Anerkennung herrschend sind und andere marginalisiert. Ein heterosexueller weißer Mann etwa könnte arm sein und damit einer diskriminierten Kategorie, nämlich einer ausgebeuteten Klasse, angehören, sich aber ansonsten nur in dominanten Kategorien wahrnehmen, beispielsweise gegenüber seiner Frau, gegenüber »Ausländern« oder gegenüber Homosexuellen.43 Das Umgekehrte träfe auf eine heterosexuelle reiche schwarzen Frau zu, die sozial und sexuell der Norm angehört, als schwarze Frau aber den Rassismus, der gegenüber einer dominierten Gruppe zum Ausdruck gebracht wird, erdulden muss.
Die Anzahl der Sektionen (Kategorien) ist im Prinzip unendlich und kein Mensch ist von nur einer Kategorie betroffen. Das Motiv für ein solches Zusammendenken ist Macht- und Hegemonie(selbst)kritik.44 Die intersektionale Analyse arbeitet heraus, dass Macht eine Frage von Beziehungen der unterschiedlichen Kategorien ist.45 Zum Beispiel wurden während der Pandemie Macht-Ungleichheiten von Schwarzsein, Weißsein (»Rasse«), Männlichkeit (Geschlecht) und Klasse augenfällig am Fall der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten am 20. März 2021. Die Selbstverständlichkeit, mit der der weiße Polizist ungerührt 9 ½ Minuten lang sein Knie auf den Hals des schwarzen Opfers presste, bis dieses erstickte, und damit glaubte, seiner Schutzfunktion gegenüber braven weißen Bürgern nachzukommen, machte den strukturellen Rassismus in den USA überdeutlich. Viele weiße US-Amerikaner entwickelten daraufhin Sympathien mit Black Lives Matter.
Ein anderes Feld, wo die Pandemie als Vergrößerungsglas für Machtverhältnisse und systematische Ungerechtigkeiten wirkte, war die intersektionale Schnittstelle der Geschlechterverhältnisse. Viele sozialwissenschaftliche Studien wiesen bereits während der Pandemie auf die überproportionale Care-Last von Frauen im Lockdown und die Zunahme von häuslicher Gewalt hin.46 Forschung und Statistik informieren, aber können selten erschüttern. Fiktionen dagegen können das Herz aufreißen und den dringenden Wunsch nach Veränderung erzeugen. Erlebbar und sinnlich verdeutlicht wurde das etwa im feministische Corona-Roman Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickl, der damit beginnt, dass die überforderte Hausfrau sich den Anforderungen durch einen plötzlichen Selbstmord entzieht.
Es ist nicht nur der Ehemann, der seinen Anteil an der mentalen und faktischen Verzweiflung seiner Frau nicht begreift und weiterhin von der Restfamilie ›Ruhe‹ einfordert, weil er ›arbeiten muss‹. Auch die Freundin, die im verwitweten Haushalt einspringt, um die drei Kinder zu versorgen, ist lange nicht in der Lage zu verstehen, dass sie sich klaglos in eine unhinterfragte geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zugunsten der Männer einfügt. Die Pandemie-Erzählung von Fallwickl wirft ein grelles Schlaglicht auf die Naturalisierung asymmetrischer Geschlechtermachtbeziehungen und entfaltet eine Utopie, wie diese zu zerschlagen wären. Die erwachsenen Frauen verlassen den Haushalt und nehmen den Drückeberger-Vater in die Pflicht, seine Kleinkinder selbst und allein zu versorgen (siehe Kapitel 2 – Zerbrochene Spiegel).
Die hier beispielhaft erwähnten Corona-Fiktionen über das Zusammenspiel von benachteiligten und privilegierten Race-, Geschlechts- und Klassen- sowie Alters-Positionen erfordern eine intersektionale Sicht auf Verhältnisse. Und diese wiederum zeigt Veränderungspotenzial auf. Die soziale Bewegung Black Lives Matter wurde durch die vielfache (auch fiktionale) Analyse der Ermordung George Floyds gestärkt. Und die Aufmerksamkeit für häusliche Gewalt und die psychische Dimension derselben hat sich nach Corona in Ländern wie Italien, Deutschland und Frankreich über Femizide oder den Fall Pélicot vertieft. Fiktionen, insbesondere Fernsehserien um den Fall George Floyd zeigen, dass Rassismus kein hässlicher Restbestand weniger unbelehrbarer Reaktionäre ist, sondern ein systematisches Problem, an dem alle weißen Menschen teilhaben. Ein feministischer Corona-Roman trug dazu bei, die Augen für die Abgründe und die kulturelle Akzeptanz ungleicher Geschlechterbeziehungen nicht nur zu öffnen, sondern auch oft nicht bemerkte strukturelle Machtbeziehungen und Ungerechtigkeiten fühlbar zu machen.
Vier Metanarrative
Bei dem hier zusammengeführten fiktionalen Corona-Werkkorpus wird nicht unterstellt, dass es sich um einheitliche Auffassungen oder Strategien der Fiktionalisierung von Covid-19 handelt. Ebenfalls wird keine Aussage darüber gemacht, ob oder dass es sich um Artefakte von besonderer künstlerischer Qualität handelt.47 Es kommt hier nur darauf an, mittels Corona-Fiktionen nachzuzeichnen, wie in verschiedenen Orten, Nationen, sozialen Schichten und ethnischen Identitäten mit Corona umgegangen worden ist, und welche materiellen und mentalen Auswirkungen und Zukünfte daraus entstanden sind und immer noch entstehen. Trotz einer unabweisbaren Diversität der untersuchten Texte wird jedoch davon ausgegangen, dass bestimmte Metanarrative quer durch die Vielfalt der Artefakte identifizierbar sind.
Der Begriff Metanarrativ (auch Meistererzählung) ist in der kritischen Geschichtswissenschaft48 entwickelt worden und bezeichnet die Vorstellung, dass hinter jeweils konkreten und diversen Sachaussagen einer Epoche sie überwölbende Grundkonzepte stehen, die ihre Bedeutung strukturieren. Fundamentale Veränderungen, wie sie die Pandemie in einigen Bereichen hervorgebracht hat, lassen sich deshalb an Grundkonzepten, wie sie in Corona-Fiktionen verhandelt werden, studieren. Davon wurden vier ausgewählt – Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit und Alter, Tod und Sterblichkeit –, die ›unser‹49 ›In-der-Welt-Sein‹ prägen. Die Wahl dieser Metanarrative lehnt sich lose an sogenannte »Existential Givens« an,50 die in der Sozialpsychologie als notwendige Sicherheiten ausgemacht werden, aber durch Covid-19 in Frage gestellt wurden: »The pandemic increased the silence of questions related to life and death, freedom and responsibility, relationships with others, and meaning«.51 Der Faktor ›Beziehungen zu anderen‹ wurde auf ›Liebe‹ verengt, weil die untersuchten Fiktionen meist um Liebesgeschichten kreisen. Hinzugefügt wurde ›Gerechtigkeit‹, weil es mir auch verstärkt auf die politische Dimension ankam. Und die Frage von ›Sinn‹ (meaning) durchwirkt das ganze Projekt. Statt von Metanarrativen kann man auch von Frames sprechen, als »mental structures that shape the way we see the world«,52 also von Rahmungen, innerhalb derer die Welt verstanden wird. Die Rahmentheorie ermöglicht, während der Pandemie aufgetauchte Sprachbilder auf ihre Geschichte und ihren diskursiven Hintergrund zu untersuchen.53
A Freiheit
Betrachtet man zum Beispiel die Freiheit, so hat der Begriff eine Vergangenheit – der im Freiheitsbegriff der Aufklärung und der Französischen Revolution, der gegen feudale Willkür und Unterdrückung gerichtet war – und eine pandemische Gegenwart und möglicherweise eine bedeutungsverschiebende Zukunft. Begreift man den Lockdown als Freiheitsbeschränkung, dann wurde darunter Mobilitäts- und Entscheidungs-Freiheit verstanden. Sah man aber Freiheit als »Einsicht in die Notwendigkeit«,54 die einem ermöglichte, ›freiwillig‹ lebensrettende Regeln zu befolgen, setzte man auf eine Zukunft, die zwischenzeitliche Einschränkungen zugunsten einer ›wirklichen‹ Freiheit erforderlich machen würden. Aber auch für die Regelkonformen waren die Freiheitsbeschränkungen der Lockdowns eine schmerzliche Erfahrung. Fast alle Corona-Fiktionen sind auf die Unmöglichkeit fixiert, zu gehen und zu reisen, wohin und zu wem man will. Quarantäne ist dabei das Thema, das am meisten berührt und skandalisiert wird und deshalb für den Buchtitel ›Quarantänekultur‹ gewählt worden ist. Fast alle Corona-Fiktionen gestalten ein tausendstimmiges Rütteln an imaginierten Gitterstäben, mit denen Unfreiheit assoziiert wird.
Nun geht der Begriff Freiheit in der Spätmoderne weit über den Gegensatz Einsperrung versus Mobilität hinaus. In demokratischen Gesellschaften ist Freiheit eine Grundqualität, die je nach Ausrichtung künstlerisch, sozial oder ökonomisch hoch besetzt, aber gleichzeitig einer der Motoren der Selbstzerstörung des Anthropozän ist. So gesehen muss die Covid-19-Krise im Zusammenhang dessen gesehen werden, was Adam Tooze die Polykrise nennt.55 Massentourismus als Bewegungsfreiheit zerstört mit vielen Flügen und Kreuzfahrtschiffen die Atmosphäre, trampelt historische Schönheit wie Venedig nieder und übergießt Strände mit Beton-Ferienanlagen und Sonnenliegenghettos. Ein individualistisches Verständnis von Privatbesitz und Handlungsfreiheit versiegelt Böden, besteht auf fossilem Brennstoff für Autos und Heizung, die den atembaren Sauerstoff vernichten, und akzeptiert keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Abholzung von Wäldern treibt Wildtiere in die Städte mit der Gefahr, unbekannte Viren hineinzutragen.
Dieser innere Widerspruch hat einige Theoretiker:innen dazu bewogen, Freiheit neu zu denken. Eva von Redecker etwa entwickelt ein nicht auf Mobilität und Konsum ausgerichtetes Konzept der Bleibefreiheit.56 Sie spricht vom Elend einer »weltlosen Freiheitsauffassung«, die in eine »neoliberale Protoapokalypse«57 umgeschlagen sei. Der dänische Soziologe und Latourschüler Nikolaj Schultz findet und akzeptiert die Grenzen seiner Freiheit gleich doppelt. Er entflieht dem wegen Corona regulierten Paris im Sommer 2022 und testet sich ›frei‹, um auf eine kleine Insel aus dem Lockdown ›in die Freiheit‹ zu reisen. Dort erkennt er, dass Übertourismus dabei ist, seinen Fluchtpunkt zu zerstören, das Süßwasser zu verbrauchen, die Natur zu vermüllen und dass er selbst implizit58 mittels seiner körperlichen und finanziellen Bewegungsfreiheit Agent dieser Zerstörung ist: »If this land is disappearing due to the traces of my liberty, then my freedom seems to be an archaic attachment that I must abandon.«59
B Liebe
Als zweites großes Thema neben der – gesellschaftlich umstrittenen – Art und Weise, wie Freiheit verstanden werden soll, erlebte das Thema der Liebe eine Herausforderung. Die Sehnsucht nach romantischer Liebe für Jedermann und das Recht darauf gehört seit Beginn des bürgerlichen Zeitalters zur Grundausstattung eines westlichen Selbstverständnisses. Obwohl es seit Jahrzehnten viel Kulturkritik an dem hartnäckigen ›Grausamen Optimismus‹ (cruel optimism)60 dieses Liebesversprechens gibt61 und die Verwicklung der Liebe in die kapitalistische Ökonomie beschrieben und analysiert wurde,62 ist die mit ihr verbundene Illusion nicht totzukriegen und bedient populäre Genres wie die romantic novel und neuerdings auch die young adult romance books.
Diese Studie wird sich einem beliebten Film-Genre zuwenden, der romantic comedy, auch Romcom abgekürzt. Das etwa 1990 mit den Schauspielerinnen Meg Ryan, Anne Hathaway, Sandra Bullock oder Reese Witherspoon neu inspirierte Filmgenre feierte junge berufstätige Frauen, denen die Drehbücher zwar eine gewisse Selbstständigkeit zugestanden, deren Probleme sich aber wundersamerweise lösten, wenn sie dem Märchenprinzen begegneten, den sie (oder der sie) nach einigen Wirren für sich erobern konnten. Interessanterweise entpuppte sich der Geliebte fast immer als vermögend oder zumindest Inhaber eines besseren Jobs, der die Glückliche zu sich hinanzog,63 das heißt, es wurde mit einer fixierten hierarchischen Intersektionalität von Klasse und Geschlecht gearbeitet. Der gelungene Liebespakt hatte im gesellschaftlichen Umfeld einen hohen Stellenwert und wurde von Eltern und besonders Freundinnen neidisch bejubelt. Dieses Metanarrativ war, zumindest für Frauen, perfekt ausformuliert und duldete keine Variation.
Unter der Bedrängnis der Angst vor Ansteckung und Einsperrung wurde vielfach in der Liebe Trost gesucht. Die große Sinngeberin sollte den erzwungenen Rückzug ins Private versüßen und die Quarantäne erträglich machen. Trotz dieser hoffnungsvollen Ausgangslage waren Stressfaktoren der gemeinsamen Einsperrung meist nicht überwindbar.64 Die Filmindustrie versprach sich von der Beibehaltung des Gerüstes der romantischen Komödie zusammen mit Corona-Themen kommerziellen Erfolg, weil es ja ein eskapistisches Genre sui generis war und man hoffte, dass das oben angesprochene Ziel Trost mit dieser Thematik funktionieren würde. Nicht zufällig jedoch scheiterten die Filmgeschichten. Zwar wurde versucht, die erzwungen enge Zweisamkeit zu einem romantischen Projekt zu machen. Aber der Hauch von Realismus, den es braucht, um Fiktionen glaubhaft zu machen, übernahm in fast allen Corona-Romcoms das Kommando und erzählte Geschichten der Genervtheit und des Scheiterns anstatt welche des Glücks im goldenen Käfig.
Besonders fiel diese narrative Implosion auf, wenn die Heroinen der früher geglückten Romcoms die Bühne der nun skeptischen Liebe bespielten. Zum Beispiel wenn Ann Hathaway als leitende Angestellte sich in LOCKED DOWN (2021) mit ihrem kurz vor der Abwicklung stehenden Geliebten, einem Lieferfahrer, zusammensperrt. Im Film ist wie auf einem Reißbrett zu beobachten, wie die Romanze unter dem Stress, der Monotonie und der sozialen Differenz zerfällt. Einen besonderen Dreh nimmt das Genre, wenn es von einer der früheren Protagonistinnen selbst in die Hand genommen wird. Meg Ryan, die schusselig, liebenswerte Queen aller Romcom-Sehnsüchte der Spätmoderne, führt in einem äußerst seltsamen romantischen Film WHAT HAPPENS LATER (2023) selbst die Regie. Hier wird eine gescheiterte Begegnung zwischen geschiedenen Partnern in einem wegen Schneesturm geschlossenen Flughafen inszeniert.
Der Abgesang auf die Romcom korrespondiert mit den vorher entwickelten stärker sichtbaren Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, die in Corona-Fiktionen an die Oberfläche drängen. Die Metanarration der Liebe als kollektive weibliche Fantasie und universeller Flucht- und Sehnsuchtspunkt wirkt angegriffen. Das Phänomen wird zusätzlich von einer anderen Seite flankiert. Die vergleichsweise neue Meta-Erzählung von der bedrohten weißen Männlichkeit65 lässt keine Liebhaber entstehen, die für die Romcom geeignet wären, denn deren Rollenbeschreibung besteht ja gerade darin, souverän und selbstgewiss zu sein und ihre herumflatternden weiblichen Pendants sicher aufzufangen.
C Alter, Sterblichkeit und Tod
Die Sterblichkeit oder, um es deutlicher zu sagen, der Tod, ist der größte Skandal für den modernen Menschen. So wie das Glücksversprechen der romantischen Liebe war auch das Metanarrativ des verbotenen Todes, mort interdite, wie der französische Mentalitätshistoriker Philippe Ariès formuliert, nicht von Anfang an da, sondern es hat den vertrauten Tod als kollektives Ereignis durch den individualisierten Tod abgelöst.66 Der verbotene Tod ist schwer zu erzählen und insofern in den Corona-Fiktionen auch häufig eine Leerstelle, die aber als solche schmerzlich präsent war. Zadie Smith schrieb in ihrem Corona-Essay über ihre amerikanischen Erfahrungen Intimations (2020): »What we were completely missing, however, was the concept of death itself, death absolute.«67 Eva von Redecker setzt gegen die moderne Todesverdrängung »den unbezähmbaren Wunsch, dass es möglich sein müsste, den Tod zu sehen«.68
Die Pandemie brachte die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Todes mit sich. Sigmund Freud hatte einen solchen Tod beklagt, wahrscheinlich, nachdem ein geliebter Mensch an der Spanischen Grippe gestorben war:
Wenn man schon sterben und vorher seine Liebsten durch den Tod verlieren soll, will man lieber einem unerbittlichen Naturgesetz […] erlegen sein als einem Zufall, der sich hätte vermeiden lassen.69
Vor der Einführung des Impfstoffs stand sogar die Perspektive der Ausrottung der Menschheit auf der Tagesordnung einer Gesellschaft, die sich zwischen Alters- und Todesverdrängung einerseits und Träumen von wissenschaftlich erreichbarer Unsterblichkeit70 eingerichtet hatte. Die Verdrängung des Todes war – und ist in weiten Teilen noch – die Voraussetzung eines Lebens in ständiger Selbstoptimierung und der Vermeidung der Sichtbarkeit des Alterungsprozesses durch Kosmetik, elektive Chirurgie. Auch die Kasernierung der Hochbetagten und Hinfälligen in Institutionen samt der Verbannung des Sterbens ins Krankenhaus gehört zur modernen Todesverdrängung.
Andererseits gebietet das Selbstverständnis demokratischer Gesellschaften, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und auch ein alter Mensch, obwohl er ein ständiges Menetekel dafür ist, dass man sterben muss, das Recht auf eine lebenswerte Existenz hat. Das führte zu der paradoxen Situation, dass trotz der strukturellen Altersfeindlichkeit (Ageism) westlicher Gesellschaften die Lockdowns mit der Sorge um die vulnerablen Alten begründet wurde. Realiter nahmen aber die unterschiedlichsten Corona-Regelsysteme ein Massensterben in Kauf, als sie ungetestete Senioren aus den Hospitälern in die Heime zurückschickten und dabei wie in New York tödliche Ansteckungswellen auslösten.71 (Siehe Kapitel 6 – Wert des Lebens)
Abgesehen von den Alten war auch nicht zu übersehen, dass – in verschiedenen Ländern unterschiedlich – große ethnisch und sozial diskriminierte Bevölkerungsgruppen durch schlechte Lebensbedingungen und Gesundheitsversorgung einem vorzeitigen Tod durch Covid-19 ausgeliefert wurden.72 All das zusammen brachte dem Tod eine neue Präsenz, die besonders durch die visuellen Medien vergegenwärtigt, wenngleich nicht gezeigt, wurde. Lastwagenkolonnen, die in Italien Corona-Tote zu Ersatzfriedhöfen fuhren, weil die lokalen überlastet waren, Massengrabfelder in Brasilien und Triage-Zelte vor New Yorker Hospitälern befeuerten eine allgemeine Todesangst. Wenige Texte allerdings gingen in die Tiefe wie Sarah Halls Burncoat,73 die den unwürdigen Tod des Geliebten ihrer Heldin im Detail schildert, nachdem die unfähige und verleugnende britische Regierung alle Hilfe versagt und sie sogar über Tage mit einem langsam verwesenden Leichnam alleingelassen hat.
D Gerechtigkeit
Daran schließt unmittelbar die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit oder die Klage über Ungerechtigkeit an. Viele Benachteiligte mussten früher sterben als wenige Privilegierte, die auch bessere Möglichkeiten hatten, sich zu schützen. Diese unbestreitbaren Tatsachen fanden ein großes Echo in der politischen und sozialwissenschaftlichen Publizistik, aber selten Erwähnung in Corona-Fiktionen des Globalen Nordens. Es waren oft die selbst von Ungerechtigkeit Betroffenen, die sozialen Ungleichheiten größere Aufmerksamkeit widmeten wie etwa die indigene Dichterin Louise Erdrich in ihrem Roman The Sentence (2021),74 in dem sie die teilweise verzweifelte Lage von armen Native Americans und Afroamerikaner:innen in Minneapolis nach der Ermordung von George Floyd beleuchtete. Auch Artefakte aus der Sphäre der Unterklassen, wie die amerikanische Fernsehserie SUPERSTORE, machten deutlich, wie gleichgültig es den Bossen eines großen Kettenladens war, ob ihre Angestellten vor Covid geschützt waren, und denen es nur darauf ankam, keine teure Schutzkleidung zur Verfügung stellen zu müssen.
Texte aus dem Globalen Süden dagegen, wie der Roman Homebound (2021)75 der indischen Journalistin Puja Changoiwala über den oft tödlich endenden Marsch der durch die Pandemie arbeitslosen Slumbevölkerung ›nach Hause‹, zeigen ein ganz anderes Engagement für Gerechtigkeit. Diese Unterschiede der Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten korrespondieren mit der Klassenlage und der lokalen Verortung der Autor:innen. Die Sphäre der Kultur, in der Romane verfasst, Filme gedreht und Fernsehserien produziert werden, ist ein mittelständisches, meist weißes Terrain, wo aber das Verständnis für die Lage der weniger Privilegierten nicht oben auf der Agenda steht, (siehe Kapitel 7 – Vergessene Völkermorde). Doch praktisch keines der gesichteten Artefakte konnte sich vollständig der Frage einer neu zu verhandelnder Gerechtigkeit entziehen.
Verschiebungen
Nun haben etliche Verschiebungen, die sich in den Corona-Fiktionen andeuteten, Spuren in den Gegenwartsdiskursen hinterlassen. Am wenigsten auffällig ist eine Diskursänderung bei der Auseinandersetzung mit Alter und Tod zu beobachten, was sich auch schon in der geringen und zögerlichen Beschäftigung damit während der Pandemie gezeigt hat. Kurzfristig wurde die Anzahl der Altenpfleger:innen und auch ihr Lohn erhöht, die Logik der Alters-Segregation aber nicht angegriffen. Zwar ist die plötzliche Todeswahrscheinlichkeit vielstimmig beklagt, aber wenig zu einer Enttabuisierung des Todes selbst unternommen worden. Dagegen hat sich die Vorstellung von Freiheit ausdifferenziert, auch durch die Präzisierung in die beiden Stränge ›freedom‹ und ›liberty‹. Eine aufkommende Skepsis gegenüber der Glücks- und Trostkraft der romantischen Liebe kann registriert werden, insbesondere über die stärkere Wahrnehmung von Gewalt in Intimbeziehungen. Das Fehlen von ernsthaften Maßnahmen, soziale Gerechtigkeit voranzubringen, hat einige Parteien aufgerüttelt und zum Versprechen angeregt, sie mehr zu priorisieren. Zusammengenommen hat sich ein schmaler Pfad aus der neoliberalen Vereinzelung, Marktgläubigkeit und Meritokratie heraus gezeigt. Beim Studium der Corona-Fiktionen konnte man diese Verschiebungen aufscheinen sehen.
Um den Raum für Verbesserungen, Reformen oder vielleicht sogar für Revolutionen zu öffnen, wären allerdings auch Umbrüche erforderlich, die generellere Reorientierungen nötig machen, die schmerzhaft sind und für einige auch den Verlust gesicherter Positionen bedeuten. Das hat einen starken Impuls produziert, sich einer Corona-Reflexion zu verweigern. Die harmlose Variante davon ist das oben entwickelte Verhaltensmuster des Nichts-mehr-davon-Wissen-Wollens. Weniger harmlos sind politische Reaktionen aus dem populistischen Lager, die nach der Pandemie an Überzeugungskraft gewonnen haben. Die Frage der als Liberty verstandenen Freiheit wurde zu einem Vehikel der Abrechnung mit dem ›System‹, das die Covid-19-Pandemie dazu genutzt haben soll, die Bevölkerung zu manipulieren. Eine Neukalibrierung des Geschlechterverhältnisses wurde mit verstärktem Antifeminismus und Gender-Polemiken konterkariert. Der ideologisch gestärkte Familienvater populistischer Familienpolitiken verspricht Frauen Schutz vor angeblich sexuell gefährlichen Immigranten und verschärft damit gleichzeitig Asyl- und Migrationspolitik.
Dieser Ethnosexismus76 gegenüber angeblich sexuell übergriffigen männlichen Migranten zielte gleichzeitig auf die Wiederakzeptanz der heteronormativen Kleinfamilie und stärkte den patriarchalen Machtanspruch von hegemonialer Männlichkeit. Einige Frauen und Mädchen fügten sich in diese Anmaßung, indem sie beispielsweise über die ›Trad-Wife‹-Bewegung und ›Stay-at-Home-Girls‹ die Hausfrauenehe mit männlichem Brotverdiener glorifizierten und das als Sieg über neoliberale Überbeanspruchung ausgaben.77 Auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit wurde oft auf den Verdacht reduziert, dass die Immigranten den ›Abstammungsdeutschen‹ etwas wegnähmen, was diesen selbst zustünde.78 All diese Entwicklungen sind zwar nicht notwendigerweise nach Covid-19 entstanden, haben aber durch die Unsicherheiten der Pandemie-Periode eine neue Überzeugungskraft, Festigkeit und Selbstverständlichkeit erhalten.
Stuart Hall nennt solche miteinander verbundenen Gleichzeitigkeiten widersprüchlicher gesellschaftlicher Diskurse ›conjuncture‹. Nach ihm charakterisieren sie jeweilige politische Konjunkturen. Auf der einfachsten Ebene wäre der Begriff mit Zusammentreffen zu bezeichnen. Eine jeweils neue ›conjuncture‹ ist nach Hall der Ausdruck von tiefgreifenden Krisen. Wie auch immer man die Bedeutung der Pandemie einschätzt oder verleugnet, dass es sich um eine tiefgreifende Krise der Selbstwahrnehmung und der Lebenssicherheit von Gesellschaften gehandelt hat, ist unbestreitbar. Der Ausgang solcher Krisen ist ungewiss. Stuart Hall sagt etwa zur britischen Krise der 1980er Jahre nach dem Scheitern von Margaret Thatcher:
Crises are moments of potential change, but the nature of their resolution is not given. It may be that society moves on to another version of the same thing (Thatcher to Major?), or to a somewhat transformed version (Thatcher to Blair); or relations can be radically transformed.79
Nehmen wir zum Beispiel Deutschland, dann wurde während der Pandemie eine sogenannte »Reform- oder Fortschrittskoalition« der Ampel gewählt. Diese scheiterte an Vielem aber besonders an zwei Flanken, nämlich an der neoliberalen Conjuncture, die sich vom Wiederbeleben und der Befreiung der Märkte die post-pandemische Auferstehung versprach und dem populistischen Autoritarismus, der sich ›Führung‹ aus der ›Krise‹ wünschte. Wie man am post-pandemischen zweiten Erfolg des Trumpismus, dessen nationalistische Politik sich mit Elon Musk und seinem radikalen Marktliberalismus zusammentat, sieht, können sich beide Conjunctures, die der Marktliberalität und die des Autoritarismus, auch verbinden. Nun gibt es, wie an vielen Corona-Fiktionen zu sehen ist, auch dritte Bestrebungen, die die Welt, wie sie im Alten Normalen war, so nicht mehr wollen oder so nicht mehr leben können. Ob dergleichen Gefühle und Weltsichten nachhaltig sind und ob sie sich langfristig in gelebtem Leben niederschlagen, wird man in den nächsten Jahrzehnten sehen.
Gedächtnispolitik
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Covid-19 Pandemie als handlungsleitende Erinnerung wiederkommen wird. Nach der Pandemie kann auch immer vor der Pandemie sein. Ein solcher Durchstich kollektiver Erinnerung war während Corona zum Beispiel mit der Spanischen Grippe zu erleben. Plötzlich erschienen Studien zur fast vergessenen Spanischen Grippe von 1918-1921.80 Trotz der schieren Größe des damaligen Ereignisses – man schätzt zwischen 50 und 100 Millionen Opfer – war es auch hier zu einer kollektiven Amnesie gekommen. Die Existenz dieser Pandemie war bereits zur Echtzeit heruntergespielt worden, weil man in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs Panik vermeiden und die Kampfmoral aufrechterhalten wollte. Das politische Ziel wurde von staatlichen und militärischen Zensurmaßnahmen unterstützt, so dass auch heute noch die Quellenlage schlecht ist.81
Kollektive Gedächtnisse unterliegen also Konjunkturen. Die Kategorie ›kollektives Gedächtnis‹ geht auf Maurice Halbwachs’ Begriff des memoire collective zurück, den er in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt hat.82 Zentral an seinem Ansatz ist, dass das Geschichtsverständnis für Gesellschaften kein Spiegel historischer Tatsachen ist, sondern immer nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der jeweiligen Zeitgenoss:innen sozial gerahmt und gestaltet und damit eine politische Angelegenheit ist.