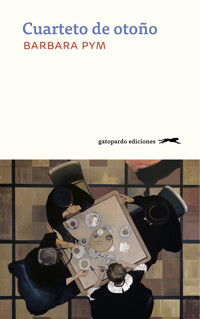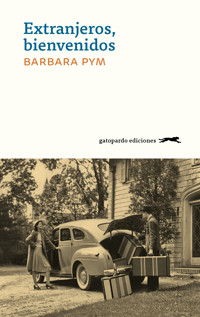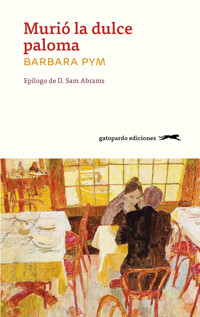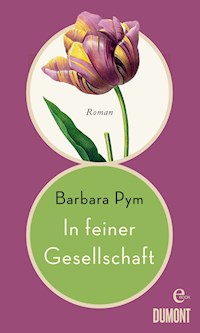9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie arbeiten im selben Büro und stehen kurz vor der Rente: Marcia, Letty, Norman und Edwin. Alle vier leben allein, dennoch pflegen sie außerhalb des Büros kaum Kontakt – auch wenn sie täglich Kaffee und Teewasser teilen. Sie beobachten, beargwöhnen, beraten einander und versuchen, über ihre Einsamkeit hinwegzuspielen. Letty, die zur Untermiete wohnt, gerne liest und Wert auf ihre Kleidung legt, steht im Schatten ihrer Freundin, zu der sie im Alter aufs Land ziehen wollte. Plötzlich jedoch werden alle Pläne umgeworfen. Das einzige große Ereignis in Marcias Leben, eine Krebsoperation, bringt sie dazu, für ihren Arzt zu schwärmen. Wenn sie keinen Nachsorgetermin hat, widmet sie sich dem Ordnen ihrer Milchflaschen und Konserven. Edwin ist Witwer und verbringt seine Zeit mit der Suche nach einem Gottesdienst. Sein ewig nörgelnder Kollege Norman besucht lieber einen kranken Verwandten, den er eigentlich genauso wenig leiden kann wie den Rest der Menschheit. Als Marcia und Letty in Rente gehen, trennen sich die Wege der vier − aber das Leben bringt die Schicksalsgemeinschaft immer wieder zusammen. Ironisch, schwarzhumorig und doch mit leisem Optimismus zeigt Barbara Pym in ›Quartett im Herbst‹ ihr herausragendes Können. ›Quartett im Herbst‹ wurde 1977 für den renommierten Booker-Preis nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Sie arbeiten im selben Büro und stehen kurz vor der Rente: Marcia, Letty, Norman und Edwin. Alle vier leben allein, dennoch pflegen sie außerhalb des Büros kaum Kontakt – auch wenn sie täglich Kaffee und Teewasser teilen. Sie beobachten, beargwöhnen, beraten einander und versuchen, über ihre Einsamkeit hinwegzuspielen. Letty, die zur Untermiete wohnt, gerne liest und Wert auf ihre Kleidung legt, steht seit Jahrzehnten im Schatten ihrer Freundin, zu der sie im Alter aufs Land ziehen wollte. Plötzlich jedoch werden alle Pläne umgeworfen.
Das einzige Ereignis in Marcias Leben, eine Krebsoperation, bringt sie dazu, für ihren Arzt MrStrong zu schwärmen. In ihrer freien Zeit widmet sie sich obsessiv dem Ordnen ihrer Milchflaschen und Konserven. Edwin ist Witwer und verbringt den Großteil seiner Zeit mit der Suche nach einer Andacht, einem Abendmahl oder Gottesdienst.
Sein ewig nörgelnder Kollege Norman besucht lieber einen kranken Verwandten, den er aber genauso wenig leiden kann wie den Rest der Menschheit.
Als Marcia und Letty in Rente gehen, trennen sich die Wege der vier – aber das Leben bringt die kleine Gemeinschaft immer wieder zusammen.
Ironisch, schwarzhumorig und doch mit leisem Optimismus zeigt Barbara Pym in ›Quartett im Herbst‹ ihr erzählerisches Können in seiner sprühendsten Form.
Mayotte Magnus © The Barbara Pym Society
Barbara Pym, geboren 1913 in Oswestry, gestorben 1980 in Finstock, studierte Literatur in Oxford und arbeitete als Assistant Editor im African Institute in London. Mit sechzehn Jahren schrieb sie den ersten von insgesamt dreizehn Romanen. Am bekanntesten ist sie für ihren Sittenroman ›Vortreffliche Frauen‹, der 2019 in Neuübersetzung bei DuMont erschien; 2020 folgte ›In feiner Gesellschaft‹. Ihr Werk ›Quartett im Herbst‹ stand 1977 auf der Shortlist des renommierten Man-Booker-Preises.
Sabine Roth, ist seit 1991 als Übersetzerin tätig. Zu den von ihr übersetzten Autorinnen und Autoren gehören Jane Austen, Henry James, Agatha Christie, John Le Carré, V.S. Naipaul, Elizabeth Strout und Lily King.
Barbara Pym
Quartettim Herbst
Roman
Aus dem Englischenvon Sabine Roth
Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Buch wurde durch ein Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert.
Die englische Originalausgabe erschien 1977 unter dem Titel
›Quartet in Autumn‹
bei Macmillan, London.
© Copyright Barbara Pym 1977
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Sabine Roth
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © akg-images/bilwissedition
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7114-8
www.dumont-buchverlag.de
1. Kapitel
Alle vier gingen sie an dem Tag in die Stadtbücherei, allerdings leicht zeitversetzt. Der Mann am Auskunftstresen nahm keine Notiz von ihnen; hätte er es getan, hätte er sie vielleicht als im weitesten Sinne zusammengehörig empfunden. Sie wiederum nahmen ihn, jeder für sich, sehr wohl wahr, ihn und sein schulterlanges goldenes Haar. Ihr abfälliges Urteil über die Länge dieser Haare, über ihre Üppigkeit, ihre generelle Unangebrachtheit – in seiner Funktion und an seinem Platz! – hatte sicher auch mit ihren eigenen diesbezüglichen Defiziten zu tun. Edwin trug sein Haar, das dünn, angegraut und oben sehr schütter war, in einer Art Pagenkopf – »Sogar ältere Herren tragen ihr Haar heute länger«, hatte sein Friseur ihm gesagt –, und die Frisur hatte etwas Legeres, das Edwin nicht ganz unkleidsam für einen Mann in den frühen Sechzigern fand. Norman hingegen hatte schon immer »Problemhaar« gehabt, grob, borstig und mittlerweile eisengrau, das in jüngeren Jahren um den Scheitel herum partout nicht glatt hatte anliegen wollen. Jetzt musste er es nicht mehr scheiteln, denn er hatte sich einen Bürstenschnitt nach dem Vorbild des amerikanischen Crewcut der Vierziger- und Fünfzigerjahre zugelegt. Die Frisuren der beiden Frauen – Letty und Marcia – unterschieden sich so stark, wie dies nur denkbar war in den 1970ern, als die Frau ab sechzig weiße, graue oder rotgefärbte Löckchen zu haben hatte, die sie beim Friseur regelmäßig in Form bringen ließ. Lettys Haare waren von einem blassen Mausbraun, länger als ratsam und von ähnlich schlaffer, flusiger Beschaffenheit wie die von Edwin. Die Leute sagten ihr manchmal – wenn auch nicht mehr so oft –, welches Glück sie doch habe, so gar nicht grau geworden zu sein, aber Letty wusste nur zu gut, dass sich zwischen den braunen genügend weiße Haare versteckten und dass sich die meisten Frauen längst eine aufhellende »Tönung« gegönnt hätten. Marcia färbte ihr steifes, stumpfes Kurzhaar zu einem kompromisslosen Tiefdunkelbraun, aus einer Flasche, die in ihrem Badezimmerschrank stand, seit sie vor nahezu dreißig Jahren das erste Weiß bei sich entdeckt hatte. Wenn seitdem schonendere und kleidsamere Methoden zum Haarefärben erfunden worden waren, so war dies nicht zu Marcia durchgedrungen.
Jetzt, während der Mittagspause, nutzten sie die Bücherei jeder auf eigene Weise. Edwin konsultierte Crockford’s Klerikeralmanach und fand zudem Anlass, im Who’s Who sowie im Who Was Who nachzuschlagen, denn er war dabei, Vorleben und Eignung eines gewissen Kirchenmannes zu überprüfen, der in einem Sprengel, wo Edwin manchmal den Gottesdienst besuchte, kürzlich eine Pfründe erhalten hatte. Norman, der kein großer Leser war, las auch jetzt nichts; für ihn war die Bücherei ein Ort, an dem es sich angenehm sitzen ließ, und dazu näher als das Britische Museum, wo er ebenfalls gern die Mittagspause verbrachte. Auch Marcia sah in der Bücherei ein angenehmes, warmes Plätzchen, wo man sich im Winter gut aufhalten konnte, ohne dafür Eintritt bezahlen zu müssen. Außerdem konnte man allerlei Broschüren und Faltblätter mitnehmen, in denen die diversen Angebote beschrieben waren, die der Bezirk Camden für seine Senioren bereithielt. Seit sie die sechzig überschritten hatte, nutzte Marcia jede Gelegenheit, um herauszufinden, was ihr an kostenlosen Busfahrten und Vorzugspreisen in Restaurants, Friseurläden oder Fußpflegesalons zustand, auch wenn sie von diesem Wissen nie Gebrauch machte. Die Bücherei war zudem ein guter Ort für die Entsorgung von Dingen, die sie nicht mehr brauchte, die aber aus Marcias Sicht zu schade zum Wegwerfen waren. Darunter fielen bestimmte Flaschen – allerdings nicht Milchflaschen, die sie in ihrem Gartenschuppen aufbewahrte –, alle möglichen Schachteln und Papiertüten sowie sonstige Gegenstände, die in einer Ecke der Bücherei zurückgelassen werden konnten, wenn niemand hinsah. Eine der Bibliotheksangestellten hatte sie deshalb schon seit einer Weile im Blick, doch davon ahnte Marcia nichts, als sie einen kleinen, mit Schottenkaros bedruckten Pappkarton – »Haferkekse aus Killiecrankie« – in einer Lücke, die sich in einem der Belletristikregale anbot, nach hinten durchschob.
Von den vieren diente die Bücherei nur Letty zur Erbauung und möglichen geistigen Fortentwicklung. Sie hatte von Jugend an passioniert Romane gelesen, aber falls sie gehofft hatte, einen zu finden, der ihre eigene Erfahrung widerspiegelte, so hatte sie einsehen müssen, dass das Leben einer weder verheirateten noch sonst wie gebundenen älteren Frau von keinem Interesse für den Verfasser moderner Prosa war. Vorüber waren die Tage, da sie in ihre Ausleihliste bei Boots hoffnungsfroh die Romantitel einzutragen pflegte, die in den Sonntagszeitungen besprochen waren, und nun hatte sie ihr Leseverhalten umgestellt. Von Liebesromanen enttäuscht, suchte Letty ihre Erfüllung in Biografien, von denen es ja ausreichend gab. Und da in ihnen »wahre« Geschichten erzählt wurden, hatten sie der Belletristik letztlich sogar etwas voraus. Vielleicht nicht unbedingt einer Jane Austen oder einem Tolstoi, die Letty ohnehin nicht gelesen hatte, aber »wertvoller« als irgendwelche heutigen Romane schienen sie allemal.
Ganz ähnlich, möglicherweise weil sie als Einzige der vier gerne las, war sie auch die Einzige, die häufig außerhalb des Büros Mittag machte. Das Lokal, das sie für gewöhnlich aufsuchte, hieß zwar »Rendezvous«, war aber alles andere als ein Ort für romantische Stelldicheins. Angestellte aus den umliegenden Büros drängten zwischen zwölf und zwei Uhr herein, aßen in aller Eile und hasteten wieder davon. Der Mann an Lettys Tisch saß schon, als sie Platz nahm. Mit einem kurzen, feindseligen Blick schob er ihr die Speisekarte hin, dann kam sein Kaffee, er trank ihn aus, ließ fünf Pence für die Kellnerin liegen und ging. Seinen Platz nahm eine Frau ein, die sich mit gerunzelter Stirn in die Karte vertiefte. Dann sah sie auf, als läge ihr eine Bemerkung über die Preiserhöhungen auf der Zunge – Die Mehrwertsteuer!, schien ihr bläulich-blasser Blick zu sagen. Doch von Letty kam keine Ermutigung, und so senkte sie die Augen wieder, bestellte überbackene Makkaroni mit Pommes frites und dazu ein Glas Wasser. Der Moment war vorbei.
Letty griff nach ihrer Rechnung und stand vom Tisch auf. So unbeteiligt sie sich nach außen auch gab, war ihr die Geste keineswegs entgangen. Jemand hatte auf sie zuzugehen versucht. Sie hätten ein paar Sätze wechseln können, und zwischen zwei einsamen Menschen wäre vielleicht ein Band entstanden. Aber ihre Tischnachbarin, die nun den ersten Hunger stillte, beugte sich tief über ihre Makkaroni. Jetzt ließ sich das Versäumte nicht mehr nachholen. Wieder einmal hatte Letty eine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen.
Im Büro biss derweil Edwin, der gern naschte, einem schwarzen Geleepüppchen den Kopf ab. Weder die Handlung an sich noch die Farbwahl waren rassistisch motiviert, er mochte nur einfach den stechenden Lakritzgeschmack der schwarzen Püppchen lieber als das süßliche Orangen-, Zitronen- oder Himbeeraroma der anderen. Der Verzehr der kleinen Geleefigur bildete den letzten Gang seiner Mittagsmahlzeit, die er in der Regel am Schreibtisch einnahm, inmitten von Papieren und Karteikarten.
Als Letty ins Zimmer kam, streckte er ihr die Tüte mit den Geleepüppchen hin, was freilich nur eine rituelle Geste war, denn er wusste schon, dass sie ablehnen würde. Naschen war undiszipliniert, und auch wenn sie nun in den Sechzigern war, gab es keinen Grund, warum sie ihre schmale, adrette Figur nicht bewahren sollte.
Die beiden anderen im Zimmer, Norman und Marcia, waren ebenfalls noch beim Essen. Norman aß ein Hühnerbein, Marcia ein unordentliches Sandwich, aus dem Salatblätter und glitschige Tomatenscheiben herausquollen. Von einer Matte auf dem Fußboden blies der elektrische Wasserkocher seinen Dampfstrahl in die Luft.
Norman wickelte seinen Hühnerknochen ein und versenkte ihn säuberlich im Papierkorb. Edwin ließ einen Beutel Earl Grey vorsichtig in die Tasse hinabschaukeln und goss ihn mit kochendem Wasser aus dem Kessel auf. Dann gab er einen Zitronenschnitz aus einem kleinen, runden Plastikbehälter dazu. Marcia öffnete eine Büchse Nescafé und machte zwei Tassen, eine für sich und eine für Norman. Das hatte nichts weiter zu besagen, es war einfach eine praktische Übereinkunft zwischen ihnen. Sie mochten beide Kaffee, und es kam billiger, eine große Büchse zu kaufen und sie zu teilen. Letty, die nach ihrer Auswärtsmahlzeit kein Heißgetränk mehr brauchte, holte sich in der Toilette ein Glas Wasser und deponierte es auf einem bunten, handgearbeiteten Bastuntersetzer auf ihrem Tisch. Ihr Schreibtisch stand am Fenster, und sie hatte das Fensterbrett mit Topfpflanzen vollgestellt, wuchernden Hängepflanzen, die sich vermehrten, indem sie Miniaturexemplare ihrer selbst abwarfen, die als Ableger in neue Töpfe gesetzt werden konnten. »Mehr als die Kunst noch, liebt’ sie die Natur«, hatte Edwin einmal Landors Abgesang eines alten Philosophen auf Letty abgewandelt, und er hätte fast noch die Zeile mit dem Feuer des Lebens hinzugefügt, an dem sie ihre Hände gewärmt hatte – ohne jedoch zu nahe heranzugehen, wohlgemerkt. Nun sank das Feuer, wie es für sie alle sank, aber war sie, war irgendeiner von ihnen, schon bereit zu gehen?
Etwas dergleichen mochte in Normans Unterbewusstsein herumspuken, als er die Seiten seiner Zeitung umblätterte.
»Hypothermie.« Er las das Wort langsam. »Da ist schon wieder eine alte Frau dran gestorben. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Hypothermie kriegen.«
»Das ist nichts, was man kriegt«, sagte Marcia herrisch. »Nicht wie eine Krankheit, mit der man sich ansteckt, und dann hat man sie.«
»Na ja, wenn man damit tot aufgefunden wird, so wie diese Frau da, kann man ja schon sagen, dass man es hatte, oder?«, setzte Norman sich zur Wehr.
Letty streckte die Hand nach dem Heizkörper aus und ließ sie dort liegen. »Hypothermie, das heißt Unterkühlung, nicht?«, sagte sie. »Auskühlung.«
»Das zumindest haben wir also gemeinsam«, bemerkte Norman mit seiner bissigen kleinen Stimme, die bestens zur Schmalheit und Hagerkeit seines Körpers zu passen schien. »Die Aussicht darauf, dass man uns irgendwann als Hypothermie-Tote auffindet.«
Marcia lächelte und strich über ein Faltblatt in ihrer Handtasche, das sie vorhin erst in der Bücherei hatte mitgehen lassen – Informationen über Heizkostenzuschüsse für Senioren –, aber sie behielt ihr Wissen für sich.
»Optimistisch wie immer«, sagte Edwin. »Aber ein Körnchen Wahrheit ist vielleicht dran. Wir sind vier Menschen auf der Schwelle zum Rentenalter, die alle allein leben und die alle keine engeren Angehörigen in der Nähe haben.«
Letty stieß ein Murmeln aus, als wollte sie gegen diese Beschreibung aufbegehren. Und doch war es unbestreitbar: Sie alle lebten allein. Bezeichnenderweise hatten sie das Thema bereits am Vormittag gestreift, als irgendetwas – ebenfalls in Normans Zeitung – sie daran erinnert hatte, dass es auf den Muttertag zuging; die Läden waren schon voll mit entsprechenden Geschenkartikeln, und die Blumenpreise hatten einen Satz nach oben gemacht. Der Anstieg wurde vermerkt und kommentiert, auch wenn keiner von ihnen Blumen kaufte und sie alle viel zu alt waren, um noch Mütter zu haben; ja, manchmal schien sogar der Gedanke abwegig, dass sie überhaupt jemals Mütter gehabt haben sollten. Edwins Mutter hatte ein respektables Alter erreicht – fünfundsiebzig – und war nach kurzer Krankheit verstorben, ohne ihrem Sohn Ungelegenheiten zu bereiten. Marcias Mutter war in dem Vorstadthäuschen gestorben, das Marcia nun allein bewohnte, in dem Schlafzimmer nach vorne hinaus, ihren alten Kater Snowy neben sich. Sie war neunundachtzig geworden, was manchem sehr alt vorkommen mochte, insgesamt aber wenig Wundervolles oder Bemerkenswertes an sich hatte. Lettys Mutter war nach Kriegsende gestorben, worauf ihr Vater wieder geheiratet hatte. Kurz danach war auch der Vater gestorben, und die Stiefmutter hatte wenig später einen neuen Mann gefunden, weshalb nichts mehr Letty an das südwestenglische Städtchen band, in dem sie geboren und aufgewachsen war. Sie hatte rührselige und etwas ungenaue Erinnerungen an ihre Mutter, wie sie in einem Kleid aus irgendeinem fließenden Stoff durch den Garten ging und verwelkte Blüten abschnitt. Norman hatte seine Mutter als Einziger gar nicht gekannt – »Ganz ohne Mama aufgewachsen«, sagte er gern in seinem bitteren, ironischen Ton. Er und seine Schwester waren von einer Tante großgezogen worden, aber trotzdem war er es, der am stärksten mit der Kommerzialisierung der guten alten Muttertagstradition am Laetare-Sonntag haderte.
»Na, Sie haben ja immerhin Ihre Kirche«, sagte er jetzt zu Edwin.
»Und Father Gellibrand«, fügte Marcia hinzu, denn sie hatten alle schon viel über Father G. gehört, wie Edwin ihn zu nennen pflegte, und beneideten Edwin um den stabilen Rückhalt seiner Kirche in der Nähe des Clapham Common, wo er Zeremoniar war (was immer das bedeuten mochte) und überdies im Gemeindekirchenrat (dem GKR) saß. Um Edwin brauchte man sich keine Sorgen zu machen, denn auch wenn er Witwer war und allein lebte, hatte er eine verheiratete Tochter in Beckenham, die zweifellos sicherstellen würde, dass man ihren alten Vater nicht als Hypothermie-Toten auffand.
»O ja, Father G. ist ein regelrechter Fels in der Brandung«, räumte Edwin ein – aber schließlich stand die Kirche jedem offen. Er begriff nicht, warum Letty und Marcia nicht mehr Interesse am Kirchgang zeigten. Bei Norman war es einfacher zu verstehen.
Die Tür flog auf, und eine junge Schwarze, herausfordernd keck und strotzend vor Leben, streckte den Kopf herein.
»Irgendwelche Post?«, fragte sie in den Raum.
Jeder der vier sah sich einen Moment lang durch ihre Augen: Edwin, groß und schwer, mit seinem schütteren Haar und dem rosa Gesicht, Norman, klein und drahtig mit seinem grauen Stachelkopf, Marcia mit ihrem generellen Anstrich von Verschrobenheit, und die rüschige, verblühte Letty, die doch so gediegen war in ihrer Erscheinung und sich noch immer Mühe mit ihrer Kleidung gab.
»Post?« Edwin sprach als Erster, wie ein Echo auf ihre Frage. »Sie sind zu früh dran, Eulalia. Die Post geht erst um halb vier raus, und wir haben jetzt«, er sah auf die Uhr, »exakt zwei Uhr zweiundvierzig … Probieren kann man’s ja mal«, sagte er, nachdem das Mädchen unverrichteter Dinge abgezogen war.
»Die will nur früher Feierabend machen, faule kleine …«, sagte Norman.
Marcia schloss entnervt die Augen, als Norman sich über »die Schwarzen« auszulassen begann. Letty versuchte das Thema zu wechseln; ihr war es immer unangenehm, Eulalia zu kritisieren oder sich unduldsam gegenüber Farbigen fühlen zu müssen. Trotzdem, das Mädchen hatte etwas, das einen ärgern konnte, jemand sollte sie Mores lehren, auch wenn man schwer leugnen konnte, dass es vor allem dieses überbordend Lebenssprühende an ihr war, das einen irritierte, gerade als ältere Frau, die sich in ihrer Nähe grauer denn je fühlte, zerknittert und ausgedörrt von der schwachen englischen Sonne.
Endlich kam der Tee, und um kurz vor fünf ließen die beiden Männer den Stift fallen, packten ein und verließen gemeinsam den Raum, wobei sich ihre Wege am Ausgang des Gebäudes trennen würden: Edwin ging zur Northern Line, die ihn nach Clapham Common brachte, Norman fuhr mit der Bakerloo-U-Bahn nach Kilburn Park.
Letty und Marcia ließen sich beim Zusammenräumen mehr Zeit. Dabei schwatzten sie nicht etwa über die Männer, die für sie Teil der Büromöblierung und damit kein Gesprächsthema waren, es sei denn, einer von ihnen fiel eklatant aus der Rolle. Vor dem Fenster pickten die Tauben auf dem Dach aneinander herum, lasen sich vermutlich Insekten aus dem Gefieder. Viel mehr können wir Menschen auch nicht füreinander tun, dachte Letty. Es war allgemein bekannt, dass Marcia vor einer Weile eine größere Operation über sich hatte ergehen lassen müssen. Sie war keine ganze Frau mehr, irgendein entscheidender Teil war ihr wegoperiert worden, ob allerdings aus Brust oder Unterleib, darüber hatte sie nichts verlauten lassen, sondern nur gesagt, dass sie einen »schweren Eingriff« hinter sich habe. Letty freilich meinte zu wissen, dass ihr eine Brust entfernt worden war, wobei auch sie nicht sagen konnte, welche. Edwin und Norman hatten Vermutungen dieserhalb angestellt und die Angelegenheit auf ihre Männerart erörtert; sie fanden, Marcia hätte sie einweihen müssen, da sie alle vier so eng im selben Büro zusammenarbeiteten. Der einzige Schluss, den sie aus der Sache hatten ziehen können, war, dass die Operation Marcia offenbar noch wunderlicher gemacht hatte, als sie vorher schon gewesen war.
In der Vergangenheit hätten beide, Letty wie Marcia, vielleicht lieben und geliebt werden können; nun aber fanden die für einen Ehemann oder Geliebten, für ein Kind oder sogar Enkelkind bestimmten Gefühle kein natürliches Ventil mehr; keine Katze, kein Hund oder wenigstens Vogel teilte ihr Leben, und weder Edwin noch Norman hatten Liebe in ihnen entfacht. Marcia hatte einmal eine Katze gehabt, aber der alte Snowy war schon vor Längerem gestorben, »dahingegangen«, »abberufen worden«, wie immer man es nennen mochte. Unter solchen Umständen kann in Frauen eine Art unsentimentaler Zärtlichkeit füreinander wachsen, die sich in kleinen Gesten der Fürsorglichkeit ausdrückt, nicht unähnlich den Tauben, die einander die Milben aus dem Federkleid picken. Falls es Marcia nach solch einem Ventil verlangte, fehlten ihr die Worte dafür. Letty war es, die sagte: »Sie sehen müde aus – soll ich Ihnen einen Tee machen?« Und als Marcia ablehnte, fuhr sie fort: »Hoffentlich ist Ihr Zug nicht zu voll und Sie kriegen einen Sitzplatz – jetzt, wo es bald sechs wird, müsste es ja schon besser sein.« Sie versuchte sie anzulächeln, aber als sie zu ihr hinsah, schienen ihr Marcias dunkle Augen hinter den Brillengläsern bedrohlich vergrößert, wie die Augen dieser Nachtaffen, die in den Bäumen herumturnten – wie hießen die gleich wieder? Pottos? Lemuren? Marcia, die Letty einen scharfen Blick zuwarf, dachte: Sie sieht aus wie ein altes Schaf, aber sie meint es nett, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen viel einmischt.
Norman, der zum Stanmore-Zweig der Bakerloo-Linie eilte, fuhr seinen Schwager im Krankenhaus besuchen. Jetzt, wo seine Schwester tot war, gab es keine direkte Verbindung mehr zwischen Ken und ihm, und Norman hatte das angenehme Gefühl, eine gute Tat zu tun, indem er ihn besuchte. Er hat niemanden, dachte er, denn das einzige Kind aus der Ehe war nach Neuseeland ausgewandert. Tatsächlich hatte Ken sehr wohl jemanden, eine Bekannte, die er zu heiraten gedachte, aber sie besuchte ihn lieber nicht am selben Tag wie Norman. »Lassen wir ihn allein kommen«, hatten sie zueinander gesagt, »er hat ja niemanden, da ist so ein Besuch eine nette Abwechslung für ihn.«
Norman war selbst noch nie im Krankenhaus gewesen, aber Marcia hatte viele Andeutungen über ihre Erlebnisse dort und insbesondere über MrStrong fallen lassen, den Chirurgen, der sie aufgeschnitten hatte. Nicht dass Kens Erfahrung mit der ihrigen vergleichbar gewesen wäre, aber eine Ahnung bekam man dadurch doch, insofern war Norman gerüstet, als die Glocke schlug und er sich mit dem Strom der anderen Besucher durch die Schwingtür in den Krankensaal spülen ließ. Blumen oder Obst hatte er nicht dabei; zwischen ihnen war klar, dass der Besuch selbst alles war, was erwartet oder geschuldet wurde. Mit dem Lesen hatte es auch Ken nicht sonderlich, wobei er nun recht dankbar Normans Evening Standard durchblätterte. Von Berufs wegen war er Fahrprüfer, und sein derzeitiger Klinikaufenthalt war nicht, wie im Krankensaal gespöttelt wurde, einem Unfall geschuldet, den eine überforderte Frau mittleren Alters bei der Prüfung gebaut hatte, sondern einem Geschwür im Zwölffingerdarm, dessen Ursache die Bedenklichkeit des Lebens ganz allgemein war, wenngleich zweifellos noch gefördert durch die Gefahren, denen seine tägliche Arbeit ihn aussetzte.
Norman vermied es bewusst, die anderen Patienten anzuschauen, als er am Bettrand Platz nahm. Ken kam ihm eine Spur schlapp vor, aber Männer im Bett waren natürlich nie ein erhebender Anblick. Der durchschnittliche Herrenschlafanzug hatte nun mal etwas ausgesprochen Unattraktives. Bei den Damen war da schon mehr geboten, mit ihren pastellfarbenen Nachthemden und puscheligen Bettjäckchen, auf die er einen Blick erhascht hatte, als er auf seinem Weg nach oben an der Frauenstation vorbeigekommen war. Auf Kens Nachttisch standen neben dem unvermeidlichen Plastikkrug und -glas nur eine Schachtel Papiertaschentücher und eine Flasche Lucozade, aber in dem offenen Fach darunter erspähte Norman eine metallene Brechschale und ein merkwürdig geformtes Gefäß aus einem grauen, kartonartigen Material, das verdächtig so aussah, als könnte es zum Wasserlassen bestimmt sein – für den Harn, wie er anklagend dachte. Die Sicht auf diese nur halb verborgenen Gegenstände erfüllte ihn mit Unbehagen und leisem Groll, sodass er nicht recht wusste, was er zu seinem Schwager sagen sollte.
»Irgendwie ruhig hier heute Abend«, bemerkte er.
»Der Fernseher ist kaputt.«
»Ach, daran liegt es. Ich dachte gleich, dass irgendwas nicht stimmt.« Norman linste zu dem Tisch in der Raummitte. Da stand der große Kasten, sein Gesicht so grau und leblos wie die Gesichter der Zuschauer in ihren Betten. Er hätte mit einem Tuch verhängt gehört, fand Norman, allein schon aus Anstandsgründen. »Seit wann denn schon?«
»Gestern, und bis jetzt haben sie rein gar nichts unternommen. Man denkt doch, das wäre das Mindeste, was sie tun können, oder?«
»Tja, dann hast du mehr Zeit für deine Gedanken«, sagte Norman. Das war sarkastisch gemeint, wenn nicht gar ein wenig grausam, denn was für Gedanken konnte Ken schon haben, die besser als Fernsehen waren? Er ahnte nicht, dass Ken sehr wohl Gedanken hatte, Träume sogar, die Fahrschule betreffend, die er und seine Bekannte gemeinsam eröffnen wollten – dass er dalag und sich Namen überlegte: »Excelsior« böte sich natürlich an, oder »Bona Fide«; dann schwirrte ihm plötzlich das Wort »Delfin« durch den Sinn, und er hatte die Vision einer ganzen Flotte von Wagen, türkisblau und butterblumengelb, die über die Ringautobahn wogten und glitten, ohne je bei den Ampeln den Motor abzuwürgen, wie das die Fahrschüler im wirklichen Leben so oft taten. Er dachte auch gern über den Wagentyp nach, den sie haben würden – keinen ausländischen, nichts mit Heckmotor, das wäre widernatürlich, wie eine Uhr mit eckigem Zifferblatt. Norman konnte er diese Überlegungen nicht enthüllen, denn Norman hielt nichts von Autos und besaß nicht einmal einen Führerschein. Ken hatte darum stets eine mitleidige Verachtung für ihn empfunden, seinen unmännlichen Schwager, der als Schreiberling in einem Büro voller ältlicher Frauen arbeitete.
So saßen sie mehr oder weniger schweigsam da und waren beide erleichtert, als die Glocke ertönte und die Besuchszeit um war.
»Alles so weit in Ordnung?«, fragte Norman quasi im Aufspringen.
»Der Tee ist zu stark.«
»Oh.« Norman war perplex. Als ob er da etwas machen könnte! Was erwartete Ken von ihm? »Kannst du nicht die Oberschwester oder eine von den Pflegerinnen bitten, ihn schwächer zu machen oder mehr Milch reinzutun?«
»Schmecken würde man es trotzdem. Zu stark ist zu stark. Und von den Schwestern kann ich sowieso keine bitten – dazu sind sie nicht da.«
»Dann eben die Frau, die den Tee macht.«
»Den Teufel werd ich tun«, sagte Ken dunkel. »Aber zu starker Tee ist das Letzte, was ich in meinem Zustand zu mir nehmen sollte.« Norman schüttelte sich wie ein gereizter kleiner Hund. Er war nicht hergekommen, um in solche Komplikationen verwickelt zu werden, und ließ sich willig von einer resoluten irischen Schwester hinausscheuchen, ohne sich noch einmal nach dem Patienten im Bett umzudrehen.
Draußen wurde sein Missmut noch verstärkt durch die vielen Autos, die zwischen ihm und der Bushaltestelle dahinbrausten, sodass er nicht auf die andere Straßenseite kam. Dann musste er endlos auf den Bus warten, und als er den Platz erreichte, an dem er wohnte, war auch dort alles voller Autos, die dicht an dicht parkten und bis auf den Gehsteig überstanden. Einige waren so groß, dass ihre Hinterteile – ihre Hinterbacken, Steiße, Bürzel – weit über den Bordstein hinausragten und er einen Bogen um sie machen musste. »Drecksding«, murmelte er und versetzte einem einen kleinen, wirkungslosen Tritt. »Drecksding, Drecksding, Drecksding.«
Niemand hörte ihn. Die Mandelbäume standen in Blüte, aber er sah sie nicht, nahm das im Laternenlicht schimmernde Weiß ihrer Zweige nicht wahr. Er schloss die Haustür auf und ging hinauf in das möblierte Zimmer, das er mietete. Der Besuch hatte ihn angestrengt, und es war ja nicht einmal so, dass Ken viel davon gehabt hätte.
Hinter Edwin lag ein weitaus befriedigenderer Abend. Die gesungene Messe hatte in der für Wochentage üblichen Besetzung stattgefunden – nur sieben Gemeindemitglieder, aber dafür das volle Aufgebot im Altarraum. Im Anschluss waren Father G. und er auf einen Drink ins Pub gegangen. Sie hatten über Kirchenangelegenheiten gefachsimpelt: Sollten sie einen stärkeren Weihrauch bestellen, nun da die Rosa Mystica fast aufgebraucht war? Wie ratsam war es, der Jugend zu erlauben, die gelegentliche Sonntagsvesper mit Gitarren zu gestalten? Und wie würde die Gemeinde reagieren, wenn Father G. die Stufe drei der alternativen Gottesdienstordnung einzuführen versuchte?
»Dieses ständige Aufstehen zum Beten«, sagte Edwin. »Das würde den Leuten doch gegen den Strich gehen.«
»Aber der Friedenskuss, wo man dem Banknachbarn zum Zeichen der Verbundenheit die Hand reicht, das ist im Prinzip schon eine …« Father G. hatte »eine schöne Idee« sagen wollen, aber »schön« war, auf seine spezielle Gemeinde gemünzt, vielleicht irreführend.
Angesichts des spärlich besuchten Gottesdienstes, der hinter ihnen lag, hatte Edwin da ebenfalls seine Bedenken – diese Handvoll Menschen, verteilt über das hallende Kirchenschiff, keiner dem anderen nahe genug für ein Zeichen jedweder Art –, aber er brachte es nicht über sich, Father G. seine Vision einer andächtigen Menge zu rauben. Er dachte oft voller Sehnsucht an die Tage der anglokatholischen Renaissance im 19.Jahrhundert, ja selbst an das deutlich kirchenfreundlichere Klima vor zwanzig Jahren, in das Father G., groß und ausgemergelt in seiner Soutane und mit dem Birett, zehnmal besser gepasst hätte als in die heutige Zeit, wo so viele der jungen Priester mit langen Haaren und Jeans herumliefen. Einen von der Sorte hatten sie gerade vorhin im Pub gesehen. Edwin schauderte bei der Vorstellung, wie die Gottesdienste in seiner Kirche wohl abliefen. »Ich glaube, wir sollten die Abendmesse lieber so lassen, wie sie ist«, sagte er. Nur über meine Leiche, dachte er dabei theatralisch, während vor seinem geistigen Auge eine Rotte gitarrenschwingender Jungen und Mädchen über ihn hinwegtrampelte.
Sie trennten sich vor Edwins gepflegtem Doppelhäuschen in einer Straße nicht weit vom Stadtpark. Als er neben dem Garderobenständer in der Diele stand, musste Edwin an seine verstorbene Frau denken, Phyllis. Dieses momentlange Verharren vor der Wohnzimmertür war es, das sie ihm ins Gedächtnis rief. Fast meinte er ihre Stimme zu hören, ihr leicht nörgelndes: »Bist du das, Edwin?« Als ob es jemand anders sein könnte! Jetzt besaß er die ganze Freiheit, die die Einsamkeit mit sich bringt – konnte die Messe besuchen, sooft er wollte, an Sitzungen teilnehmen, die sich den ganzen Abend hinzogen, Sachen für Basarverkäufe im hinteren Zimmer ansammeln und sie monatelang dort liegen lassen. Er konnte ins Pub oder ins Pfarrhaus gehen und nach Belieben dort bleiben.
Während er sich fürs Bett fertig machte, summte Edwin eines seiner Lieblings-Chorstücke, »O lieblicher Schöpfer des Lichts«. Es war schwierig, beim Cantus planus keinen Fehler zu machen, die Konzentration auf die richtigen Noten lenkte ihn von den Worten ab. So oder so schien es übertrieben harsch, die heutige Gottesdienstgemeinde als »verstrickt in Sünd und Hader sehr« zu bezeichnen, wie es in einer Textzeile hieß. Mit so etwas würde ein moderner Mensch nichts anfangen können. Vielleicht war das einer der Gründe, warum kaum jemand in die Kirche kam.
2. Kapitel
So vieles gemahnte Letty neuerdings an die eigene Vergänglichkeit oder, weniger poetisch ausgedrückt, an Verfall und Tod. Nicht ganz so augenfällig wie die Nachrufe in Times und Telegraph waren »verstörende« Anblicke, wie sie es bei sich nannte. Heute Morgen am U-Bahnsteig etwa hatte eine Frau, die mitten im Strom der hastenden Pendler zusammengesackt auf einer Bank saß, sie so stark an eine Schulkameradin erinnert, dass sie sich gezwungen hatte, sich noch einmal umzudrehen und sich zu vergewissern, dass es nicht Janet Belling war. Ihr schien eher, nein, aber es hätte Janet sein können, und selbst wenn nicht, war es doch ein Mensch, eine Frau, die irgendwelche Umstände an diesen Punkt gebracht hatten. Sollte man etwas unternehmen? Während Letty noch zögerte, beugte sich ein Mädchen in einem staubig-schwarzen langen Rock und schäbigen Stiefeln zu der zusammengesunkenen Gestalt hinab und fragte gedämpft etwas. Augenblicklich bäumte die Gestalt sich auf und schrie mit einer lauten, gefährlich unkontrollierten Stimme: »Leck mich doch!« Dann war es jedenfalls nicht Janet Belling, dachte Letty mit unwillkürlichem Aufatmen; Janet hätte niemals eine solche Sprache geführt. Aber das hätte vor fünfzig Jahren ohnehin niemand – es herrschten jetzt andere Sitten als damals, da war so etwas kein Maßstab. Das Mädchen derweil ging in Würde seiner Wege. Sie war mutiger gewesen als Letty.
Heute Morgen wurde auf den Straßen wieder gesammelt. Marcia richtete den Blick auf die junge Frau, die mit ihrem Bauchladen voller Fähnchen und der scheppernden Büchse vor dem U-Bahn-Eingang stand. Irgendetwas mit Krebs. Marcia hielt in stillem Triumph auf sie zu, ein Zehn-Pence-Stück in der Hand.
Das lächelnde Mädchen hob schon das Fähnchen, das die Form eines kleinen Wappenschilds hatte, um es Marcia an den Mantelaufschlag zu stecken.
»Danke«, sagte es, als die Münze durch den Schlitz klapperte.
»Ein sehr guter Zweck«, murmelte Marcia, »der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Auch mir wurde nämlich …«
Das Mädchen wartete nervös, ihr Lächeln jetzt leicht gezwungen, doch wie Letty war auch sie wie hypnotisiert von den Nachtaffenaugen hinter den dicken Brillengläsern. Und vielversprechende junge Männer, die sich andernfalls vielleicht zum Erwerb eines Fähnchens hätten verleiten lassen, duckten sich indessen, Eile vorschützend, an ihr vorbei in den U-Bahn-Eingang.
»Auch mir wurde nämlich«, wiederholte Marcia, »schon einmal etwas entfernt.«
In diesem Moment näherte sich, angezogen vom Anblick der hübschen jungen Spendensammlerin, ein älterer Herr, sodass Marcias Versuch, ein Gespräch anzufangen, im Keim erstickt wurde, aber die Erinnerung an ihren Krankenhausaufenthalt begleitete sie den ganzen Weg ins Büro.
Marcia war eine jener Frauen, die von ihren Müttern die Überzeugung mit auf den Weg bekommen hatten, der weibliche Körper sei etwas so Sakrosanktes, dass kein Chirurgenskalpell ihn jemals berühren dürfe. Als es für sie freilich ernst wurde, stellte sich die Frage nach Gegenwehr gar nicht. Sie lächelte beim Gedanken an MrStrong, den Chirurgen, der die Operation durchgeführt hatte. Brust, Gebärmutter, Mandeln, Blinddarm, egal, er schnitt unterschiedslos alles heraus, schien seine sachliche, kompetente Art zu besagen. Im Geist sah sie ihn wieder im Krankensaal von Bett zu Bett schreiten, seinen Tross hinter sich, von ihr mit gierigen Blicken beobachtet und erwartet, bis der große Moment endlich da war und er bei ihr haltmachte. »Und wie geht es Miss Ivory heute?«, erkundigte er sich in diesem beinahe neckenden Tonfall. Dann berichtete sie ihm, wie es ihr ging, und er hörte zu, stellte ab und zu eine Zwischenfrage oder bat die Oberschwester um ihre Meinung, und seine fast etwas zu lockere Art machte professioneller Zuwendung Platz.
Wenn der Operateur Gott war, so waren die Kaplane seine Werkzeuge, sie kamen gleich nach den Assistenzärzten. Der gutaussehende junge römisch-katholische Kaplan war der Erste gewesen; jeder von uns brauche einmal etwas Ruhe, hatte er ihr versichert, auch wenn er selbst nicht so aussah, als könnte er derlei je nötig haben, und so ein Klinikaufenthalt, so unschön er in vielerlei Hinsicht auch sei, erweise sich manchmal als ein verkappter Segen, gebe es doch keine Lebenslage, der sich nicht etwas Gutes abgewinnen lasse, gemäß der alten Wahrheit, nach der jede Wolke einen Silberrand habe … Sein Wortschwall, vorgetragen im charmantesten irischen Singsang, floss so üppig, dass Marcia erst nach geraumer Zeit einflechten konnte, dass sie gar nicht katholisch war.
»Ach so, Sie sind Protestantin.« Das Wort hatte etwas erschütternd Brutales, ein fast unausbleiblicher Effekt, wenn man das vagere und mildere »anglikanisch« oder »Church of England« gewohnt war. »Hat mich sehr gefreut«, setzte er großmütig hinzu, »zu Ihnen kommt dann der protestantische Kaplan.«
Der anglikanische Kaplan bot ihr die Kommunion an, und obgleich sie nie in die Kirche ging, nahm Marcia an, teils aus Aberglauben, teils aber auch, weil es ihr im Saal eine Sonderstellung verlieh. Nur eine andere Frau empfing den priesterlichen Beistand des Kaplans. Die übrigen Patientinnen kritisierten sein zerknittertes Chorhemd, spekulierten darüber, warum er sich nicht eines aus Nylon oder Polyester zulegte, und kramten Fälle aus ihrem Gedächtnis, wo ihre Gemeindepfarrer Paaren die kirchliche Trauung verweigert hatten oder kleine Säuglinge nicht taufen wollten, nur weil ihre Eltern keine Kirchgänger waren, und andere Beispiele störrischen und unchristlichen Verhaltens.