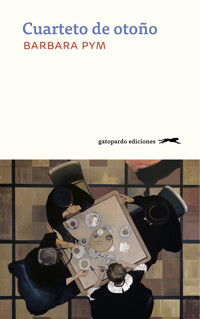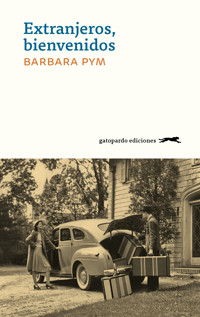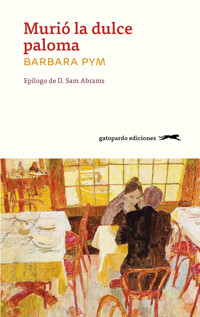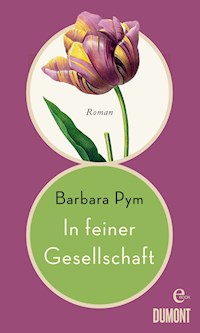
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dulcie Mainwaring ist stets zur Hilfe, wenn andere sie brauchen − um ihre eigenen Bedürfnisse kümmert sie sich dagegen kaum. Die Verzweiflung nach dem unrühmlichen Abgang ihres Verlobten erträgt sie still und bewahrt, wie gewohnt, Contenance. Allein die Aussicht auf den Besuch einer wissenschaftlichen Konferenz erhellt Dulcies Gemüt. Denn lässt sich eine bessere Ablenkung von Liebeskummer denken als ein Haufen älterer Akademiker, deren Gespräche sich um wissenschaftliche Spitzfindigkeiten drehen? Auf der Tagung lernt sie nicht nur die Femme fatale Viola Stint kennen, sondern auch deren Schwarm Aylwin Forbes. Der Herausgeber einer Literaturzeitschrift ist überaus attraktiv, aber ein Aufschneider. Er ist egoistisch, unzuverlässig – und unwiderstehlich. So kommt es, dass Dulcie dem charmanten Akademiker nachzustellen beginnt. Aber drei sind einer zu viel; und die Anreise von Dulcies achtzehnjähriger Nichte Laurel kompliziert die Situation nur noch weiter – ist es doch ausgerechnet Laurel, auf die Aylwin ein Auge wirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dulcie Mainwaring ist stets zur Hilfe, wenn andere sie brauchen – um sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse kümmert sie sich dagegen kaum. Die Verzweiflung nach dem unrühmlichen Abgang ihres Verlobten erträgt sie still und bewahrt, wie gewohnt, Contenance. Allein die Aussicht auf den Besuch einer wissenschaftlichen Konferenz erhellt Dulcies Gemüt. Denn lässt sich eine bessere Ablenkung von Liebeskummer denken als ein Haufen Akademiker – zumeist vorgerückten Alters –, deren Gespräche sich um wissenschaftliche Spitzfindigkeiten drehen, die dem Rest der Welt herzlich egal sind? Auf der Tagung lernt sie nicht nur die exaltierte Femme fatale Viola Stint kennen, sondern auch deren Schwarm Aylwin Forbes. Der Herausgeber einer Literaturzeitschrift ist überaus attraktiv, aber ein Aufschneider. Er ist egoistisch, unzuverlässig – und unwiderstehlich. So kommt es, dass Dulcie ebenfalls eine Faszination für den charmanten Akademiker entwickelt und ihm nachzustellen beginnt. Aber drei sind einer zu viel; und die Anreise von Dulcies achtzehnjähriger Nichte Laurel kompliziert die Situation nur noch weiter – ist es doch ausgerechnet Laurel, auf die Aylwin ein Auge wirft.
Mayotte Magnus © The Barbara Pym Society
Barbara Pym
geboren 1913 in Oswestry, gestorben 1980 in Finstock, studierte Literatur in Oxford und arbeitete als Assistant Editor im African Institute in London. Mit sechzehn Jahren schrieb sie den ersten von insgesamt dreizehn Romanen. Ihr Werk ›Quartett im Herbst‹ wurde 1977 für den Booker Prize nominiert. Am bekanntesten ist sie für ihren Sittenroman ›Vortreffliche Frauen‹, der 2019 in einer Neuübersetzung bei DuMont erschien.
Sabine Roth
ist seit 1991 als Übersetzerin tätig. Zu den von ihr übersetzten Autorinnen und Autoren gehören Jane Austen, Henry James, Agatha Christie, John le Carré, V.S. Naipaul, Elisabeth Strout und Lily King.
Barbara Pym
In feinerGesellschaft
Roman
Aus dem Englischenvon Sabine Roth
Die englische Originalausgabe erschien 1961 unter dem Titel
›No Fond Return of Love‹
bei Jonathan Cape Limited, London.
© Copyright Barbara Pym 1961
eBook2020
© 2020 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Sabine Roth
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © akg-images, Berlin
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7044-8
www.dumont-buchverlag.de
1. Kapitel
Es gibt verschiedene Arten, gegen ein gebrochenes Herz vorzugehen, aber der Besuch einer Fachtagung dürfte eine der unüblicheren sein.
Als Dulcie Mainwarings Verlobter damit herausrückte, dass er sie lieber doch nicht heiraten wollte – oder, wie er es ausdrückte, dass er ihrer Liebe nicht würdig sei –, konnte sie sich monatelang zu gar nichts aufraffen, sondern litt nur still vor sich hin. Zu der Tagung meldete sie sich deshalb an, weil sie ihr genau das zu bieten schien, was man Frauen in ihrer Situation immer anriet: eine Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich durch die Beobachtung anderer von sich selbst abzulenken, wenn auch nur für ein Wochenende und unter fragwürdigen Umständen.
Denn was konnte absonderlicher sein als ein Haufen erwachsener Leute, die meisten davon mittleren oder sogar vorgerückten Alters, in einem Mädcheninternat in Derbyshire, wo sie über akademische Spitzfindigkeiten debattierten, die dem Rest der Welt herzlich egal waren? Selbst die Zimmer – wenigstens pferchte man sie nicht in Schlafsälen zusammen! – muteten unnormal an mit den beiden schmalen eisernen Bettgestellen und der Aussicht auf solch enge Tuchfühlung mit fremden Schlafgenossen.
Dulcie spekulierte darüber, wer ihr wohl zugeteilt war, und sah ihrer Ankunft – denn sicher würde es doch eine Frau sein? – etwas bange entgegen. Aber zumindest war es spannend, sagte sie sich tapfer, das Zimmer mit einer Unbekannten zu teilen, und als auf dem Flur Schritte erklangen, wappnete sie sich und überlegte schon, was sie zueinander sagen würden, wenn die Tür aufging. Aber die Schritte machten nicht an Dulcies Tür halt, sondern erst ein Stück weiter. Dann, auf den zweiten Blick, fand sie das andere Bett doch verdächtig flach, und als sie den Überwurf anhob, sah sie, dass es gar nicht hergerichtet war. Sie war erleichtert und enttäuscht zugleich. Wenn sie genügend Mut aufgebracht hatte, würde sie an die Nachbartür klopfen und nachsehen, wer dort wohnte.
Sie hätte niemals hierherkommen dürfen. Das wurde Viola Stint klar, kaum dass sie den kleinen, zellenartigen Raum betreten hatte, und ihr Unbehagen steigerte sich fast zu Panik, als ihr Blick auf das zweite Bett fiel, das wie ihr eigenes mit einem weißen Überwurf mit Waffelmuster bedeckt war. Dann würde sie diese elende Kammer also auch noch mit einer fremden Person teilen müssen – der Gedanke war zu grauenvoll! Mit spitzen Fingern schlug sie einen Zipfel des Überwurfs zurück, um zu schauen, ob das Bett hergerichtet war; glücklicherweise nicht, nur ein Kissen mit gestreiftem Drillichbezug und ein Stapel grauer Decken lagen da. Das hieß, sie war wenigstens allein hier drin, und für drei Nächte ließ sich das vielleicht zur Not überstehen.
Sie zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich aus dem Fenster. Unter sich sah sie ein Beet voll prächtig blühender Dahlien, üppig tragende Apfel- und Birnbäume, und dahinter erstreckte sich Moorland bis zu den fernen Hügeln, wo die Außenwelt begann, die Freiheit.
Ein leises Klopfen ließ Viola herumfahren; ihr »Herein« fiel recht scharf aus. In der Tür stand eine aschblonde Frau Anfang dreißig, recht groß und mit freundlichem Gesicht. Sie trug ein Tweedkostüm und Straßenschuhe, die zu schwer für ihre dünnen Beine wirkten.
Ganz die biedere englische alte Jungfer, dachte Viola, froh darüber, dass sie selbst einen so anderen »Akzent« setzte mit ihrem schwarzen Kleid, dem blassen, fast schon abgezehrten Gesicht und den widerspenstigen dunklen Haaren.
»Dulcie Mainwaring«, sagte die aschblonde Frau. »Ich habe das Zimmer neben Ihrem. Ich dachte, vielleicht können wir ja gemeinsam zum Essen hinuntergehen?«
»Wenn Sie wollen«, sagte Viola ungnädig. »Ich heiße Viola Stint. Wie benimmt man sich hier, und was zieht man an?«
»Das scheint niemand so richtig zu wissen«, sagte Dulcie. »Mir kommt es ein bisschen so vor wie am ersten Abend auf einem Schiff, wo sich keiner zum Essen umzieht. Soviel ich weiß, ist das die erste Tagung dieser Art, die hier abgehalten wird. Sonst kommen wohl eher religiöse Gruppierungen her und auch die schreibende Zunft. Obwohl – zu der gehören wir ja selbst, oder?«
»Könnte man so sagen.« Viola hatte ihren Lippenstift gezückt und trug ihn mit Verve auf, offenbar wild entschlossen, so wenig wie eine Dienstleisterin an den staubigeren Rändern der akademischen Welt auszusehen wie nur irgend möglich.
Dulcie betrachtete mit einiger Faszination das Ergebnis, aber das grelle Korallenrot in dem fahlen Gesicht wirkte auf jeden Fall ungewöhnlich und frappant und ließ sie ein wenig mit ihrem eigenen sorgfältig aufgetragenen »natürlichen« Make-up hadern.
»Eine sonderbare Idee, für unsereins eine Tagung zu veranstalten«, sagte sie. »Plagen wir alle uns mit Fahnenlesen, Registern und Bibliografien und was es noch gibt an drögen, undankbaren Zuarbeiten für Menschen, die mehr zu sagen haben als wir?«
Viola schien es, als würde sie sie fast genießerisch bei den Worten verweilen, wie um mit aller Gewalt den Eindruck unüberbietbarer Tristheit zu erwecken.
»Also mein Leben ist überhaupt nicht so«, sagte sie eilig. »Ich habe eigene Forschungsprojekte, und einen Roman habe ich auch angefangen. Hier bin ich eigentlich nur, weil ich einen der Referenten kenne, und …«
Sie hielt inne, aufs Neue überwältigt von einem Gefühl der Panik, denn bestimmt war es ein Fehler gewesen, zu kommen. Nun, dieser tüchtigen Miss Mainwaring, die exakt so wirkte, als verrichtete sie sämtliche der öden Tätigkeiten, die sie da eben beschrieben hatte, würde sie ihr Herz ganz gewiss nicht ausschütten.
»Ich mache nur Stichwortregister und was sonst noch so anfällt«, sagte Dulcie fröhlich. »Ich wollte gern von zu Hause aus arbeiten, als meine Mutter krank wurde, und seit ihrem Tod bin ich noch nicht dazu gekommen, mich nach einer Ganztagsstelle umzutun.«
Eine Glocke begann zu schlagen, was die Bedrückung, die Viola bei Dulcies Worten befiel, noch verstärkte.
»Zeit zum Abendessen«, sagte sie. »Wollen wir?« Früher oder später, dachte sie, würde sich schon eine Möglichkeit bieten, die Frau loszuwerden.
Aylwin Forbes nahm die Flasche Gin aus dem Koffer, wo sie, eingebettet in die Falten seines Schlafanzugs, unbeschadet von London in dieses abgelegene Dorf in Derbyshire gereist war. Er stellte sie probeweise auf den Frisiertisch, aber zwischen seinen Hefetabletten, dem Magenpulver und dem Haarwasser nahm sie sich irgendwie ungehörig aus, weshalb sie, in Ermangelung von Alternativen, doch im Kleiderschrank landete – diesem bewährten, wenn auch leicht ehrenrührigen Versteck aller Flaschen.
Sein anderes wichtiges Stück Gepäck, das Skript für seinen Vortrag über »Häufige Probleme eines Herausgebers«, deponierte er auf dem Stuhl neben dem Bett.
Dann entdeckte er, dass es doch noch ein Schränkchen gab, an der Wand über dem Waschbecken, also holte er den Gin wieder aus dem Kleiderschrank und räumte ihn dort hinein. Ein neuer Gedanke beschlich ihn: War dem Personal denn zu trauen? Vor seinem inneren Auge sah er eines der Hausmädchen, wie sie den Flachmann ansetzte und sich beim Bettenmachen einen raschen Schluck gönnte. Nun, dieses Risiko würde er eingehen müssen, entschied er und stellte die Hefetabletten und das Magenpulver auch hinein, aber er kam zu keinem rechten Schluss, wo er am ehesten das Haarwasser benutzen würde, darum blieb es auf dem Frisiertisch. Als Nächstes nahm er sein Skript von dem Stuhl am Bett und legte es neben seine Bürsten und die Manschettenknöpfe in dem Etui aus florentinischem Leder.
Damit blieben in seinem Koffer nur noch die jüngste Ausgabe der Literaturzeitschrift, deren Herausgeber er war, und der große Bilderrahmen – ebenfalls aus florentinischem Leder – mit der Fotografie seiner Frau Marjorie. Die Zeitschrift legte er auf den Stuhl beim Bett, mit einem leichten Widerwillen, als sähe er sich schon im Bett liegen und darin lesen, aber für Marjorie bot sich kein Platz an, also packte er das Bild zurück in den Koffer, klappte ihn zu und schob ihn unters Bett. Wozu es jetzt noch aufstellen?
Vorsichtig öffnete er die Tür und spähte den langen Flur entlang. Wo wohl die Toilette sein mochte? Er riskierte sogar ein paar tastende Schritte in eine Richtung, da erblickte er eine ältere Frau mit Kneifer, Haarnetz und einem Steppbademantel mit einem Muster aus großen roten Blumen, die, Handtuch und Waschbeutel unterm Arm, zielstrebig auf ihn zuhielt. Wo immer er hingewollt hatte, sie würde vor ihm dort sein. Hastig floh er in sein Zimmer zurück, zutiefst aufgewühlt. War man denn nicht einmal nach Geschlechtern getrennt in diesem Haus?
Die Schritte der Frau tappten vorbei und schienen vor der Nachbartür haltzumachen. Und zu spät wurde ihm klar, dass das Miss Faith Randall war, eine seiner Mit-Referentinnen. Im Geist sah er den Titel des Vortrags, den sie halten würde – »Häufige Probleme bei der Registererstellung«. Würde sich jeder Vortrag mit häufigen Problemen bei diesem oder jenem befassen?, fragte er sich, während er sich erneut auf den Flur begab, um einiges forscher diesmal.
Wieder in seinem Zimmer, goss er sich etwas Gin in sein Zahnputzglas, ließ Wasser aus dem Hahn hineinlaufen und trank es in hastigen Schlucken, als wäre es eine Medizin – was es in gewissem Sinne ja auch war. Ich muss hinunter zum Essen gehen, dachte er, aufatmend bei dem Gedanken, dass die Referenten ja ihren eigenen Tisch haben würden, getrennt von den anderen Teilnehmern. Er stellte sich Miss Randall mit ihrem Haarnetz und Kneifer vor und fragte sich, ob er wohl neben ihr zu sitzen käme und worüber sie dann reden sollten. Register, die die Welt bedeuten? Abtreibung, Alpenglühen, Apostroph – Ehebruch, Eisbein, Embryo – na, wohl bekomm’s! Vielleicht hatte er den Gin doch etwas arg schnell getrunken.
»Wer ist der gutaussehende Mann da?«, flüsterte Dulcie Viola zu, als sie im Vorraum darauf warteten, dass der Gong sie zu Tisch rief.
»Gutaussehender Mann – wo?« Viola hatte versunken die übrigen Tagungsteilnehmer betrachtet, die zum Großteil alles andere als gut aussahen. Im Gegenteil, ihr drängte sich die Frage auf, ob überhaupt eine Tagung dazu angetan sein könnte, gutaussehende Menschen zu versammeln, wenn es nicht gerade eine Schauspieler- oder Filmstar-Tagung war. Aber sobald Dulcie sprach, wusste sie natürlich, wer es sein musste, und war verstimmt und gleichsam enttäuscht von sich selbst, dass sie seine Nähe nicht auf irgendeine magische Weise gespürt hatte.
Sie blickte auf und sah das blonde Löwenhaupt, die wohlgeformte Nase und die dunklen Augen, eine solche Seltenheit bei blondem Haar.
»Das ist Aylwin Forbes«, sagte sie.
»Ah, ja. ›Häufige Probleme eines Herausgebers‹«, zitierte Dulcie. »Er sieht aus, als könnte er noch andere Probleme haben – weil er so attraktiv ist, meine ich. Was gibt er noch mal heraus? Ich komme gerade nicht drauf. Und weiß er, mit was für Problemen wir kämpfen?«
Viola nannte die Zeitschrift, deren Herausgeber Aylwin Forbes war. »Ich kenne ihn zufällig recht gut«, fügte sie hinzu.
»Ach ja?«
»Er und ich waren einmal …« Viola zögerte, zupfte die Fransen ihrer schwarz-silbernen Stola zurecht.
»Verstehe«, sagte Dulcie, die natürlich gar nichts verstand. Was mochten sie einmal gewesen sein? Ein Paar? Kollegen? Herausgeber und wissenschaftliche Mitarbeiterin? Oder hatte er sie lediglich eines Frühlingsnachmittags in einer staubigen Bibliothek in seine Arme gerissen, in einem schwer einsehbaren Winkel neben dem Schlagwortkatalog? Unmöglich, dies Violas diskreter Andeutung zu entnehmen. Wie lästig sie manchmal sein konnte, diese weibliche Delikatesse!
»Ist er verheiratet?«, forschte sie beherzt weiter.
»Oh, sicher – mehr oder weniger«, sagte Viola ungeduldig.
Dulcie nickte. Die Leute waren meistens verheiratet, und wie oft waren sie es »mehr oder weniger«.
Aylwin Forbes kam jetzt zu ihnen herüber.
»Ach, grüß Sie, Vi! Ich habe mich schon gefragt, ob Sie auch hier sind«, sagte er in einem humorigen Ton, der klang, als hätte er ihn sich eigens für den Anlass zugelegt.
»Grüß Sie, Aylwin«, sagte Viola, gehemmt durch Dulcies Gegenwart und verärgert, dass er das Vi »Vei« aussprach. Sie wurde nicht gern daran erinnert, dass ihr Taufname Violet war – eine leicht fehlgeschlagene Hommage ihres Vaters an Wordsworth: »Ein Veilchen hinter moos’gem Stein, dem Auge halb versteckt.« Er hatte es für eine so poetische Anspielung gehalten, ohne sich klarzumachen, dass der Name Violet bei den wenigsten diese Zeilen heraufbeschwor. Mit siebzehn hatte sie sich in Viola umbenannt.
»Ich habe schon gesehen, dass Sie uns mit einem Vortrag beglücken werden«, fuhr Viola fort. »Dann laufen wir uns ja sicher später über den Weg.«
»Ja, und dann müssen wir einen ausgiebigen Schwatz halten«, sagte Aylwin, aber in dem Moment ertönte der Gong, und die Menge drängte in den Speisesaal, zuvorderst ein alter Mann mit weißem Bart.
Der Saal war groß und bot weit mehr Essern Platz, als an den beiden langen Tischen versammelt waren. Für die Organisatoren und Referenten war ein kleinerer Tisch ein Stück abseits reserviert, und Aylwin steuerte rasch darauf zu, heilfroh, den beiden Frauen zu entkommen. Er machte einen etwas mauen Witz über die Böcke, die jetzt von den Schafen getrennt würden – zumindest das schuldete er ihnen, schien ihm –, und nahm zwischen zwei harmlos aussehenden älteren Herren Platz, der eine, wie er jetzt erkannte, ein Fachkollege, der über die Schrecken und Triumphe korrekten Bibliografierens referieren würde.
Dulcie und Viola fanden sich am Ende eines der langen Tische wieder, an dem eine stattliche, gutgelaunte Frau gerade damit anfing, aus einer großen Terrine Suppe zu schöpfen. Sie ging mit Gusto ans Werk, tauchte die Kelle in die dampfende, stark duftende Brühe wie eine mittelalterliche Nonne, die die versammelten Bettler des Kirchspiels speist.
»Wir hier unten sind anscheinend für die Essensausgabe zuständig«, sagte sie in lautem, leutseligem Ton. »Sind Sie so gut und reichen mir die Teller?«
Dulcie und Viola gehorchten, und die Mahlzeit begann. Nach der Suppe wurden eine Platte mit aufgeschnittenem Braten und mehrere Schüsseln mit Gemüse aufgetragen, die sie mit vereinten Kräften verteilten.
»Und was machen Sie genau?«, fragte Dulcie Viola ohne viele Umschweife. »Erstellen Sie Register, oder redigieren Sie für eine Zeitschrift, oder was machen Sie?«
Viola zögerte, ehe sie antwortete: »Ich habe meine eigenen Recherchen betrieben. Ich war an der London University zur Promotion eingeschrieben, aber meine Gesundheit hat leider nicht mitgespielt. Wie der Zufall es wollte«, setzte sie beiläufig hinzu, »habe ich eine Zeit lang Aylwin Forbes zugearbeitet.«
»Das war sicher spannend.«
»O ja, es war eine äußerst stimulierende Erfahrung«, sagte Viola mit vorwurfsvollem Unterton. »Er ist wirklich brillant, wissen Sie.«
»Ja, und so gutaussehend«, sagte die Frau, die die Suppe verteilt hatte. »Ich finde immer, das hilft.«
Dulcie betrachtete sie neugierig. Alle Tagungsteilnehmer waren gebeten worden, Namensschilder zu tragen, und so bemerkte sie nun neben einer großen, feingeschnitzten Kamee, die Leda und den Schwan zeigte, ein rundes Pappschildchen, auf dem in Blockschrift »JESSICA FOY« stand. Den Namen erkannte sie – Miss Foy war die Bibliothekarin einer bedeutenden Wissenschaftsgesellschaft –, und die Diskrepanz zwischen solchem Renommee und dieser launigen Person mit der Schöpfkelle ließ Dulcie innerlich leicht zurückweichen.
»Einem so gutaussehenden Mann zuarbeiten zu dürfen«, führte Miss Foy aus. »Ein beneidenswertes Los. Was war Ihr Thema?«
»Ach, nur ein weniger bekannter Dichter des achtzehnten Jahrhunderts«, sagte Viola rasch.
»Da hatten Sie aber Glück, einen so wenig bekannten aufzutun, dass nicht mal die Amerikaner ihn schon abgegrast haben«, kommentierte Miss Foy trocken. »Das ist ein anerkanntes Problem, dieser Engpass bei unbekannten Dichtern.«
»Vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, an dem es salonfähig wird, über das Leben ganz normaler Menschen zu recherchieren«, sagte Dulcie. »Menschen, die keinerlei Anspruch auf Berühmtheit jeglicher Art erheben können.«
»Das möchte ich erleben!«, sagte Miss Foy jovial.
»Ich finde einfach gern Dinge über andere Leute heraus«, sagte Dulcie. »Wahrscheinlich kompensiere ich dadurch die graue Alltagsmonotonie ein bisschen.«
Viola starrte sie an. Dass es Frauen gab, die ohne Not eine Schwäche wie das Bedürfnis nach Kompensation eingestanden!
»Sie könnten heiraten«, sagte sie zweifelnd; sie dachte an die dünnen Beine mit den schweren Schuhen daran.
»Stimmt«, räumte Dulcie ein, »das könnte ich, aber selbst wenn ich verheiratet wäre, glaube ich nicht, dass das an meinem Wesen groß etwas ändern würde.«
»Sie sind nicht bereit, sich von einem Mann formen zu lassen«, äußerte Miss Foy in befriedigtem Ton, »genauso wenig wie ich.«
Dulcie wandte sich ab, um ihr Lächeln zu verbergen.
Viola schaute etwas pikiert drein – fast, dachte Dulcie, als hätte sie für ihren Teil nichts gegen einen Mann, der sie ein wenig formte. Aber die Option ergab sich natürlich nicht immer. Manchmal war es genau umgekehrt. Maurice, Dulcies Ex-Verlobter, hätte nicht das Zeug dazu gehabt, irgendjemanden zu formen, denn nicht nur besaß er eine eher schwache Persönlichkeit (konnte sie dem mittlerweile ins Auge sehen?), er war auch noch drei Jahre jünger als sie.
»Vielleicht sind die Leben anderer eine Art Zuflucht«, mutmaßte sie. »Sie haben eine Harmlosigkeit, die man genießt.«
»Aber sie sind gar nicht immer so harmlos«, sagte Miss Foy.
»Nein, und dann ertappt man sich dabei, dass man auf dieses fremde Unglück oder die fremden Abgründe mit innerem Abstand blickt, und das ist an sich schon erschreckend.«
Miss Foys Lachen klang reserviert. »Ob sich hier wohl ein geeignetes Objekt für Sie findet?«
»Wahrscheinlich eher nicht. Das Angebot ist zu groß, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ja. Zu viele Exzentriker«, sagte Miss Foy, während sie sich gleichzeitig klarmachte, dass nichts im Leben sie so beglückte wie ein vertrackter bibliografischer Eintrag oder ein schwer zu klassifizierendes Schlagwort. »Ah, da kommt der Nachtisch. Soll ich ihn austeilen oder möchten Sie?«
»Oh, machen Sie’s lieber«, sagte Dulcie. »Ich bin nicht besonders gut im Abmessen.« Sie spürte instinktiv, dass die Erfüllung dieser simplen Aufgabe ein tiefwurzelndes Bedürfnis in Miss Foy befriedigen würde, das über schiere Kontrollsucht weit hinausging.
Am Ende des Mahls wurden die Tische abgeräumt; offenbar durfte niemand gehen, ohne etwas hinauszutragen, und sei es nur ein Kännchen Vanillesoße oder eine unbenutzte Gabel. Im Anschluss ging es hinüber in die Aula, wo das Programm für das Wochenende vorgestellt wurde. Für den heutigen ersten Abend, hieß es, sei kein Vortrag oder Fachgespräch vorgesehen, sondern ein geselliges Beisammensein, damit die Teilnehmer einander besser kennenlernten. Für Kaffee sei gesorgt.
Viola hörte es mit Schaudern, denn sie war kein geselliger Mensch. Wenn sie nicht mit Aylwin Forbes reden konnte, wollte sie lieber ins Bett gehen und lesen, aber der Gedanke an die klösterliche kleine Zelle war nicht einladend, und so folgte sie den anderen in einen mit kleinen Sesseln vollgestellten Gemeinschaftsraum, der erfüllt war von Kaffeegeruch und dem Klimpern vieler kleiner Löffel.
»Eine Tasse Kaffee, darauf freue ich mich jetzt«, sagte Dulcie.
Exakt so hatte sie Dulcie eingeschätzt, dachte Viola angewidert: als eine Person, die sich freut, mit einem Haufen kauziger Gestalten minderwertigen Kaffee zu trinken! Sie war einer dieser Gutmenschen, das merkte man gleich, jemand, der sich mit sogenannten »besten Absichten« in fremde Angelegenheiten einmischte. Viola nahm sich vor, sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit abzuschütteln. Zu dumm, dass ihre Zimmer nebeneinanderlagen. Vielleicht konnte sie ja fragen, ob nicht ein anderes Zimmer frei war, aber das schien denn doch etwas viel Aufwand für ein Wochenende. Außerdem wusste sie nicht, wen sie hätte fragen sollen.
Am anderen Ende des Gemeinschaftsraums war eine Glastür, die in eine Art Wintergarten zu führen schien. Viola schaffte es, beim Anstehen für den Kaffee von Dulcie getrennt zu werden und durch die Tür zu schlüpfen – unbemerkt, hoffte sie.
Es handelte sich tatsächlich um einen Wintergarten, mit Topfpalmen und einem knotigen Weinstock, der sich oben an der Decke zu dicht belaubten Ästen verzweigte. Viola setzte sich in einen Korbsessel und sah hinauf in das Blättermeer, aus dem einzelne Dolden blauer Trauben hingen. Welche Wohltat es war, von all den grässlichen Leuten wegzukommen. Was hatte sie geritten, zu dieser Tagung zu fahren? Sie schloss die Augen, halb kalkuliert, und malte sich aus, jemand würde hereinkommen und sie finden. Aber Aylwin Forbes, der vom Gemeinschaftsraum aus durch das Glas spähte, machte bei ihrem Anblick hastig kehrt und stürzte sich in eine angeregte Unterhaltung mit Miss Foy und Miss Randall über gemeinsame Bekannte in der Gelehrtenwelt. Zu guter Letzt waren es die Stimmen von Dulcie und zwei anderen Frauen, die Violas Einsamkeit ein Ende setzten. »Schauen Sie, was für ein reizender Wintergarten, sogar mit einem echten Weinstock. Und Trauben, wie hübsch! Dürfen wir uns zu Ihnen gesellen?«
»Aber sicher«, sagte Viola kalt. »Hier hat jeder Zutritt.«
Und so endete der Abend damit, dass Dulcie, Viola und zwei Frauen in geblümten Reyonkleidern auf Korbsesseln zusammensaßen, sich gegenseitig Zigaretten anboten und Mutmaßungen über die Härte ihrer Betten anstellten. Nicht lange, und das Gespräch tröpfelte aus, und Dulcie und Viola kehrten in ihre benachbarten Zimmer zurück.
Vor dem Einschlafen dachte Dulcie an das große Haus am Stadtrand, in dem sie früher mit Eltern und Schwester gelebt hatte und das sie seit dem Tod ihrer Eltern und der Heirat ihrer Schwester allein bewohnte. Vor ihrem Schlafzimmerfenster wuchs ein Birnbaum, an dem die Birnen jetzt reif wurden; sie sah sie vor sich, Blätter und Früchte, jede Farbe und jedes Detail in präraffaelitischer Vollendung. Den September mochte sie von allen Monaten am liebsten – wenn der Garten voller Dahlien und Zinnien war, wenn die Königin-Viktoria-Pflaumen eingemacht sein wollten, Äpfel und Birnen »verarztet«, Fallobst aufgeklaubt und sortiert. Es war ein gutes Obstjahr gewesen, sie würde alle Hände voll zu tun haben. Das Haus war groß, eigentlich zu groß, doch schon bald würde ihre Nichte Laurel – die Tochter ihrer Schwester – in London ihre Sekretärinnenausbildung beginnen und bei ihr einziehen. Dulcie freute sich schon darauf, ihr Zimmer einzurichten. Ihr hätte es gefallen, noch mehr Leben im Haus zu haben; vielleicht könnte sie ja sogar Zimmer vermieten. Es gab so viele einsame Menschen auf der Welt. Hier schlugen Dulcies Gedanken eine neue Richtung ein und schweiften zu den Dingen im Leben, die sie bedrückten – Bettler, all die verarmten Damen von Stand, afrikanische Studenten, denen man die Türen vor der Nase zuschlug, Menschen, die zu Unrecht in die Nervenklinik gesperrt wurden …
Es musste um einiges später sein – denn ihr war bewusst, dass sie wach wurde –, als es an ihre Tür klopfte.
»Wer ist da?«, rief sie, eher neugierig als erschrocken.
Eine Gestalt erschien im Türrahmen – wie Lady Macbeth, dachte Dulcie unsinnigerweise. Es war Viola; die dunklen Haarsträhnen fielen lose auf ihre Schultern, ihr Negligé schimmerte fahl in dem schwachen Licht. Dulcie sah, dass es aus fliederfarbenem Satin war.
»Entschuldigen Sie, ich habe Sie sicher geweckt«, sagte Viola. »Aber ich konnte nicht schlafen. Es ist schrecklich, aber ich glaube, ich habe meine Schlaftabletten vergessen. Ich kann mir das gar nicht erklären, ich gehe nie ohne sie irgendwohin …« Sie klang verzweifelt, den Tränen nahe.
»Ich müsste irgendwo noch Rennies haben.« Dulcie setzte sich im Bett auf.
»Ich habe es nicht am Magen«, sagte Viola unwirsch, empört über Dulcies Unterstellung, ihre Schlaflosigkeit könnte von etwas so Profanem wie Sodbrennen herrühren.
»Ich kann ja immer gut einschlafen, wenn ich ein schönes, entspannendes Buch lese«, sagte Dulcie hilfsbereit. »Oder grämen Sie sich über irgendetwas? Ich glaube ja fast, das muss es sein. Ist es wegen Aylwin Forbes?«, fragte sie voller Mitgefühl.
»Ja, wahrscheinlich.« Viola ließ sich auf dem Bettrand nieder.
»Lieben Sie ihn, oder was ist es?« Dulcie wählte ihre Worte vielleicht etwas plump, aber es war schließlich auch mitten in der Nacht.
»Ich weiß selbst nicht so recht. Seine Frau hat ihn verlassen, wissen Sie, sie ist zurück zu ihrer Mutter gegangen, und ich hätte gedacht, so wie die Dinge jetzt stehen, müsste er doch eigentlich … na ja … bei mir ansuchen.«
»Bei Ihnen ansuchen? Ach so, um Trost, meinen Sie?«
»Wir haben zusammengearbeitet – wir waren so enge Freunde, da dachte ich natürlich …«
»Vielleicht ist es für ihn einfach noch zu früh – um bei irgendjemandem anzusuchen, meine ich.«
»Aber um Trost – da gäbe es doch so viele Wege. Ich würde zu gern etwas für ihn tun.«
»Natürlich, so sind wir Frauen – wir genießen kaum etwas so sehr wie dieses Gefühl, gebraucht zu werden und Gutes zu tun.«
»Die Frage ist nicht, ob ich etwas genieße«, sagte Viola scharf. »Mir geht es um ihn.«
Dulcie hätte es interessiert, warum seine Frau ausgezogen war – hatte er sie dazu getrieben? –, aber für derartige Fragen schien es ihr zu früh. So wie Viola darüber sprach, musste man annehmen, Aylwin Forbes sei der Leidtragende bei der Sache.
»Vielleicht sitzt sein Kummer einfach zu tief«, schlug sie vor.
»Aber zur Tagung konnte er ja auch fahren.«
»Ja, um sich abzulenken. Und dafür ist sie ja vielleicht auch gut.«
»Aber ich habe das Gefühl, er weicht mir aus«, fuhr Viola fort. »Er hat sich regelrecht gewunden, als wir uns vor dem Essen getroffen haben, ist Ihnen das nicht aufgefallen?«
»Gut, der Gong war fast sofort zu hören, und alle haben in den Speisesaal gedrängt. Das wäre für niemanden ganz einfach gewesen.«
»Und hinterher, als ich allein im Wintergarten saß« – es klang, als würde Viola laut denken –, »da schien es mir, als würde er durch die Glastür schauen und käme nicht herein, weil er mich dort gesehen hatte.«
»Vielleicht dachte er, dass es zugig sein würde oder dass Sie nicht gestört werden wollten«, meinte Dulcie, deren Beteuerungen zunehmend kraftloser ausfielen, je mehr der Schlaf sie zu übermannen drohte. »Morgen früh sieht bestimmt alles schon ganz anders aus«, versicherte sie – der letzte Ausweg aller Feiglinge. »Meinen Sie, Sie können jetzt schlafen?«
Was für ein Jammer, dass wir keine Ovomaltine dahaben, war ihr letzter bewusster Gedanke. Auf so viele Probleme des Lebens ist heiße Milch eine Antwort.
2. Kapitel
Am nächsten Morgen drang durch Dulcies Tür das Trappeln so vieler Füße, als wäre ein Feuer ausgebrochen, vor dem alle flohen. Sie brauchte ein Weilchen, um zu begreifen, dass hinter der Massenprozession nichts Alarmierenderes steckte als frühmorgendlicher Teedurst. All diese Leute, deren Geist für gewöhnlich mit höheren Dingen beschäftigt war, erwiesen sich hier doch als menschlich.
Dulcie stieg aus dem Bett, zog ihren Morgenrock über und kämmte sich. Sie beschloss, eine Tasse für Viola mitzunehmen, die in ihrem aufgewühlten Zustand sicher schlecht geschlafen hatte.
Aylwin Forbes lag in seinem Bett und lauschte dem Klimpern von Löffeln auf Untertassen. Ihm hatte vorgeschwebt, ihm als einem der Referenten würde eine Hausangestellte – möglicherweise sogar in Häubchen und Schürze – seinen Tee zu gebotener Zeit auf einem Tablett bringen. Nicht vorbereitet war er auf den Anblick Miss Randalls, die mit Haarnetz, Kneifer und dem geblümten Steppbademantel, den er schon kannte, in seiner Tür erschien, in der Hand einen Becher mit Untertasse.
»Sie Glücklicher, dürfen im Bett liegen bleiben und sich von uns Frauen bedienen lassen«, sagte sie in einem für sie untypisch neckischen Ton, vielleicht, weil es sie befangen machte, ihn so zerzaust und im Pyjama zu sehen. »Zucker ist auf der Untertasse – ich wusste nicht, ob Sie welchen möchten.«
Sie stellte den Tee auf dem Nachttisch ab und schlich schwerfällig zur Tür.
»Vielen Dank!«, rief er ihr nach. »Mir war nicht klar, dass man sich hier den …«, aber sie war schon weg, und im Bett liegend fühlte er sich ihr gegenüber ohnehin im Nachteil.
Er stützte sich auf einen Ellbogen, schob mit dem Löffel die zwei bräunlich-durchweichten Zuckerklümpchen an den Rand der Untertasse und trank. Der Tee schmeckte stark und bitter. Wie das Leben?, fragte er sich. Vielleicht wie das der Frauen – seiner Frau, Marjorie, oder auch das von Viola Stint, die sich mit geschlossenen Augen in dem Korbstuhl im Wintergarten zurücklehnte. »Häufige Probleme eines Herausgebers« (dachte er in Anspielung auf seinen Vortrag) schlossen nach allgemeinem Verständnis eigentlich keine Frauen mit ein. Marjorie, die nun wieder bei ihrer Mutter in dem sterilen Haus am Rand der Grünanlage saß – wie sollte er sich da verhalten? Mit Viola würde er womöglich leichter fertig; er würde einfach im Beisein Dritter ein paar nette Worte an sie richten, nicht beim Frühstück selbstredend, lieber vor oder nach einer anderen Mahlzeit, wenn man sich im Garten erging und die Kräuterbeete bewunderte.
Das Frühstück war eine recht steife Angelegenheit. So früh am Tag schlug das Gefühl, unter lauter Fremden zu sein, offenbar stärker durch. Die Unterhaltung kam nur schleppend in Gang, und das Fehlen der Sonntagszeitungen focht einige sichtlich an. Selbst Miss Foy, die erst Porridge und dann Würstchen verteilte, schien gedämpfter Stimmung.
»Aus der Pfanne«, murmelte sie, aber niemand ging darauf ein.
Als die Mahlzeit fast um war, betraten zwei Männer und eine Handvoll Frauen, alle mit Hut, den Speisesaal, auf die leicht verstohlene Art von Menschen, die früh aufgestanden sind, um in die Kirche zu gehen, und nun – in aller Demut – auf ihr wohlverdientes Morgenmahl hoffen.
Viola war bisher nicht erschienen, dabei hatte es auf Dulcie, als sie ihr den Tee gebracht hatte, so gewirkt, als würde sie aufwachen. Als sie den Gang entlang zurück zu ihrem Zimmer ging, sah sie sie in ihrem fliederfarbenen Satin-Negligé aus einem der Badezimmer kommen, die Haare unter einer blumenbedruckten Duschhaube im gleichen Farbton verborgen.
»Das Frühstück ist schon abgeräumt, fürchte ich«, sagte Dulcie.
»Frühstück?« Viola wiederholte das Wort, als wäre es ihr gänzlich unbekannt. »Dafür war ich einfach nicht in der Verfassung. Ich frühstücke sowieso nie. Diese Tasse Tee war mehr als genug.«
»Es gab Würstchen«, sagte Dulcie in einem, wie sie fand, gebührend handfesten Ton.
Viola erschauerte. »Dann bin ich umso froher, dass ich oben geblieben bin. Was steht heute Vormittag an?«
»Als Erstes der Vortrag von Aylwin Forbes« – Dulcie, die an die schmerzhaften Enthüllungen der Nacht denken musste, huschte gleichsam über den Namen hinweg –, »und danach«, mit kräftigerer Stimme nun, »gibt es einen kurzen Gottesdienst in der Kapelle, einen interkonfessionellen, den ein Laienprediger halten wird, das heißt, er wird wahrscheinlich ›mit uns‹ sagen statt ›mit euch‹.«
Viola sah sie verständnislos an, also schob Dulcie nach: »Ich meine, beim Segen et cetera. Ein Laienprediger darf nicht sagen: ›Der Herr sei mit euch‹, er muss sagen: ›mit uns‹, weil er nicht ordiniert ist.«
»Ach so, das«, sagte Viola gelangweilt.
»Ich muss bei mir noch kurz Ordnung machen«, sagte Dulcie. »Dann sehen wir uns ja sicher beim Vortrag.«
»Anzunehmen«, sagte Viola und verschwand in ihr Zimmer. Erstaunlich eigentlich, dachte sie, dass Dulcie nicht angeboten hatte, ihr einen Platz »warm zu halten«.
Dulcie, die ihre durchgelegene Matratze betrachtete, fiel es schwer, einen sonntagmorgendlichen Vortrag über ein so trockenes Thema als eine emotionale Zerreißprobe zu sehen, selbst wenn es sich um einen Vortrag von einem Mann handelte, den man liebte oder einmal geliebt hatte. Doch da mochte sie sich täuschen, schließlich hatte sie nie erfahren dürfen, welch starkes Band gemeinsames wissenschaftliches Arbeiten zwischen zwei Menschen schmieden kann. Was immer Maurice und sie verbunden hatte, das sicher nicht. »Du und deine ›Arbeit‹«, hatte er öfter gesagt, in einem liebevoll neckenden Ton, an den Dulcie in diesem Moment nicht ohne Wehmut denken konnte.
Der Vortrag fand nicht in der großen Aula statt, sondern in einer Art Foyer mit bequemen Stühlen und einem mit Sackleinen abgedeckten Flügel. Schon bald war die Luft von Zigarettenrauch geschwängert, wobei die Frauen mehr rauchten als die Männer.
Vermutlich ist das ihr einziger Lebensinhalt, dachte Aylwin Forbes, während er vor Vortragsbeginn in seinem Skript blätterte; Ehemänner hatten sie ja mehrheitlich keine.
Aber nicht lang, und er wünschte sich, das Rauchen wäre nicht erlaubt – war es das überhaupt? –, denn der Raum war grauenvoll stickig.
Er ist noch blasser als sonst, dachte Viola. Ich könnte nie einen Mann mit zu gesunder Gesichtsfarbe lieben. Dass Marjorie weg ist, hat ihn auf jeden Fall erschüttert – ihn in seinem Stolz verletzt, wenn nicht mehr. Aber jetzt muss er zusehen, dass er sein Leben neu ordnet. Für einen Mann war Alleinsein kein natürlicher Zustand. Aber war er denn allein? Wusste man wenigstens das mit Gewissheit?
Seine Zeitschrift, dachte Miss Foy, war natürlich mit einer extrem fähigen Redaktionsassistentin gesegnet. Was wusste A.F. schon von den wahren Problemen des Herausgebens? Die hielten Frauen wie sie ihm schließlich vom Hals. Trotzdem waren Vorträge aus dem eigenen Fach nie ohne Reiz, wobei sie ihn schon in besserer rednerischer Form als heute erlebt hatte.
Sie zog die nächste verbogene Filterzigarette aus einer zerknautschten Packung und zündete sie am Stummel der alten an. Danach dann Kaffee, hoffte sie doch. Den Gottesdienst würde sie sich auf jeden Fall schenken. Ein strammer Marsch über das Gelände entsprach mehr ihrer Vorstellung von Gottesverehrung, falls denn ein Gott existierte.
Dass Verfasser von Registern immer als tumbe Lohnsklaven gesehen werden!, dachte Dulcie mit einem Anflug von Ärger, während sie matt über einen alten Witz lächelte, den er eben zum Besten gegeben hatte; dabei stand und fiel so manches Buch mit seinem Register. Und Liebe und Ergebenheit waren nicht zwingend die beste Qualifikation – sie dachte an die Ehefrauen und andere Damen, die diese so oft freimütig als »undankbar« deklarierte Aufgabe auf sich nahmen. Er sieht sehr blass aus. Wenn man wie jetzt die Möglichkeit hat, ihn zu betrachten, begreift man leichter, was die Frauen an ihm finden.
Vielleicht könnte er ja darum bitten, dass ein Fenster geöffnet würde, dachte Aylwin; der Raum war wirklich unfassbar heiß. Obwohl er seinen Vortrag nicht ablas, brachte es ihn aus dem Tritt, als er merkte, dass er seine Stelle im Skript verloren hatte, und er musste kurz abbrechen; was hatte er nur als Nächstes sagen wollen? Suchend sah er ins Publikum. Viola Stint hing an seinen Lippen – anders konnte man es nicht ausdrücken; peinlich berührt wandte er die Augen ab. Miss Foys Zigarettenspitze schien sich ihm mitten ins Gesicht zu bohren, dann entschwand sie, es wurde dunkel um ihn, und von weit weg sagte eine Frauenstimme, eine sympathische Stimme: »Ihm ist nicht gut – er kippt um!«
Dulcie war zum Podium geeilt, als sie ihn nach dem Pultrand greifen und dann wanken sah, doch da hatte ihn der Tagungsleiter schon bei der Schulter gefasst und ihm einen Stuhl hingeschoben.
»Brandy!«, rief Miss Foy sehr laut und sah hoffnungsvoll um sich. Aber die Chancen, dass der Ruf in diesem Rahmen und in dieser Gesellschaft Widerhall fand, schienen gering.
»Hier ist Wasser«, sagte der Tagungsleiter und schenkte aus einer Karaffe auf dem Tisch ein Glas voll.
»Ich habe Riechsalz da«, sagte Dulcie patent. »Damit kommt er sicher gleich zu sich, und vielleicht kann ja jemand ein Fenster öffnen?«
Sie hat Riechsalz, natürlich!, dachte Viola verächtlich, während sie gleichzeitig wünschte, die zu sein, die es parat hatte.
Aylwin schlug die Augen auf. »Wo bin ich?«, fragte er, dabei wusste er sehr gut, wo er war, ihm schien nur, eine Äußerung dieser Art könnte das Malheur entschuldigen.
»Sie waren mitten in Ihrem Vortrag, und plötzlich wurden Sie … äh … unpässlich«, verkündete der Tagungsleiter feierlich.
Aylwin lächelte. »Ah, verstehe. ›Unpässlich‹«, wiederholte er mit einem amüsierten Zug um die Lippen.
Doch, er ist schön!, dachte Dulcie unvermittelt. Wie eine griechische Marmorbüste oder wie eine Skulptur, die jemand im Garten einer italienischen Villa ausgräbt, die Züge eine Spur lädiert und durch diese Unvollkommenheit umso reizvoller.
»Wie dumm von mir«, murmelte er. »Mir war plötzlich so eigentümlich zumute. Aber ich hatte auch kürzlich die Grippe.«
»Nun, kein Grund, sich zu schämen«, sagte Dulcie mit der zupackenden Munterkeit einer Krankenschwester. »Es war furchtbar heiß hier drin. Ich an Ihrer Stelle würde mich ein Weilchen in meinem Zimmer hinlegen«, fügte sie vernünftig hinzu.
»Ja.« Dankbar sah er zu ihr auf. »Vielleicht mache ich das.« Der Vortrag war fast zu Ende gewesen, und um die Viertelstunde sinnloser Fragen tat es ihm ohnehin nicht leid. Niemand konnte von ihm erwarten, dass er sich dem jetzt noch aussetzte.
»Wie schade«, klagte Miss Foy. »Ich hätte ihn so gern noch gefragt, wie … gut, vielleicht später, wenn er wieder auf dem Damm ist.«
Der Tagungsleiter stand nach wie vor auf dem Podium, unschlüssig, ob es nötig war, einen offiziellen Schlussstrich zu ziehen. Eher nicht, entschied er, denn alles, was sich nun noch sagen ließ, konnte nur abfallen gegen die dramatische Szene von eben. Er trat vom Podium herunter und sah demonstrativ auf seine Uhr.
»Noch eine halbe Stunde bis zum Gottesdienst«, sagte er zu niemandem im Besonderen, aber da er der Laienprediger war, der ihn abhalten würde, schien ihm ein kleiner Wink angezeigt. Die Mehrzahl der Frauen hatte sich um Forbes geschart, sah er, und alle empfahlen sie unterschiedliche Heilmittel und Rezepte – süßer starker Tee, strikte Bettruhe, ein abgedunkeltes Zimmer, ein flotter Gang an der frischen Luft, das waren nur einige der Vorschläge, die an sein Ohr drangen.
Seine Gedanken wandten sich dem Gottesdienst zu. Hoffentlich wirkte sich der unglückliche Zwischenfall nicht nachteilig auf die Zahl der Besucher aus. Und hoffentlich war das Harmonium brauchbar und verstand die Dame, die sich erboten hatte, es zu spielen, ihr Handwerk.
»Ich bin sowieso Anglokatholikin«, sagte Viola missmutig, als sie und Dulcie durch den Garten gingen, beide ohne ein weiteres Wort über Aylwin Forbes, der auf einer Bank saß und von Miss Foy in die Mangel genommen wurde. »Ich hätte eigentlich ganz gern irgendwo eine Messe besucht.«
»Ein paar Leute waren bei einem Kommunionsgottesdienst im Dorf«, sagte Dulcie vage. »Gilt das auch?«
»Schon, aber nach dieser miserablen Nacht hätte ich unmöglich so früh aufstehen können. Ich habe bis zum Morgengrauen kein Auge zugetan, und dann habe ich geschlafen, bis Sie mit dem Tee kamen.«
»Hoffentlich habe ich Sie nicht geweckt«, sagte Dulcie besorgt. »Ich dachte, Sie hätten vielleicht gern eine Tasse.« Das war das Fatale, wenn man helfen wollte, dachte sie; man tat so oft das Falsche.
»Irgendwann hätte ich ja doch aufwachen müssen«, war Violas höchst ungenügende Antwort auf diese Frage. »Und das mit dem Tee war ja nett von Ihnen, auch wenn es leider indischer war.«
Dulcie senkte den Kopf, und schweigend betraten sie den kleinen Kirchenraum, den die Rhododendren und anderen Büsche, die ihre Blätter gegen die Fensterscheiben drängten, mit einem grünlichen Licht erfüllten. Eine jüngere Frau bearbeitete mit einem Ausdruck grimmiger Entschlossenheit die Pedale des Harmoniums.
Das Eingangslied war, nicht sehr passend, »Ein jedes Ding erschuf der Herr«. Dulcie sang es mit lauter, entrüsteter Stimme, in Erwartung der Zeilen:
»Der reiche Mann in seinem Schloss, der Arme vor dem Tor,
Gott gab den beiden ihren Platz, sah ihre Stellung vor.«
Aber sie kamen nicht. Dann sah sie, dass die Strophe übersprungen worden war. Sie setzte sich hin, um ihre ganze Empörung betrogen.
Darauf hielt der Tagungsleiter eine kurze Predigt – des Inhalts, dass jede Tätigkeit zur Ehre Gottes verrichtet werden könne, selbst das Erstellen von Registern, das Korrekturlesen der Druckfahnen oder das Verfertigen hieb- und stichfester bibliografischer Angaben. Seine Gemeinde lauschte brav, während er, fast mit Betrübnis, darlegte, dass diejenigen, die einer solchen Arbeit nachgingen, vielleicht weniger Gelegenheit zum Sündigen hätten als die, die Romane und Theaterstücke schrieben oder für Film und Fernsehen tätig seien.
Aber befriedigender ist es, einen Boden zu scheuern oder den Garten umzugraben, dachte Dulcie. Bei solchen niedrigen Diensten fühlt man sich dem Kern der Dinge näher als beim Erstellen eines noch so perfekten Registers. Wieder wanderten ihre Gedanken zu ihrem Haus und all den Aufgaben, die dort anstanden, und sie fragte sich, warum sie überhaupt zu der Tagung gefahren war, wenn sie ihre Zeit doch auf so viel fruchtbarere Weise verbringen konnte. Erst als der Laienprediger in seine Fürbitten »einen aus unserer Schar, der nicht ganz wohlauf ist«, mit einschloss, erinnerte sie sich wieder an Aylwin Forbes und seine Schönheit – an die Höhlungen an seinen Schläfen, das flatternde Heben der Lider, als sie sich über ihn beugte. Über dem Anblick hatte sie Maurice tatsächlich einen Moment lang vergessen. Und dann war da Viola, die trotz ihrer Kratzbürstigkeit eine Persönlichkeit zu sein schien, jemand, mit dem man sich vielleicht sogar anfreunden konnte.
Vor dem Mittagessen sah sie die beiden zusammen im Wintergarten stehen, und ihr ging auf, dass sie sie ja ganz leicht wiedersehen konnte – wenn nicht durch Zufall, dann indem sie sie eines Abends zu sich zum Essen einlud. Fast stellte sie im Geist schon die Speisenfolge und eine Liste der anderen Gäste zusammen.
Aylwin hob sein Glas und nahm einen Schluck von dem kalten, dunklen Wein, der aus den verschrumpelten Trauben über ihren Köpfen hätte gekeltert sein können. Nur in einem mediterranen Klima schmeckt man die Herbheit eines solchen Weins mit glückhaftem Erschaudern, dachte er. In Derbyshire ganz bestimmt nicht.
»Meine Zeit ist eigentlich der Abend, nicht so sehr der Mittag«, sagte derweil Viola, »da bleibt auch mehr Zeit zum Reden.«
3. Kapitel
Dulcie wohnte in einem sehr hübschen Teil Londons, der, wiewohl unbestreitbar den Vororten zugehörig, doch höchst begehrt war und, in der Sprache der Immobilienmakler, »das Auffangbecken von Kensington« darstellte. »Und Harrods liefert!«, wie Dulcies Nachbarin MrsBeltane gar nicht oft genug hervorheben konnte.
Dulcie arbeitete vorwiegend daheim – eine Regelung noch aus der Zeit, als ihre Mutter gelebt und tagsüber hatte betreut werden müssen. Jetzt war sie frei, aber sie hatte Geschmack daran gefunden, sich ihre Zeit selbst einteilen zu können, und sich einen nützlichen Ruf als Korrektorin und Erstellerin von Registern aufgebaut, deren Kompetenz sogar für harmlose Recherchearbeiten im Britischen Museum oder in den Bibliotheken der Fachgesellschaften ausreichte.
Der Tag nach ihrer Rückkehr aus Derbyshire war ein strahlender Septembertag. Sie arbeitete ein Weilchen an einem Register, wusch etwas Wäsche und aß dann im Garten zu Mittag. Die Frau, die ihr im Haushalt half, würde am Nachmittag kommen, und Dulcie stellte sich darauf ein, ihren diversen Plaudereien zu lauschen.
Miss Lord, hochgewachsen und grauhaarig, war Junggesellin und hatte früher in der Kurzwarenabteilung eines großen Kensingtoner Kaufhauses gearbeitet. Aber die langen Vormittage untätigen Herumstehens waren ihr zu eintönig und kräftezehrend gewesen, und so hatte sie sich auf Haushaltstätigkeiten verlegt, für die sie ein angeborenes Talent besaß und in denen heutzutage niemand mehr etwas Verachtenswertes zu sehen schien. Möglicherweise aufgrund ihrer Kurzwaren-Vergangenheit liebte sie Nippes und alles, was »schmuck« war, eine Passion, die durch die Fernsehreklame mit ihrer Hervorhebung dieses Lebensaspekts noch genährt wurde. Von Männern, diesen groben, unschmucken Geschöpfen, hielt sie wenig, mit Ausnahme der Kirchenmänner, sofern diese nicht Pfeife rauchten. Sie selbst genehmigte sich gern eine Filterzigarette zu einem Tässchen Tee oder Kaffee und steckte sich jetzt eine an, während Dulcie am Herd einen Nescafé kochte.
»Ich habe heute ein neues Mittagslokal ausprobiert«, sagte sie.
»Ach ja? Was haben Sie gegessen?« Wenn Miss Lord am Nachmittag kam, berichtete sie Dulcie immer ausführlich, woraus ihr Mittagessen bestanden hatte.
»Eier auf Käsetoast und eine Russische Creme«, sagte Miss Lord. »Gar nicht schlecht.«
»Das klingt …«, Dulcie suchte nach einem Wort, »… deliziös«, vollendete sie etwas prononcierter, als sie es vorgehabt hatte. »Was genau ist denn Russische Creme?«
»Das ist so eine Art Creme auf einem Biskuitboden mit Gelatine obendrauf«, sagte Miss Lord. »Die Gelatine kann rot, gelb oder orange sein.« Sie leerte ihre Kaffeetasse. »Wollten Sie die Blumen da wegwerfen? Ein schöner Anblick sind die ja nicht mehr.« Sie schlug einige Zinnien und Dahlien mit schleimigen Stielen in die Literaturbeilage der Times ein und trug sie hinaus zum Müll.
»Der Garten blüht ja herrlich«, sagte sie, als sie zurückkam. »Schneiden Sie noch frische Blumen für diese Vasen hier?«
»Ja, später«, sagte Dulcie, »aber erst muss ich mich um die Pflaumen kümmern. Die lagen mir schon das ganze Wochenende über auf der Seele.«
»Ja, so ein Garten ist eine Verantwortung«, seufzte Miss Lord. »Die Früchte der Erde … und bald ist ja schon wieder Erntedankfest. Werden Sie etwas für den Altar beisteuern?«, fragte sie absichtsvoll.
Die Frage und auch die Antwort waren jeden Herbst die gleichen, denn Dulcie war keine regelmäßige Kirchgängerin, Miss Lord hingegen schon.
»Ich glaube nicht«, sagte Dulcie, »aber wenn Sie etwas mitnehmen möchten: gerne. Pflaumen oder Äpfel – und Blumen natürlich sowieso.«
»Sehr nett ist das von Ihnen, Miss Mainwaring. Bei uns gibt es ja nun keinen Garten, und man möchte doch auch seinen Beitrag leisten. Gut, ein Brot könnte ich vielleicht backen, aber alles mit Hefe hat so etwas Beschwerliches, finden Sie nicht? Da weiß man nie … Letztes oder vorletztes Jahr hatten wir bei uns in der Kirche einen Brotlaib, wunderschön gemacht, so ein geflochtener Kranz. Aber wissen Sie, was?« Sie senkte die Stimme. »Er war aus Gips. Also das fand ich doch ein starkes Stück. So ein Gipsbrot kann man ja auch keinem Krankenhaus stiften, nicht wahr?«
»Nein, das hieße wahrhaft, um Brot bitten und dafür einen Stein bekommen.«
»Obwohl es genau genommen ja Gips wäre, Miss Mainwaring. Damals hatten wir den neuen Pfarrer, den, zu dem wir ›Pater‹ sagen sollten – als ob das Gipsbrot noch nicht genug wäre! Da haben wir uns aber auch beim Bischof beschwert, alles, was recht ist.«
»Tja, Veränderungen sind sehr oft zum Schlechteren«, sagte Dulcie. »Sie wissen, dass bald meine Nichte Laurel hier einzieht?«
»Die Älteste von Ihrer Schwester? Doch, Miss Mainwaring, das haben Sie erwähnt. Welches Zimmer soll sie denn bekommen?«
»Das große nach hinten raus, dachte ich.«
»MrsMainwarings Zimmer?«, fragte Miss Lord mit gesenkter Stimme.
»Ja, ich finde, es sollte langsam wieder genutzt werden. Vielleicht können wir das in Angriff nehmen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Wir könnten das große Bett ins Gästezimmer räumen und ihr stattdessen eins von den Schlafsofas hinstellen, und ein Bücherregal wird sie sicher auch brauchen.«
»Diese ganze Leserei«, sagte Miss Lord. »Früher hab ich ganz gern mal ein Buch gelesen, aber jetzt hab ich nicht mehr die Zeit.«
»Ich habe meinen Abschluss in englischer Literatur gemacht«, sagte Dulcie fast mehr zu sich selbst.
»Aber was kommt dabei raus, Miss Mainwaring?«
»Das ist so eine Frage. Ich meine, Bildung stellt natürlich ein Gut an sich dar, und ein Literaturstudium ist etwas sehr Schönes.«
»Na, nett ist es wahrscheinlich«, sagte Miss Lord zweifelnd.
»Man kann immer in den Lehrberuf gehen«, fuhr Dulcie fort, »oder andere Arbeiten machen.«
»So wie Sie, Miss Mainwaring, mit diesen ganzen Kärtchen und Zetteln, die bei Ihnen auf dem Boden herumliegen.« Miss Lord lachte, ein helles, spöttisches Lachen.
Dulcie fühlte sich an ihren Platz verwiesen und klaubte schweigend die überreifen Pflaumen zwischen den noch nicht so reifen heraus.
»Aus denen koche ich am besten ein Kompott für heute Abend«, sagte sie. »Ich setze sie gleich mal auf.«
Während sie damit beschäftigt war, plante Dulcie Laurels Zimmer. Die alten blauen Samtvorhänge waren reichlich verschossen und trist, auch wenn sie im Winter die Zugluft abhielten und dem Zimmer, wenn sie zugezogen waren, etwas Gemütliches gaben. Ein farbenfroh bedruckter Baumwollstoff wäre da vielleicht zeitgemäßer und auch passender für ein junges Mädchen … Was für trübe Gedanken an einem so schönen Nachmittag, schalt sie sich, beschämt sogar über die Sprache, in der diese Gedanken daherkamen. Da klang vermutlich die arme Miss Lord durch – oder war es ihre Sicht auf sich selbst als Tante, die Verantwortung für eine Nichte trug? Laurels Mutter, Dulcies Schwester Charlotte, lebte in Dorset, wo ihr Mann Robin Schuldirektor und in seiner Freizeit Kurator im örtlichen Museum war. Laurel war das älteste ihrer drei Kinder und frisch mit der Schule fertig. Dulcie sah sich selbst, wie sie mit den rätselhaften Launen einer Heranwachsenden fertigzuwerden versuchte, wie sie nachts unruhig wach lag, weil Laurel sich verspätete. Allzu froh machte die Aussicht sie nicht, aber sie würde wohl kaum darum herumkommen. Ein Mädchen mit einer Tante in London konnte schließlich nicht in einer Studentenbude oder im Wohnheim wohnen – dieser Meinung war zumindest Charlotte.
Durch die Bäume und den Zaun am Ende des Gartens konnte Dulcie ihre Nachbarin MrsBeltane sehen, die in einem Blümchenkleid auf einem geblümten Liegestuhl saß und ihrem Gartenschlauch mit seiner speziellen Sprühvorrichtung beim Rasensprengen zuschaute. MrsBeltane war eine elegante Dame um die sechzig, blauhaarig und schon etwas steif in den Gliedern, die einmal bessere Zeiten erlebt hatte. Jedenfalls ließ sie das gern durchblicken, denn sie hatte das gesamte Obergeschoss ihres Hauses an einen brasilianischen Herrn vermietet, einen Diplomaten zugegebenermaßen, und wurde es nicht müde zu versichern, dass so etwas »in den alten Tagen« undenkbar für sie gewesen wäre.
Senhor MacBride-Pereira – wie viele Brasilianer war er gemischter Abstammung – war ein sehr sympathischer Mensch, fand Dulcie. Er war Ende fünfzig, ziemlich dick, mit sanften braunen Augen und einem geradezu hinreißenden Lächeln. Er sprach ein ausgezeichnetes Englisch und war ein großer Verehrer britischer Sitten und Gebräuche. »Ausländer zu sein, ist schon schlimm genug«, klagte er oft, »und Amerikaner zu sein, erst recht, aber Lateinamerikaner zu sein, das ist die Katastrophe schlechthin!«
Heute Nachmittag saß er bei MrsBeltane, spielte mit Felix, dem kleinen grauen Pudel, und redete mit seiner melodischen Stimme. Einzelne Worte konnte Dulcie nicht verstehen, aber gelegentlich hörte sie MrsBeltanes silbriges Lachen perlen. Trotz des Abstiegs, den es bedeutete, einen Logiergast ins Haus nehmen zu müssen, genoss sie seine Gesellschaft, zumal ein Skandal ausgeschlossen war, da ihre beiden Kinder, Paul und Monica, beide noch daheim wohnten.
Dulcie, in der Hand eine Schüssel mit Pflaumen, näherte sich vorsichtig dem Zaun. Sie scheute sich, das Gespräch ihrer Nachbarn zu unterbrechen, deshalb stand sie einfach nur da und tat so, als würde sie Dahlien hochbinden; wenn die zwei keine Notiz von ihr nahmen, konnte sie sich mitsamt ihrer Schüssel einfach wieder davonstehlen.
»Ich muss schon sagen, Miss Mainwaring«, rief MrsBeltane in huldvollem Ton, »Ihre Dahlien sind eine Pracht!«
»Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht ein paar Pflaumen möchten«, sagte Dulcie.
»Pflaumen?« MrsBeltane klang so verdutzt, als würde ihr eine seltene Tropenfrucht offeriert. »Wie reizend von Ihnen. Ein paar Pflaumen schaden nie.«
»Sind das Elvas-Pflaumen?«, wollte Senhor MacBride-Pereira wissen.
»Äh, nein, sie sind von dem Baum da.« Dulcie machte eine unbestimmte Handbewegung. »Ich glaube, es sind Königin-Viktoria-Pflaumen.«
»Ah, Königin Viktoria«, echote Senhor MacBride-Pereira voller Genugtuung. »Mein Großvater war einmal auf Schloss Balmoral. Das war natürlich, bevor er nach São Paulo kam.«
MrsBeltane war an den Zaun getreten, um die Schüssel in Empfang zu nehmen, die ganz ordinär aus Glas war.
»Sie werden wunderbar aussehen auf meinen Rockingham-Obsttellerchen«, sagte sie. »Was für makellose Exemplare das sind! Und hatten Sie eine schöne Tagung?«
»O ja, wirklich sehr schön«, sagte Dulcie lebhaft und fragte sich dann, ob das nicht eine etwas kühne Behauptung war. »Wenn sehr viele Leute auf dem gleichen Gebiet arbeiten, hat man immer eine Menge gemeinsamer Themen«, erklärte sie, aber es hörte sich auch für sie ungemein fade an.
»Ich kann mir nie merken, was Sie genau machen«, sagte MrsBeltane gnädig. »Eine Art Sekretärinnentätigkeit, richtig?«
»Ja, so könnte man es nennen. Ich arbeite Leuten zu.«
»Und haben Sie auf dieser Tagung jemand Netten kennengelernt?«, erkundigte sich MrsBeltane, und ihre Stimmlage hob sich erwartungsvoll.