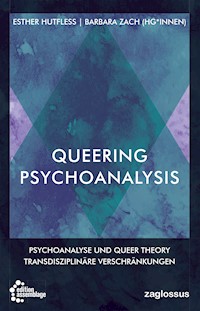
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition assemblage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Psychoanalyse stellt eine wichtige Behandlungsmethode im psychotherapeutischen Feld dar und ist eine einflussreiche Stimme in den kultur- und geisteswissenschaftlichen Diskursen unserer Zeit. Kritische Auseinandersetzungen, insbesondere ausgehend von feministischen und queeren Theorien, werden von der Psychoanalyse kaum aufgegriffen und es gibt innerhalb der psychoanalytischen Theorie und Praxis wenig Bewusstsein für die in ihr wirkenden patriarchalen und heteronormativen Diskurse. Die Psychoanalyse wird daher in den aktuellen Debatten um Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen meist nicht als adäquater theoretischer Zugang wahrgenommen. Dieser Sammelband möchte einen produktiven Dialog zwischen Psychoanalyse und queeren Theorien im deutschsprachigen Raum initiieren, die unhinterfragten heteronormativen Paradigmen innerhalb der Psychoanalyse dekonstruieren, aber auch wichtige Impulse für das Aufgreifen psychoanalytischer Ansätze in queeren Theorien liefern. Mit Beiträgen von Teresa de Lauretis, Jack Drescher, Lee Edelman, Antke Engel, Griffin Hansbury, Susann Heenen-Wolff, Esther Hutfless, Jack Pula, Ilka Quindeau, Almut Rudolf-Petersen, Christoph Sulyok, Eve Watson, Anne Worthington, Tim Dean und Barbara Zach. Das 2017 im Zaglossus Verlag erschienene Fachbuch konnte sich bis heute als Standardwerk im deutschsprachigen Raum etablieren und erscheint nun in leicht überarbeiteter Auflage in der edition assemblage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ESTHER HUTFLESS | BARBARA ZACH (HG*INNEN)
QUEERING PSYCHOANALYSIS
PSYCHOANALYSE UND QUEER THEORYTRANSDISZIPLINÄRE VERSCHRÄNKUNGEN
zaglossus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Eigentumsvorbehalt:
Dieses Buch bleibt Eigentum des Verlages, bis es der gefangenen
Person direkt ausgehändigt wurde. Zur-Habe-Nahme ist keine
Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts.
Bei Nichtaushändigung ist es unter Mitteilung des Grundes zurückzusenden.
ESTHER HUTFLESS | BARBARA ZACH (HG*INNEN)
QUEERING PSYCHOANALYSIS
PSYCHOANALYSE UND QUEER THEORYTRANSDISZIPLINÄRE VERSCHRÄNKUNGEN
ISBN 978-3-96042-830-5
© edition assemblage
Postfach 27 46 | D- 48041 Münster
www.edition-assemblage.de
4., leicht veränderte Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
1. - 3. Auflage (978-3-902902-57-3)
erschienen bei Zaglossus e. U., Wien, 2017
Lektorat: Nicole Alecu de Flers, Esther Hutfless, Elisabeth Schäfer
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
Inhalt
Esther Hutfless und Barbara ZachQueering Psychoanalysis. Vorwort
Esther HutflessQueer [Theory]: Annäherungen an das Undarstellbare. Einleitung
Jack DrescherVon Bisexualität zu Intersexualität: Geschlechterkategorien neu denken
Susann Heenen-WolffUnbehagen in der Tradition: Kritische Anmerkungen zu normativen Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Psychoanalyse
Esther HutflessDie Zukunft einer Illusion: Eine queer-psychoanalytische Kritik am Identitätsdenken der Psychoanalyse
Ilka QuindeauGeschlechtervielfalt und polymorphes Begehren: Queere Perspektiven in der Psychoanalyse
Teresa de LauretisDer queere Trieb: Rereading Freud mit Laplanche
Antke EngelA_Sozialität, Multiplizität und Serendipität des Begehrens: Queere Rekonzeptualisierungen psychoanalytischer Begehrenstheorien
Lee EdelmanDer grausamste Schnitt: Queerness und die Psychoanalyse
Tim DeanLacan und Queer Theory
Eve WatsonQueering Psychoanalysis und Psychoanalysing Queer
Anne WorthingtonWarum Lacan? Psychoanalyse und Queer Theory
Christoph SulyokGrenzgänge: Perversionen queeren?
Almut Rudolf-PetersenNeue Übertragungskonstellationen
Barbara ZachÜber den freien Fall und die sichere Landung: Zum Erleben der Psychoanalytiker*in in der Arbeit mit Trans*genders und Genderqueers
Griffin HansburyKing Kong und Goldlöckchen: Transmännlichkeiten vor dem Hintergrund der Trans-Trans-Dyade
Jack PulaGender aus der Perspektive der Transgender-Erfahrung
Autor*innen
Drucknachweise
Queering Psychoanalysis Vorwort
Esther Hutfless und Barbara Zach
Dieser Band entstand ausgehend von einer in Wien gegründeten Forschungsgruppe mit dem gleichnamigen Titel „Queering Psychoanalysis“ und dem Anliegen, längst überfällige theoretische und klinische Auseinandersetzungen an der Schnittstelle von Queer Theory1 und Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum anzustoßen. Wir haben uns daher entschieden, deutschsprachige Autor*innen2 zu dieser produktiven Auseinandersetzung einzuladen, zugleich war es uns wichtig, den sehr vielfältigen und schon länger bestehenden angloamerikanischen Diskurs zu Queer Theory und Psychoanalyse auch im deutschsprachigen Raum einer breiteren Leser*innenschaft zugänglich zu machen.
Die Auseinandersetzung zwischen Queer Theory und Psychoanalyse scheint uns vor allem aus zwei Perspektiven wichtig und produktiv: Einerseits geht es uns darum, das schwierige Verhältnis zwischen queeren Lebens- und Begehrensweisen und der Psychoanalyse zu problematisieren und Vorurteile – die auf beiden Seiten bestehen – abzubauen. So wird etwa die Psychoanalyse in aktuellen Diskursen der Queer Theory und Gender Studies bis auf einige Ausnahmen – z. B. die theoretischen Arbeiten von Judith Butler, Tim Dean, Lee Edelman, Antke Engel und Teresa de Lauretis – oft nicht als adäquater Zugang betrachtet, um über Geschlechtsidentitäten bzw. -fluiditäten, sexuelle Orientierungen, Transidentitäten, die Dekonstruktion der binären Geschlechterordnung, die Genese des Subjekts etc. nachzudenken (vgl. dazu auch de Lauretis 2017).3 Das kommt nicht von ungefähr: Theoretisch wie klinisch hat sich die Psychoanalyse lange Zeit durch pathologisierende und abwertende Diskurse nicht unbedingt als Zugang der Wahl angeboten. Bis in die 1990er-Jahre haben die meisten Ausbildungsvereine keine offen schwulen oder lesbischen Ausbildungskandidat*innen aufgenommen und heute scheint die frühere durchaus offene Homophobie oftmals durch eine Transphobie ersetzt worden zu sein (vgl. dazu auch Drescher 2008: 452; Quindeau 2017: 182; Rauchfleisch 2001: 139 ff.; Rudolf-Petersen 2017: 504; Pula 2017). Viele potenziell an der Psychoanalyse Interessierte ziehen für sich eine Analyse aus Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung nicht in Betracht oder begegnen ihr mit großer Skepsis. Diese Skepsis ist oft nicht unbegründet. Stereotype über LGBTIQ*s4 werden in Vorträgen, Ausbildungsseminaren, Supervisionen, aber auch in der klinischen Arbeit mit Analysand*innen oftmals noch immer unhinterfragt reproduziert.
Auch die Queer Theory bzw. queere Theorien werden von der psychoanalytischen Theoriebildung meist nicht als ernstzunehmendes Feld der Auseinandersetzung wahrgenommen. Vom psychoanalytischen Mainstream wird ihre kritische Haltung gegenüber der heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit und der Kritik an Identitätslogiken (vgl. dazu auch Engel 2017; Edelman 2017; Hansbury 2017; Zach 2017) oft pathologisiert und u. a. als Verleugnung der Kastration gedeutet. Darüber hinaus führt zurückgewiesen wird.5
„[d]ie sehr politische Auseinandersetzung mit Identität, die Dekonstruktion der Zweigeschlechtlichkeit, die Auseinandersetzung mit nicht-normativen Sexualitäten von Seiten queerer Theorie und Praxis […] in psychoanalytischen Diskussionen oft dazu, dass eine Verwechslung von Politischem mit Psychischem unterstellt und die queere Kritik an Identität in Zusammenhang mit psychischer und geschlechtlicher Kohärenz sowie an der Heteronormativität“ (Hutfless 2017)
In Absetzung von dieser psychoanalytischen Kritik stellt aus unserer Perspektive jedoch die oft vereinfachte – das Unbewusste außer Acht lassende – Auseinandersetzung mit der Subjektgenese und der Performativität von Geschlecht eine Schwäche vieler queer-theoretischer Zugänge dar (vgl. dazu auch Dean 2017; Watson 2017; Sulyok 2017); dies wird allerdings von der psychoanalytischen Kritik an queeren Ansätzen selten herausgearbeitet. Für queere Ansätze kann die Auseinandersetzung mit dem Unbewussten aus unserer Perspektive sehr bereichernd sein, denn nicht nur gesellschaftliche Diskurse und Ausschlussmechanismen, sondern auch intrapsychische Strukturen, unbewusste Ängste, Wünsche, Phantasien, Konflikte, Triebe, Abwehrmechanismen … beeinflussen die Genese sowie die geschlechtlichen Seins- und die sozialen Handlungsweisen eines Subjekts.
Andererseits möchten wir den diskurstheoretischen und dekonstruktivistischen Hintergrund der Queer Theory als kritisches Instrumentarium zur Analyse von diskriminierenden und pathologisierenden Diskursen innerhalb der Psychoanalyse stark machen. Die Psychoanalyse verkennt, dass sie selbst sexuelle und geschlechtliche Phänomene nicht bloß beschreibt, sondern an der diskursiven Hervorbringung von bestimmten Subjekten und deren Degradierung als pathologisch, entwicklungsgestört etc. ebenso maßgeblich beteiligt ist (vgl. dazu auch Heenen-Wolff 2017; Hutfless 2017; Worthington 2017). Ein Zusammendenken von queer-feministischer Theorie, Queer Theory und Psychoanalyse scheint uns daher aus wissenschaftskritischen Gesichtspunkten wichtig, um die vielfachen Pathologisierungen und die unhinterfragten heteronormativen Paradigmen innerhalb der Psychoanalyse zu dekonstruieren und kritisch zu hinterfragen, aber auch aus behandlungstechnischen Gründen, um Menschen mit nicht-konformen Sexualitäten, Begehren, Geschlechtsidentitäten bzw. -fluiditäten etc. vor bewussten und unbewussten Befangenheiten und Voreingenommenheiten vonseiten der Analytiker*innen zu schützen (vgl. Hutfless 2017).
Aus einer sich zueinander öffnenden kritischen Annäherung können beide – Psychoanalyse und Queer Theory – profitieren. Zu dieser Öffnung und dem produktiven Austausch möchte der hier vorliegende Band einen initiierenden Beitrag leisten.
Die Psychoanalyse zu queeren bedeutet für uns nicht, ihr eine politische Ideologie überzustülpen – was viele Analytiker*innen befürchten und queer-feministische Kritik daher ablehnen –, sondern im Gegenteil, das, was immer schon immanent queer und widerständig an der Psychoanalyse war und ist, in den Mittelpunkt zu stellen und produktiv zu machen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes arbeiten genau jene queeren, dekonstruktiven und entpathologisierenden Elemente heraus, die seit Freud die Psychoanalyse durchziehen, die vom psychoanalytischen Mainstream jedoch häufig vernachlässigt wurden.
Jack Drescher (New York City) plädiert in Von Bisexualität zu Intersexualität: Geschlechterkategorien neu denken ausgehend von der Fallgeschichte einer 16-jährigen intersexuellen Patient*in dafür, dass Analytiker*innen sich in neuer Weise mit geschlechtlichen Identitäten und Sexualitäten auseinandersetzen. Wichtige Ausgangspunkte dieser Auseinandersetzung bilden Drescher zufolge die Bewusstmachung kulturell tradierter „sexueller Hierarchien“ (S. 70) und „eigene[r] Wertehierarchien“ (S. 73), die kritische Beschäftigung mit der Bedeutung des Konzepts der „Natürlichkeit“ (S. 74) und die „kritische Auseinandersetzung mit den historischen Grundannahmen“ (S. 51) der Psychoanalyse. Die Schwierigkeiten der Psychoanalyse in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Geschlechtsidentitäten sieht Drescher in den „theoretischen Traditionen begründet, die auf Freud zurückgehend eher um Fragen der Ätiologie kreisen […], anstatt [deren; Einf. E. H.] Bedeutungen in den Blickpunkt zu nehmen“ (S. 58).
In Unbehagen in der Tradition: Kritische Anmerkungen zu normativen Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Psychoanalyse vertritt Susann Heenen-Wolff (Brüssel) die These, dass die klassische psychoanalytische Theorie nicht mehr adäquat ist, um zeitgenössische Formen psychosexueller Realität zu konzeptualisieren. Heenen-Wolff dekonstruiert die psychoanalytische Konzeption des Ödipuskomplexes sowie deren normative Vorstellungen von weiblicher und männlicher Psychosexualität und verweist auf die kulturelle und intersubjektive Determiniertheit der Ödipussituation. Jean Laplanches „Allgemeine Verführungstheorie“ versteht Heenen-Wolff ausgehend davon als wichtigen Ansatz, „um das intersubjektive Paradigma in der Psychoanalyse mit der Triebtheorie zu verbinden und so zu einer ‚intersubjektiven Triebtheorie‘ zu gelangen“ (S. 107), die es Heenen-Wolff zufolge ermöglicht, „bewusste und unbewusste Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern mit wesentlich weniger eingrenzenden normativen Vorauffassungen zu untersuchen“ (S. 107).
Esther Hufless (Wien) siedelt im Beitrag Die Zukunft einer Illusion: Eine queer-psychoanalytische Kritik am Identitätsdenken der Psychoanalyse Sigmund Freuds Werk im Spannungsfeld von Moderne und Postmoderne an. Aus dieser Perspektive lässt sich auch die Ambivalenz im Freud’schen Werk verstehen, in dem Subjekt-de- und -rezentrierende Aspekte nebeneinanderstehen. Hutfless hebt hervor, dass Identität als Konzept, das die Einheit und Kohärenz eines Ichs beschreibt, erst ab den 1950er-Jahren innerhalb der Psychoanalyse Verbreitung fand. Queer hingegen geht mit der Erkenntnis einher, dass Geschlecht, Sexualität und Identität keine natürlichen Kategorien darstellen, sondern „fiktionale Konstrukte sind, die nichtsdestotrotz materielle Effekte zeitigen“ (S. 38 u. 137). Hutfless entwirft – im Rückgriff auf Julia Kristeva – ein queeres, nicht-identitäres Subjekt des Werdens, das der psychoanalytischen Theorie immer schon eingeschrieben ist, und zeigt, dass ein queerer, identitätskritischer Ansatz mit den Implikationen einer psychoanalytischen Subjekttheorie vereinbar ist (vgl. S. 161).
In Geschlechtervielfalt und polymorphes Begehren: Queere Perspektiven in der Psychoanalyse hinterfragt Ilka Quindeau (Frankfurt) die „normativen Identitätsvorstellungen“ in der Psychoanalyse. Ähnlich wie Heenen-Wolff setzt auch Quindeau bei der Konzeption des Ödipuskomplexes in der Psychoanalyse an. Quindeau kritisiert Butler folgend die daraus abgeleitete „Verlötung von Sexualität und Geschlecht“, die Quindeau jedoch „psychologisch weder notwendig noch besonders plausibel“ erscheint, „sondern vielmehr der Heteronormativität geschuldet“ (S. 183). Da dem Ödipuskomplex für die „Strukturierung der Persönlichkeit und der Sexualität“ eine zentrale Bedeutung zukommt, hält Quindeau an ihm fest, unterzieht ihn jedoch ausgehend von feministischer und queerer Kritik und unter Rückgriff auf Jean Laplanches Konzeption der psychosexuellen Entwicklung einer Revision. Zentral ist für Quindeau, dass „sich die ödipalen Lösungen im Hinblick auf Geschlechtserleben und sexuelle Orientierung durch eine lebenslange Dynamik und prinzipielle Wandelbarkeit“ (S. 207) auszeichnen, wodurch fluide und dynamische Identitäten entstehen.
Im Beitrag Der queere Trieb: Rereading Freud mit Laplanche argumentiert Teresa de Lauretis (San Francisco) mit Rückgriff auf Laplanche, dass die Freud’sche Sexualtheorie bereits den Entwurf einer queeren Sexualität enthält. Laplanche entwickelt, so de Lauretis, auf der Basis von Freuds Entdeckung des Unbewussten und der infantilen Sexualität, die „triebhafte Sexualität“, die er das Sexuale nennt, als eine perverse, nicht-reproduktive, anarchische Sexualität, die unabhängig von Gender oder Sex ist. „In Laplanches Allgemeiner Verführungstheorie bezeichnet das Sexuale den durch die rätselhaften Botschaften der Eltern oder anderer Erwachsener dem Kind eingepflanzten Trieb“ (S. 232). Laplanche nennt das Sexuale nicht queer – de Lauretis tut das aber sehr wohl. De Lauretis liest diese nicht-normative Theorie des Sexualen, die Laplanche – wie de Lauretis argumentiert – für die Psychoanalyse zurückgewonnen hat, als Konzeption einer queeren triebhaften Sexualität (vgl. S. 237 u. 245ff).
Antke Engel (Berlin) geht in A_Sozialität, Multiplizität und Serendipität des Begehrens: Queere Rekonzeptualisierungen psychoanalytischer Begehrenstheorien den Fragen nach, wie „neue Weisen zu begehren entstehen“ können, die nicht ausschließlich oder hierarchisch operieren, die die „Offenheit für Begegnungen mit der unhintergehbaren Andersheit d* Anderen (Alterität)“ (S. 261) entstehen lassen, die auf den „Phallus als privilegiertes Zeichen des Begehrens“ verzichten können und die gesellschaftspolitisch relevant werden. Im Nachgehen dieser Fragen und einer queeren Rekonzeptionalisierung des Begehrens greift Engel vor allem auf Butler, Benjamin und de Lauretis zurück und auf die psychoanalytischen Ansätze Jean Laplanches. Engel arbeitet in ihrem Beitrag drei Aspekte des Begehrens heraus: die Multiplizität, die Serendipität und die A_Sozialität. Engels Anliegen ist es, alternative Begehrenskonzeptionen – jenseits des Mangels, des Ganzheitswunsches und der binären Komplementarität (vgl. S. 257) – herauszuarbeiten.
In Der grausamste Schnitt: Queerness und die Psychoanalyse geht es Lee Edelmann (Boston) vor dem Hintergrund einer hegelianisch geprägten Lacan-Lektüre darum, „Identitäten“ gleichermaßen philosophisch wie psychoanalytisch daraufhin zu befragen, was es ihnen ermöglicht, sich gegen die Welt und z. T. sogar gegen das Leben zur Wehr zu setzen, und wie sie das tun. Es ist die Gewalt des Wortes, durch die die soziale Ordnung der Welt immer wieder festgelegt wird, die stets auch „[…] Orte des Nicht-Seins [erzeugt]“ (S. 338). Die Möglichkeit des Nicht-Seins jedoch macht die Einheit des Seins selbst unmöglich. Daher sind alle Figuren und Erscheinungsformen von Queerness so bedrohlich. Als Bezeichnungen dafür, „von Sein und Sinn ausgeschlossen zu sein“ (S. 307), verweisen „Queer, Frau, Schwarz, Braun, Trans, Subaltern, Terrorist …“ (S. 303) auf die Begegnung mit dem Realen. Jeder dieser Begriffe steht für den gewaltsamen Bruch mit der Welt. Indem er die Identitäten strukturierende Logik untersucht, die untrennbar an die Stigmatisierung von Queerness als Nicht-Sinn geknüpft ist, nähert sich Edelman jenem Kreuzungspunkt, „an dem sich das Geschlecht und das Unerträgliche begegnen“ (S. 309) und der Wille zum Sinn, durch den die Sprache eine Welt immer wieder herstellt, fragil und prekär wird, weil jene vom Sein ausgeschlossenen Figuren insistieren, dass die Welt „Nicht-Alles“ ist.
In Lacan und Queer Theory argumentiert Tim Dean (Urbana-Champaign, Illinois), dass „Queer Theory eigentlich mit Freud beginnt, insbesondere mit seinen Theorien über das Polymorph-Perverse, über kindliche Sexualität und das Unbewusste“ (S. 345). Ausgehend davon betrachtet Dean Lacan als denjenigen, der im Freud’schen Werk all das wiederentdeckt hat, „was ungewöhnlich und widerständig ist […], was unserer normalen, vernünftigen Art, menschliche Subjektivität zu denken, fremd bleibt“ (S. 345). Um das Verhältnis zwischen Queer Theory und der Psychoanalyse auszuloten – vor allem mit Lacans strukturalem Ansatz –, bringt Dean Foucault und Lacan in einen kritischen Dialog, wobei Dean viele Gemeinsamkeiten herausarbeitet, etwa was die Konzeption der Macht betrifft oder das Misstrauen „gegenüber subjektiven Identitäten“ (S. 355), jedoch auch fundamentale Differenzen, etwa die Konzeption des Begehrens und die Bedeutung der Negativität. Vor allem Lacans Auseinandersetzungen mit der jouissance und mit l’objet petit a stellen für Dean sehr gewinnbringende „ent-heterosexualisierende“ Ansätze dar und Dean hält fest, dass es in Hinblick auf das Unbewusste keinen Sinn macht, „von heterosexueller oder homosexueller Objektwahl zu sprechen“ (S. 363), weshalb „eine Theorie der Subjektivität, die das Unbewusste berücksichtigt, aus queerer Perspektive äußert hilfreich sein“ kann (S. 363).
Ähnlich wie Tim Dean geht auch Eve Watson (Dublin) im Beitrag Queering Psychoanalysis und Psychoanalysing Queer vor allem von Lacans strukturaler Psychoanalyse als gewinnbringendem Ansatz für ein „Queering“ der Psychoanalyse aus. Dabei legt Watson das Augenmerk vor allem auf die psychoanalytischen Konzeptionen von Sexualität, Lust, Begehren und Subjektivität. Darüber hinaus geht Watson der Frage nach, inwiefern „das Lacan’sche Subjekt des Begehrens mit dem queeren Projekt der radikalen Destabilisierung von (Hetero-)Normativität zusammenzubringen“ ist, und Watson sieht – ähnlich wie Dean – u. a. im objet petit a einen vielversprechenden Anknüpfungspunkt zu queeren Ansätzen, da es weder auf Vorstellungen von Geschlecht noch auf dem Freud’schen Konzept der Objektwahl basiert. Aus einem Zusammenlesen von Queer Theory und Lacan’scher Psychoanalyse können sich Watson zufolge viele produktive Ansätze ergeben: So verweist Geschlecht im Kontext der Psychoanalyse „sowohl auf bewusstes wie auch auf unbewusstes Wissen und zwingt geradezu zu einer Auseinandersetzung mit den konzeptionellen Grenzen der Begriffe Sexualität, Gender und Sex jenseits der Koordinaten der altbekannten und sich erschöpfenden Debatten von Essenzialismus versus Konstruktivismus und Natur versus Erziehung“ (S. 380). Watson betont, dass sowohl für „psychoanalytische Kliniker*innen, die sich intensiver mit dem weiten Feld von Normalisierungen durch die kritische Auseinandersetzung mit Intersektionalität beschäftigen“ wollen, die queere Kritik an „Rassisierung, Gender, sozialer Schicht, Religion, Kapitalismus, Transnationalität, Diaspora, Immigration, Sexualität sowie Fragen der Staatsangehörigkeit, Nationalität und Nekropolitik“ (S. 411) als auch für das Feld der Psychoanalyse allgemein die u. a. aus der Queer Theory kommende „Aufmerksamkeit gegenüber jenen Strukturen, durch die bestimmte Subjekte über die Produktion von perversen und pathologischen Anderen als ‚normal‘ und ‚natürlich‘ gesetzt werden“ (S. 411), wichtig ist.
In Warum Lacan? Psychoanalyse und Queer Theory beschäftigt sich Anne Worthington (London) ebenso mit der Verknüpfung von Lacan’scher Psychoanalyse und Queer Theory. Neben einer Auseinandersetzung mit Freuds Grundkonzepten zu Geschlechterfragen und deren Kontrastierung mit Teresa de Lauretis’ Entwurf einer lesbischen Sexualität aus Die andere Szene (1999), beschäftigt sich Worthington mit Lacans strukturaler Lesart von Neurose, Psychose und Perversion und plädiert für ein nicht hierarchisierendes und nicht pathologisierendes Verständnis dieser drei Strukturen, wobei Worthington jeweils auch Verknüpfungen zu queeren Ansätzen herstellt. Worthington argumentiert, dass eine „durch Lacan inspirierte Lesart der Psychoanalyse […] die Anfechtungen jener Queer-Theoretiker*innen widerlegen [kann; Einf. E. H.], die der Psychoanalyse eine mörderische Heteronormativität vorwerfen“, und dass sie „konzeptionelle Instrumente liefern [kann; Einf. E. H.], um die Vorstellung von der Stabilität geschlechtlicher Subjektivität und des Begehrens als etwas, das natürlich biologisch gegeben ist, kritisch zu beleuchten“ (S 453). Aber auch die Psychoanalyse könnte, so Worthington, „durch eine Auseinandersetzung mit Queer Theory gestärkt werden“, indem sie sich mit ihrer eigenen „Komplizenschaft mit Machtverhältnissen“ (S. 453) kritisch auseinandersetzt.
Christoph Sulyok (Wien) behandelt im Beitrag Grenzgänge: Perversionen queeren? eine innerhalb der Queer Theory vielfach vernachlässigte Problematik. Sulyok geht der Frage nach, wie weit die grundsätzlich begrüßenswerte Entpathologisierung von Sexualitäten – Sexualitäten, die in psychoanalytischen bzw. psychiatrischen Diskursen ausgehend von „klassischen Rollenbildern und gesellschaftlichen Hierarchien“ (S. 461) gedacht werden – durch queere Theorien gehen kann und wo sie an ihre Grenzen stößt. Diese Grenze ist für Sulyok da erreicht, wo Sexualitäten „andere Menschen schwerwiegend verletzen“ (S. 461). Sulyok liest im Folgenden „queere Ansätze psychoanalytisch […] [und; Einf. E. H.] psychoanalytische Theorien queer“ (S. 461) und lotet in diesen Grenzgängen zwischen Queer Theory und Psychoanalyse verschiedene „Betrachtungsweisen des Perversen innerhalb der Psychoanalyse“ (S. 496) aus, die mit queeren Ansätzen verbunden werden können.
Almut Rudolf-Petersen (Hamburg) untersucht in Neue Übertragungskonstellationen den Einfluss der Entpathologisierung der Homosexualität innerhalb der psychoanalytischen Fachwelt auf die konkrete psychoanalytische Arbeit. Dazu analysiert Rudolf-Petersen drei von offen homosexuellen US-amerikanischen Psychoanalytiker*innen publizierte Fall-Darstellungen. In diesen „new analytic dyads“ – schwuler Psychoanalytiker/heterosexueller Patient, schwuler Analytiker/schwuler Patient und lesbische Analytikerin/schwuler Patient –, lässt sich der Einfluss der Persönlichkeit der Psychoanalytiker*innen auf den psychoanalytischen Prozess nachvollziehen. Insbesondere der Umgang der offen homosexuellen Psychoanalytiker*innen mit ihrer sexuellen Identität im psychoanalytischen Prozess, der sich im Spannungsfeld zwischen der Vertiefung der Behandlung durch das sich daraus ergebende Material und der Begrenzung des inneren Spielraums der Patient*innen aufgrund ebendieser Offenheit bewegt (vgl. S. 525), erhellt den Nutzen der Anerkennung der Subjektivität der Psychoanalytiker*innen für die psychoanalytische Arbeit.
In Über den freien Fall und die sichere Landung: Zum Erleben der Psychoanalytiker*in in der Arbeit mit Trans*genders und Genderqueers gibt Barbara Zach (Wien) einen Einblick in das innere Erleben und die Gegenübertragungs- und Resonanzdynamiken der Psychoanalytiker*in in der Dyade lesbische Analytiker*in/trans*gender, queere Analysand*in. Auf der theoretischen Grundlage der intra- und intersubjektiven psychischen Mechanismen im psychoanalytischen Prozess – Übertragung/Gegenübertragung, projektive Identifizierung und psychoanalytische Einfühlung – werden Gefühle, Empfindungen, Gedanken und Handlungen der Analytiker*in als Resonanzkörper sichtbar gemacht und deren Wahrnehmung und Analyse als wichtig für den Fortgang des Prozesses dargestellt. Zach postuliert aus der Erfahrung der eigenen klinischen Arbeit die Bestimmtheit von Geschlechtsidentität für den Moment und regt an, die bestehenden Geschlechterkategorien „Frau“ und „Mann“ um eine dritte Kategorie „Trans*/ Inter*“ (S. 551) zu ergänzen.
Griffin Hansbury (New York City) setzt sich in King Kong und Goldlöckchen: Transmännlichkeiten vor dem Hintergrund der Trans-Trans-Dyade ausgehend von der relationalen Psychoanalyse mit dem Übertragungs-/Gegenübertragungsgeschehen „zwischen einem transmännlichen psychoanalytischen Psychotherapeut*en und einem transmännlichen Patient*en“ (S. 560) auseinander. Hansbury beleuchtet anhand einer Fallgeschichte, wie Hansbury in der eigenen psychotherapeutischen Praxis mit „geschlechtlichen Binaritäten, körperlichen Symbolen und fleischlichen Realitäten“ (S. 562) arbeitet, und beschreibt ein mögliches Modell, transmännliche Subjektivität zu verstehen. Während Hansbury in feministischen und queeren Theorien die Gefahr sieht, dass „Trans-Körper und Trans-Subjekte“ (S. 561) verloren gehen bzw. ausgelöscht werden, begibt Hansbury sich in der eigenen klinischen Arbeit mit Trans-Patient*innen auf die „gemeinsamen Suche nach ihrem verborgenen Körper und ihrem verborgenen Selbst“ (S. 561). Die Trans-Subjektposition und der Trans-Körper erinnern uns alle, so Hansbury, an das, „was wir verloren haben – sowohl an das, was wir hätten haben können, als auch an das, was wir niemals haben werden“ (S. 585).
Jack Pula (New York City) gibt in Gender aus der Perspektive der Transgender-Erfahrung einen gleichermaßen offenen wie bedachten Bericht von den eigenen Transgender-Erfahrungen im psychoanalytischen Feld als Therapeut*, als Analysepatient*, sowie als Psychoanalytiker* in Ausbildung. Dabei hält Pula fest: „Die nach wie vor bestehende Schwierigkeit der psychoanalytischen Profession, sich nicht-pathologischen Sichtweisen auf Trans zu öffnen, muss angesprochen werden.“ (S. 625) Zugleich zeugt Pulas Text von der gewachsenen Überzeugung, dass „[d]er einzigartige Rahmen sowie ihre Techniken […] die Psychoanalyse zur optimalen Methode für Transpersonen [machen], […] sodass sie in einen tiefgehenden Kontakt mit den Formen und Zuständen des Wohlbefindens und des Leidens sowie allem dazwischen treten können“ (S. 625). Das therapeutische wie theoretische Anliegen Pulas ist es, die Möglichkeiten der Psychoanalyse dahingehend auszuweiten, dass sie zum einen zu einem sicheren Ort für Transgenders werden kann und zum anderen auch zu einem Schmelztiegel für radikal neue Ansätze, die Transgenders nicht länger in einer pathologisierten Position halten wollen.
Die Möglichkeiten der Psychoanalyse auszuweiten, ihre ideologischen, normierenden und pathologisierenden Vorannahmen zu hinterfragen und sichere Milieus zu fördern, dies ist auch das Anliegen des vorliegenden Bands. Zugleich möchten wir mit diesem Band jedoch auch die Auseinan-dersetzungen und Sichtweisen queerer Theorien bereichern, auf neue Aspekte hin öffnen und offen halten.
***
Diesen Band widmen wir all jenen Vorkämpfer*innen, die sich exponiert und geoutet haben, die Risiken eingegangen sind und die dies noch immer tun; den bi- und intersexuellen, den schwulen, lesbischen und trans* Kolleg*innen, die sich das Feld der Psychoanalyse als Akteur*innen erkämpft haben und auch uns motiviert haben, dies zu tun; jenen, die für die Sichtbarkeit und Sagbarkeit dessen kämpfen, was aus der heteronormativen symbolischen Ordnung ausgeschlossen ist; jenen, die entschlossen gegen Ideologien, gegen fixierende und pathologisierende Diskurse und totalisierende Regime kämpfen; den Genderqueers* und LGBTIQ*s, die in der Vergangenheit, zum Teil aber auch noch heute, Angriffsfläche pathologisierender und abwertender, mitunter auch vernichtender sexualwissenschaftlicher, therapeutischer und psychoanalytischer Diskurse geworden sind.
Anmerkungen
1Unter Queer Theory lässt sich keine einheitliche Theorie oder Disziplin verstehen, sondern eher ein Feld an poststrukturalistischen, dekonstruktiven, politischen, kulturtheoretischen, kritischen … Diskursen, die u. a. binäre, hierarchisierende Kategorien und Konzepte, wie etwa die heteronormative Zweigeschlechtlichkeit, Identitätskategorien, Norm vs. Pathologie etc., kritisch hinterfragen und multiple Diskriminierungsformen analysieren und kritisieren und darüber hinaus zum Teil auch intersektionale Ansätze verfolgen.
2Der * bzw. _ wird im vorliegenden Band einerseits als Möglichkeit der Sichtbarmachung vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Lebens-, Seins- und Begehrensweisen verwendet, andererseits wird er zum Teil auch allgemein zur Dekonstruktion naturalisierender geschlechtlicher, aber auch sozialer Kategorien verwendet. In den einzelnen Beiträgen finden sich verschiedene Arten geschlechtersensibler und -dekonstruierender Schreibweisen, dies betrifft den Einsatz von * und _, aber auch die Schreibweise von Trans*, Transgender etc. Siehe dazu auch die Endnote 3 im Beitrag von Antke Engel zu A_Sozialität, Multiplizität und Serendipität des Begehrens: Queere Rekonzeptualisierungen psychoanalytischer Begehrenstheorien in diesem Band.
3Dabei wurden die theoretischen Konzepte der Psychoanalyse gerade in den 1970er-Jahren zu einem wichtigen, aber auch kritischen Ausgangspunkt für politisches, feministisches und vernunftkritisches Denken, das schließlich auch die Queer Theory beeinflusst hat, und es gab und gibt in der feministischen Theorie immer wieder affirmative, aber auch kritische Bezugnahmen auf die Psychoanalyse. Vgl. dazu die Arbeiten von Jessica Benjamin, Leo Bersani, Hélène Cixous, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Elisabeth Grosz, Luce Irigaray, Juliet Mitchell, Jacqueline Rose und vielen anderen.
4LGBTIQ* ist eine aus dem Englischen kommende Abkürzung und steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgenders, Intersexuelle und Queers. Der * verweist auf die Offenheit und Unabgeschlossenheit dieser Aufzählung.
5„Selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Psychischen bzw. dem Unbewussten und der äußeren politischen Welt und den Ideen politischer Bewegungen. Das Unbewusste ist gänzlich anders strukturiert, es kann weder durch politische Ansprüche und Ideologien domestiziert werden, noch kann es durch wissenschaftliche Theorien hinreichend beschrieben werden. Die Psychoanalyse stellt den Versuch einer Annäherung dar.
Es ist gerade das Anliegen der Queer Theory, aber auch feministischer Theorien, auf die problematischen, subjektkonstituierenden, pathologisierenden und normalisierenden Momente von u. a. medizinischen, therapeutischen, psychoanalytischen Diskursen aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass wissenschaftliche Diskurse nie frei von bestimmten Machtkonfigurationen und Ideologien sind. Auch die Psychoanalyse, die das Unbewusste adressiert, ist nicht Teil des Psychischen, sondern stellt einen wissenschaftlichen Diskurs dar, der durch äußere, politische, wissenschaftsgeschichtliche Strukturen beeinflusst ist, der aber zugleich auch von psychischen, triebhaften Elementen nicht unbeeinflusst ist. Gerade Freuds ‚kopernikanische Wende‘ hat gezeigt, dass ein Subjekt nie vollständig autonom und vernünftig denkt und handelt. Insofern muss konsequenterweise auch jegliche wissenschaftliche Objektivität kritisch hinterfragt werden. Diese Konsequenz, die sich aus ihrer eigenen theoretischen Basis ergibt, scheinen psychoanalytische Theorien jedoch meist nicht auf sich selbst anzuwenden. Auch in Bezug auf das Politische hat die Psychoanalyse gezeigt, dass dieses nicht allein durch bewusste Elemente strukturiert ist, sondern gerade von unbewussten Elementen durchzogen ist. Aber auch das Psychische stellt nicht allein seine eigene Quelle dar, sondern kann ohne den äußeren Anderen nicht gedacht werden. Die Queer Theory bzw. queere Theorien haben ein politisches Anliegen, möchten jedoch z. B. über ihre Kritik an Identitätskategorien etc. keine eigene psychische Theorie entwickeln, wie das von psychoanalytischer Seite oftmals unterstellt wird, sondern u. a. die psychoanalytische Theorie in Bezug auf ihre Kategorienbildung kritisch hinterfragen“ (Hutfless 2017).
Bibliografie
Dean, Tim (2017): Lacan und Queer Theory. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 345-375.
de Lauretis, Teresa (1999): Die andere Szene: Psychoanalyse und lesbische Sexualität. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
de Lauretis, Teresa (2017): Der queere Trieb: Rereading Freud mit Laplanche. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 211-255.
Drescher, Jack (2008): A History of Homosexuality and Organized Psychoanalysis. In: Journal of The American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, Jahrgang 36, Heft 3, S. 443-460.
Edelman, Lee (2017): Der grausamste Schnitt: Queerness und die Psychoanalyse. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 303-344.
Engel, Antke (2017): A_Sozialität, Multiplizität und Serendipität des Begehrens: Queere Rekonzeptualisierungen psychoanalytischer Begehrenstheorien. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 257-301.
Hansbury, Griffin (2017): King Kong und Goldlöckchen: Transmännlichkeiten vor dem Hintergrund der Trans-Trans-Dyade. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 559-587.
Heenen-Wolff, Susann (2017): Unbehagen in der Tradition: Kritische Anmerkungen zu normativen Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Psychoanalyse. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 97-131.
Hutfless, Esther (2017): Jenseits der Binarität: Psychoanalyse und Queer Theory. Vortrag, gehalten auf der Tagung Psychotherapie und Feminismus – eine (Wieder-)Annäherung des Instituts Feministischer Psychotherapiewissenschaften, 5. Mai 2017, Depot, Wien. Eine überarbeitete Version des Vortrags wird 2018 in der Zeitschrift Psychologie & Gesellschaftskritik erscheinen.
Pula, Jack (2017): Gender aus der Perspektive der Transgender-Erfahrung. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 589-629.
Quindeau, Ilka (2017): Geschlechtervielfalt und polymorphes Begehren: Queere Perspektiven in der Psychoanalyse. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 181-210.
Rauchfleisch, Udo (2001): Schwule, Lesben, Bisexuelle: Lebensweisen, Vorurteile, Einsichten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rudolf-Petersen, Almut (2017): Neue Übertragungskonstellationen. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 503-531.
Sulyok, Christoph (2017): Grenzgänge. Perversionen queeren? In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 459-502.
Watson, Eve (2017): Queering Psychoanalysis und Psychoanalysing Queer. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 377-419.
Worthington, Anne (2017): Warum Lacan? Psychoanalyse und Queer Theory. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 421-458.
Zach, Barbara (2017): Über den freien Fall und die sichere Landung: Zum Erleben der Psychoanalytiker*in in der Arbeit mit Trans*genders und Genderqueers. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 533-558.
Queer [Theory]: Annäherungen an das Undarstellbare
Einleitung
Esther Hutfless
Queer – eine philosophische Annäherung
Queer ist, folgt man Jean-François Lyotards Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? (1993), in besonderer Weise paradigmatisch für die Postmoderne. In ästhetischer Hinsicht beschreibt Lyotard die Postmoderne als „dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf ein Nicht-Darstellbares anspielt; das sich dem Trost der guten Formen verweigert, dem Konsensus eines Geschmacks, der ermöglicht, die Sehnsucht nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen; das sich auf die Suche nach neuen Darstellungen begibt, jedoch nicht, um sich an deren Genuß zu verzehren, sondern um das Gefühl dafür zu schärfen, daß es ein Undarstellbares gibt“ (Lyotard 1993: 47). Konzeptionell wird queer von vielen Theoretiker*innen genau in jenem Sinne verstanden, als Moment des Entzugs, des Undarstellbaren, als das, was im Kommen bleibt. So schreibt etwa José Esteban Muñoz: „QUEERNESS IS NOT yet here. Queerness is an ideality. Put another way, we are not yet queer. We may never touch queerness, but we can feel it as the warm illumination of a horizon imbued with potentiality“ (Muñoz 2009: 1). In ähnlicher Weise beschreibt Judith Butler queer als etwas, dessen kritisches Potenzial genau darin besteht, sich permanent zu entziehen:
„Wenn der Begriff ‚queer‘ ein Ort kollektiver Auseinandersetzung sein soll, Ausgangspunkt für eine Reihe historischer Überlegungen und Zukunftsvorstellungen, wird er das bleiben müssen, was in der Gegenwart niemals vollständig in Besitz ist, sondern immer nur neu eingesetzt wird, umgedreht wird, durchkreuzt wird [queered] von einem früheren Gebrauch her und in die Richtung dringlicher und erweiterungsfähiger politischer Zwecke“ (Butler 1997: 313).
In der Undarstellbarkeit, im permanenten Entzug, in der Transformation und der Fluidität dieses Wortes queer – Ist es überhaupt ein Wort? Und nicht vielmehr eine Kraft oder ein Effekt? – zeigt sich sein subversives Potenzial: Queer soll nicht zur Identität, zur Ideologie, zum Begriff erstarren, es soll nicht angeeignet oder instrumentalisiert werden. Greift man diese Vorstellungen von queer auf, so bedeutet dies konsequenterweise, dass sich queer nicht auf ein Signifikat, nicht auf einen Gegenstand bezieht; es bezeichnet im eigentlichen Sinne nichts und ist doch nicht beliebig, da es als Kraft statisch werdenden Bedeutungen entgegenwirkt, sie quert, queert und in Bewegung hält.
Queer erscheint jedoch in einer hybriden Gestalt: Es verweist auf ebenjene dekonstruktive Operation in der Sprache, deren Effekt es gewissermaßen ist, es fungiert zugleich als mehr oder weniger offener Überbegriff für nicht-binäre geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen und Begehrensformen, es stellt ein affirmierbares Konzept dar, das zum Ausgangspunkt von politischem Aktivismus werden kann, es verweist auf jene Eigenheit des Körpers, Vorstellungen von Natürlichkeit, Normativität und Wesenhaftigkeit immer schon zu unterwandern und zu überschreiten …1
Als Phänomen im Feld der Sprache ist queer eine Kraft, die immer schon in Signifizierungsprozessen wirkt, indem sie sich nicht auf eine Präsenz bezieht, d. h. auf ein Objekt, sondern indem sie ausgehend vom radikal Abwesenden, von dem, was sich der Sprache immer entzieht – und das die Sprache daher erst konstituiert –, produktiv wird.
Diese strukturale Vorstellung von Sprache – in der ein Wort seinen Ursprung nicht einfach im Bezeichnen eines abwesenden Gegenstands hat und Bedeutung nie durch den Bezug auf ein abwesendes Gemeintes entsteht, sondern allein aus der Differenz der Zeichen und Signifikanten zueinander – ermöglicht die Dekontextualisierung und Resignifizierung von Begriffen: Begriffe können in neue Kontexte gesetzt, mit neuen Bedeutungen angereichert und bedeutungsverändernd zitiert werden. Signifikanten sind daher ungesättigt und vermögen sich auf unendlich viele Bedeutungen hin zu öffnen und diese ereignishaft entstehen zu lassen, ohne sie letztlich zu fixieren. Bedeutungen wandern, migrieren, schreiben sich in Signifikanten ein und entschreiben sich wieder; sie verschieben sich, verdichten sich, sie bleiben im Übergang, in Transformation. Ausgehend davon kann queer in einer gewissen Nähe zu Jacques Derridas différance oder zu Jacques Lacans Verständnis signifikanter symbolischer Prozesse gesehen werden, mit der Einschränkung, dass sich weder die différance noch queer durch die quasi-metaphysische und quasi-transzendentale Figur des Lacan’schen Phallus organisiert und strukturiert.2 Vielleicht ist es eher Lacans Objekt klein a, jene Leerstelle, die das Begehren in Gang bringt und hält, die diesem Prozess des différer (auf den sich die différance bezieht) im Sinne von abweichen, unterscheiden, verschieben, aufschieben ähnlich ist.
Es kommt nicht von ungefähr, dass Derrida ebendiese Prozesse, die der Sinngebung zugrunde liegen und die auch in queer wirken, bereits in der psychoanalytischen Theorie Sigmund Freuds erkannt und beschrieben sieht: etwa da, wo Freud das Bewusstsein als „ent-grenzt“ beschreibt, da, wo es um Spuren, Bahnungen, Aufschub, Verschiebung, die ganze Ökonomie des Unbewussten geht, die sich der Präsenz entzieht und die von ihrer Struktur her auf keiner Präsenz gründet (Derrida 1988: 43 u. 44; vgl. auch Zeillinger 2002: 74 f.):
„Bei der Andersheit des ‚Unbewußten‘ haben wir es nicht mit Horizonten von modifizierten – vergangenen oder ankommenden – Gegenwarten zu tun, sondern mit einer ‚Vergangenheit‘, die nie anweste und nie anwesen wird, deren ‚An-kunft‘ nie die Produktion oder Reproduktion in der Form der Anwesenheit sein wird“ (Derrida 1988: 46).
Diese Derrida’sche Beschreibung des Unbewussten erinnert an Muñoz’ Auffassung von queer, mit dem Unterschied, dass sich Derrida auf eine offene Vergangenheit bezieht und Muñoz auf ein offenes Ideal in der Zukunft. Wenn man queer in dieser Offenheit, als ideologie- und identitätskritisches Moment entwerfen möchte, so muss sich queer einer Bezeichnung und damit Feststellung von etwas, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft, enthalten. Oder präziser: Queer ist im eigentlichen Sinne das, was jeglicher Fixierung und Benennung zuwiderläuft. Sobald etwas bezeichnet, benannt, festgestellt wird, werden unweigerlich Identitäten und damit auch Ausschlüsse und Verwerfungen produziert. Ebenso wie différance ereignet sich queer nicht in der Präsenz, sondern im Entzug.
„[D]ie différance ist nicht. Sie ist kein gegenwärtig Seiendes […]. Sie beherrscht nichts, waltet über nichts, übt nirgends eine Autorität aus. Sie kündigt sich durch keine Majuskel an. Nicht nur gibt es kein Reich der différance, sondern diese stiftet zur Subversion eines jeden Reiches an. So wird sie offensichtlich bedrohlich, und all das muß sie unvermeidlich fürchten, was in uns das Reich, die vergangene oder künftige Gegenwart eines Reiches wünscht“ (ebd.: 47).
Hier zeigt sich eine gewisse metonymische Nähe zwischen différance, dem Unbewussten und queer. Im Unterschied zur différance, die sich nie als solche gegenwärtigt, die nicht ist (vgl. ebd.: 31 f.), oder zum Unbewussten, das nie gänzlich eingeholt werden kann, bewegt sich queer durch seine Genealogie als wieder angeeigneter Begriff jedoch auch innerhalb eines bestimmten politischen Bedeutungsfeldes. Als Überbegriff bzw. Bezeichnung für Geschlechterfluidität oder für all jene, die dem heteronormativen, essenzialistischen Geschlechterbinarismus nicht entsprechen,3 bindet sich queer aber auch an das Reich der Präsenz rück und es besteht die Gefahr der Idealisierung, der Ideologisierung und der Identitätsbildung. Das, was Queer-Theoretiker*innen als das Sich-Offenhaltende beschreiben, als das, was es nicht gibt – mit Deleuze und Guattari könnte man vielleicht auch von Fluchtlinien sprechen (vgl. Deleuze/Guattari 1992) –, kann zugleich auch angeeignet werden und erneut zu hierarchischen und ausschließenden Strukturen führen. Als angeeignete „Identität“ oder als Ideal ist queer nicht davor gefeit, bewusst und unbewusst – wie viele andere Kategorien auch – zum Agieren, zur Abwehr, zur „Errichtung eines Reichs in uns“, eines inneren, aber auch nach außen projizierten Zwangssystems usw. verwendet zu werden. Nimmt man die im Vorwort geforderte Berücksichtigung des Unbewussten in queeren Diskursen ernst, so erschließt sich darüber auch eine im queer-politischen Feld oft präsente, ambivalente Dynamik: Einerseits unterbricht und durchkreuzt das Unbewusste die Identitäten bzw. die Kohärenz eines bewussten Subjekts, andererseits stellen die unbewussten Abwehrmechanismen des Ichs mitunter Identitäten, Kohärenzen etc. auch immer wieder her.
Der Bezug auf eine „queere Präsenz“ birgt jedoch nicht nur eine Gefahr, er verweist auch auf politische und ethische Möglichkeiten: die Desidentifizierung mit und die Neuartikulierung von regulativen Idealen (vgl. Butler 1997: 24) bzw. „Möglichkeiten jenseits der Norm oder sogar eine andere Zukunft für die Norm selbst zu postulieren […], [die; Einf. E. H.] den Körper zum Ausgangspunkt für eine Artikulation nimmt, die nicht immer vom Körper beschränkt ist, so wie er nun einmal ist“ (Butler 2009: 52).
Butler versteht den Körper nicht als statische Tatsache, sondern als etwas, das im Werden ist, im permanenten Prozess der Verkörperung, wodurch Normen und fiktionale regulative Ideale bzw. Ideen durch das kontinuierlich sich vollziehende Anders-Werden und durch das Entstehen neuer Fiktionen, Imaginationen, Phantasien … beständig überschritten und umgeschrieben werden (vgl. ebd.: 53). Diese Prozesse können weder politisch-strategischen noch moralischen Gesetzen unterworfen werden, sondern sind im Kontext einer „Ethik der Dekonstruktion“ zu verstehen, die nicht fixiert, sondern Plurales, Widersprüchliches, Mannigfaltiges, radikal Neues ankommen lassen kann.
Dafür plädieren auch David Eng, Jack Halberstam und José Esteban Muñoz, die den Einsatz von queer im Kontext des performativ-politischen Anspruchs, Identitätskategorien zu dekonstruieren, um dem normalisierenden diskursiven Zugriff zu entkommen, nicht als strategisch verstehen, sondern als etwas, das offen und zufällig bleiben muss: „The reinvention of the term is contingent on its potential obsolescence, one necessarily at odds with any fortification of its critical reach in advance or any static notion of its presumed audience and participants“ (Eng et al. 2005: 3).
Queer allein als Operation in der Sprache zu verstehen, wie es das Zusammendenken mit der différance suggeriert, würde zu einer entkörperten Vorstellung von queer führen. Die diskursive Hervorbringung von Körpern und Subjekten ebenso wie durchkreuzende und queerende Momente, die den Prozess dieser Hervorbringung durchziehen, bedeuten für Butler jedoch nicht, dass die „Materialität der Körper einfach nur ein linguistischer Effekt ist“ (Butler 1997: 56). Vielmehr verweist sie auf die Materialität des Signifikanten selbst und die „Unablösbarkeit von Materialität und Signifikation“ (ebd.: 57), denn die Sprache ist die Bedingung, unter der Materie auftritt, wobei „[e]inen Begriff von Materie zu haben bedeutet, eben jene Exteriorität [der Materie; Anm. E. H.] zu verlieren, deren Sicherstellung von diesem Begriff erwartet wurde“ (ebd.).
Wie Butler zeigt, werden Körper und Subjekte notwendigerweise durch die „wiederholende Macht des Diskurses“ (ebd.: 22) sowohl hervorgebracht als auch reguliert, zugleich wirkt überall da, wo die signifizierende und normierende Zitation am Werk ist, auch die verfehlende Zitation bzw. die Destabilisierung der Norm als Operation im Materialisierungsprozess von Körpern selbst:
„Das ‚biologische Geschlecht‘ ist demnach also ein regulierendes Ideal, dessen Materialisierung erzwungen ist […]. Es ist nicht eine schlichte Tatsache oder ein statischer Zustand eines Körpers, sondern ein Prozeß, bei dem regulierende Normen das ‚biologische Geschlecht‘ materialisieren und diese Materialisierung durch eine erzwungene ständige Wiederholung jener Normen erzielen. Daß diese ständige Wiederholung notwendig ist, zeigt, daß die Materialisierung nie ganz vollendet ist, daß die Körper sich nie völlig den Normen fügen“ (ebd.: 21),
aber eben auch – so möchte ich anfügen –, dass jene Normen, die Körper hervorbringen, fiktionale Konstrukte sind, die umgeschrieben werden können.
Zu solch einer Umschreibung und Dekonstruktion der regulativen Ideen, die den normativen Diskursen der Psychoanalyse zugrunde liegen, möchte dieser Band einen Beitrag leisten.
Queer Theory – eine genealogische Annäherung
Der Begriff queer wurde in einem positiv affirmierenden Sinn bereits in den 1970er- bzw. 1980er-Jahren in Zusammenhang mit Homosexualität verwendet: Die ursprünglich abwertende und erniedrigende Attribution queer wurde – wie u. a. Judith Butler und Teresa de Lauretis beschreiben – von Lesben und Schwulen angeeignet, mit bejahenden, offenen und positiven Bedeutungen resignifiziert (vgl. Butler 1997: 307 u. de Lauretis 2017: 245). Ausgehend davon entstand Queer Theory zu Beginn der 1990er-Jahre beeinflusst durch postmoderne bzw. dekonstruktive und poststrukturalistische Diskurse, die u. a. Konzepte wie Wahrheit, Präsenz, Ursprung, Identität, Eindeutigkeit, Autonomie und Vernunft kritisch hinterfragen und die jene das „abendländische Denken“ prägenden binären Oppositionen, wie die hierarchische Gegenüberstellung von Norm/Abweichung, gesund/ pathologisch, Mann/Frau, aktiv/passiv, Mensch/Tier, Vernunft/Wahnsinn, heterosexuell/homosexuell, weiß/schwarz … dekonstruieren (vgl. Hutfless 2017).4
Vor allem Michel Foucaults Subjekt- und Machtkonzeption, die Macht nicht personalisiert, sondern strukturell als Subjekte hervorbringende und regulierende Kraft versteht, die in ihrer Wirkungsweise in alle Bereiche des Subjekts vordringt und Sexualität, Begehren und Identität diskursiv erzeugt, sich polymorph, d. h. über eine Vielzahl an Angriffsflächen und Diskursen, entfaltet und in der Widerstand als Teil des Spiels der Macht verstanden wird (vgl. Foucault 1983: 18 ff. u. 116; vgl. auch Watson 2017: 387; Dean 2017: 345), war für viele Queer-Theoretiker*innen ein wichtiger Ausgangspunkt ihrer Auseinandersetzung und Kritik an Identität, heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit und normativer Sexualität.
Teresa de Lauretis war die Erste, die den Begriff „Queer Theory“ zunächst als Titel für eine von ihr 1990 an der University of California, Santa Cruz organisierte Konferenz gewählt hat. Im Anschluss daran taucht der Begriff „Queer Theory“ im von ihr verfassten Vorwort der, ausgehend von dieser Konferenz herausgegebenen, Sondernummer des Journals differences auf (de Lauretis 1991; vgl. Halperin 2003; vgl. Jagose 2015): „‚Queer Theory‘ conveys a double emphasis – on the conceptual and speculative work involved in discourse production, and on the necessary critical work of deconstructing our own discourses and their constructed silences“ (de Lauretis 1991: iv). Unter Queer Theory versteht de Lauretis hier das Aufzeigen, Untersuchen und Dekonstruieren jener Diskurse und Rahmenbedingungen, die ein bestimmtes Subjekt in Zusammenhang mit sexueller Orientierung, Hautfarbe etc. erzeugen, um schließlich einen neuen diskursiven Horizont zu eröffnen und Subjekte, Körper, Sexualitäten etc. anders zu denken. Dennoch war die Queer Theory lange durch vielfache diskursive Leerstellen und Ausschlüsse gekennzeichnet, etwa die mangelnde Auseinandersetzung mit verschiedenen ineinandergreifenden Kategorisierungs- und Diskriminierungsformen jenseits von Geschlecht und Sexualität, etwa aufgrund von Rassismus, Klassismus, Ableismus etc. Heute werden postkoloniale und intersektionale Perspektiven zunehmend in queeren Diskursen berücksichtigt (vgl. u. a. Crenshaw 1989 u. 1991; Dietze et al. 2012; Collins/Bilge 2016; Lutz et al. 2013).
Das Einbringen des Begriffs queer in den akademischen Diskurs durch Teresa de Lauretis wurde, wie David Halperin zeigt, zunächst als skandalös empfunden (Halperin 2003: 340). Während Queer Theory von de Lauretis zuerst eher als „placeholder for a hypothetical knowledge-practice not yet in existence“ verstanden wurde, setzte relativ rasch ein sehr produktiver akademischer Diskurs ein; Queer Theory wurde zu einem sich zunehmend etablierenden Feld in akademischen Institutionen (ebd.: 340 f.). Dies birgt jedoch auch die Gefahr einer Entradikalisierung von queer in sich und, wie Halperin anmerkt, die Tendenz „to despecify the lesbian, gay, bisexual, transgender, or transgressive content of queerness, thereby abstracting ‚queer‘ and turning it into a generic badge of subversiveness, a more trendy version of ‚liberal‘“ (ebd.). Halperin möchte queer daher nicht einfach als neuen Begriff für „liberal“ verstanden wissen, zugleich führt seine Kritik an der „De-Spezifizierung“ von queer zurück zur Problematik eines Identitätsdiskurses, den er selbst an anderer Stelle ebenso kritisiert, wenn er schreibt:
„Queer is by definition whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. There is nothing in particular to which it necessarily refers. It is an identity without an essence. ‚Queer‘ then, demarcates not a positivity but a positionality vis-à-vis the normative … [Queer] describes a horizon of possibility whose precise extent and heterogeneous scope cannot in principle be delimited in advance“ (Halperin 1995: 62).
Die Tatsache, dass sich einerseits Gay and Lesbian Studies nie in akademischen Institutionen behaupten konnten, dies der Queer Theory jedoch relativ rasch gelungen ist, stimmt Halperin skeptisch (vgl. Halperin 2003). Auf der anderen Seite – und dies kann durchaus als Stärke der Queer Theory im akademischen Feld angesehen werden – schreibt sie sich als „Theorie“ bzw. als eine Assemblage an Theorien und nicht als „monolithische Disziplin“ in das akademische Feld ein und kann dadurch als kritisches und dekonstruktives Moment in allen akademischen Disziplinen „angewandt“ werden. Zugleich fragt Halperin kritisch danach, von wem Queer Theory angewendet werden kann und wird und ob hier nicht auch die Gefahr einer Assimilierung besteht und das eigentlich „Queere“ verloren zu gehen droht.
Kann Queer Theory also überhaupt angewendet werden oder handelt es sich nicht vielmehr um eine Haltung, um ein Fort- und Umschreiben, ein Ausstreuen, und nicht um etwas, das beschrieben und angewendet werden könnte? Diese Problematik teilt die Queer Theory mit der oben adressierten Derrida’schen Dekonstruktion, die auch nicht einfach „angewendet“ werden kann, denn die simple „Anwendung“ würde eine statische Fixierung, eine Objektivierung, ein Erstarren und schließlich den „Tod“ der Queer Theory bedeuten (vgl. dazu auch Derrida 2000: 13 ff.).
Lauren Berlant und Michael Warner schlagen daher vor, anstelle von Queer Theory eher von queer commentary zu sprechen. Queer Theory
„is not the theory of anything in particular; and has no precise bibliographic shape. […] Queer theory has flourished in the disciplines where expert service to the state has been least familiar and where theory has consequently meant unsettlement rather than systematization. This failure to systematize the world in queer theory does not mean a commitment to irrelevance; it means resistance to being an apparatus for falsely translating systematic and random violences into normal states, administrative problems, or minor constituencies“ (Berlant/Warner 1995: 344 u. 348).
Queer Theory5 hat dann eine Zukunft, wenn es uns gelingt, ihr kritisches Potenzial, d. h. ihr Potenzial, zu erschüttern, zu überraschen und das zu denken, was noch nicht gedacht wurde, immer wieder zu erneuern und aufs Neue zu (er-) finden (vgl. Halperin 2003: 343).
Anmerkungen
1Diese Aufzählung muss an dieser Stelle unabgeschlossen und für weitere Bedeutungshorizonte offen bleiben.
2Zur différance siehe u. a. Bennington/Derrida 1994; Derrida 1988; Gutting 2014; Reynolds/Roffe 2004. Zur Auseinandersetzung mit dem psychoanalytischen Ansätzen von Lacan siehe die Beiträge von Tim Dean, Lee Edelman, Eve Watson und Anne Worthington im hier vorliegenden Band.
3Wie Butler in Körper von Gewicht zeigt, ist die Materialisierung von geschlechtlichen Körpern nie ganz vollendet, kein Körper fügt sich je zur Gänze den vorgegebenen Normen. Die performative Wiederholung der Norm wird immer auch ein Stück weit verfehlt. Queere Momente sind daher allen geschlechtlichen Konstitutionen eigen (vgl. Butler 1997: 19 ff.)
4Die Dekonstruktion dieser Binaritäten, die Entessenzialisierung des Konzepts „Frau“, das Denken von „Frau“ als etwas, das es noch nicht gibt, das erst erfunden, aber auch immer wieder neu erfunden werden muss, findet sich bereits in feministischen Diskursen der 1970er-Jahre, etwa in den Arbeiten von Luce Irigaray und Hélène Cixous. Die feministischen Ansätze beider Theoretiker*innen – wobei Irigaray in ihrem späteren Werk oftmals erneut einen heteronormativen Diskurs reproduziert – verweisen auf viele Bereiche, die in Zusammenhang mit queer viel später wichtig geworden sind: das Denken vielfacher widersprüchlicher Identifizierungen, ein nicht-essenzialistisches Denken von Geschlecht, Geschlechter, die nicht konturiert und fixiert werden müssen, sondern sich unendlich fortschreiben (vgl. dazu Cixous 2013; Hutfless et al. 2013; Hutfless/Schäfer 2017; Hutfless 2017; Irigaray 1979).
5Zur weiteren Auseinandersetzung und Einführung in Queer Theory siehe u. a. Jagose 2001; Jagose 2015; Sullivan 2003.
Bibliografie
Bennington, Geoffrey/Derrida, Jacques (1994): Jacques Derrida: Ein Portrait. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Berlant, Lauren/Warner, Michael (1995): What Does Queer Theory Teach Us about X? In: PMLA, Jahrgang 110, Heft 3, S. 343-249.
Butler, Judith (1997): Körper von Gewicht: Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Butler, Judith (2009): Die Macht der Geschlechternormen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Cixous, Hélène (2013): Das Lachen der Medusa. In: Hutfless, Esther/Postl, Gertrude/Schäfer, Elisabeth (Hg.): Hélène Cixous: Das Lachen der Medusa zusammen mit aktuellen Beiträgen. Wien: Passagen Verlag, S. 39-61.
Collins, Patricia Hill/Bilge, Sirma (2016): Intersectionality. Cambridge: Polity Press.
Crenshaw, Kimberlé (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In: University of Chicago Legal Forum, S. 139-167.
Crenshaw, Kimberlé (1991): Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. In: Stanford Law Review, Heft 43, S. 1241-1299.
Dean, Tim (2017): Lacan und Queer Theory. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 345-375.
de Lauretis, Teresa (1991): Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction. In: differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Jahrgang 3, Heft 2, S. iii-xviii.
de Lauretis, Teresa (2017): Der queere Trieb: Rereading Freud mit Laplanche. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 211-255.
Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1992): Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie. Berlin: Merve.
Derrida, Jacques (1988): Die différance. In: ders.: Randgänge der Philosophie. Wien: Passagen Verlag, S. 29-52.
Derrida, Jacques (2000): As if I were dead. Als ob ich tot wäre. Wien: Turia + Kant.
Dietze, Gabriele/Haschemi Yekani, Elahe/Michaelis, Beatrice (2012): Intersektionalität und Queer Theory. Abrufbar unter: http://portal-intersektionalitaet.de/uploads/media/Dietze_HaschemiYekani_Michaelis_01.pdf (Zugriff: 25. August 2017).
Eng, David L./Halberstam, Jack (Judith)/Muñoz, José Esteban (2005): What’s Queer about Queer Studies Now? Introduction. In: Social Text 84–85, Jahrgang 23, Heft 3-4, S. 1-17.
Foucault, Michel (1983): Der Wille zum Wissen: Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Gutting, Gary (2014): The Obscurity of „Différance“. In: Direk, Zeynep/Lawlor, Leonard (Hg.): A Companion to Derrida. Malden: John Wiley & Sons, S. 73-88.
Halperin, David (1995): Saint Foucault: Toward a Gay Hagiography. Oxford: Oxford University Press.
Halperin, David (2003): The Normalization of Queer Theory. In: Journal of Homosexuality, Jahrgang 45, Heft 2/3/4, S. 339-343.
Hutfless, Esther (2017): Jenseits der Binarität: Psychoanalyse und Queer Theory. Unveröffentlichter Vortrag, gehalten auf der Tagung Psychotherapie und Feminismus – eine (Wieder-)Annäherung des Instituts Feministischer Psychotherapiewissenschaften, 5. Mai 2017, Depot, Wien. Eine überarbeitete Version des Vortrags wird 2018 in der Zeitschrift Psychologie & Gesellschaftskritik erscheinen.
Hutfless, Esther/Schäfer, Elisabeth (Hg.) (2017): Hélène Cixous. Gespräch mit dem Esel: Blind schreiben. Wien: Zaglossus.
Hutfless, Esther/Postl, Gertrude/Schäfer, Elisabeth (Hg.) (2013): Hélène Cixous: Das Lachen der Medusa zusammen mit aktuellen Beiträgen. Wien: Passagen Verlag.
Irigaray, Luce (1979): Das Geschlecht das nicht eins ist. Berlin: Merve.
Jagose, Annamarie (2001): Queer Theory: Eine Einführung. Berlin: Querverlag.
Jagose, Annamarie (2015): The Trouble with Antinormativity. In: differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Jahrgang 26, Heft 1, S. 26-47.
Lutz, Helma; Herrera Vivar, María Teresa; Supik, Linda (Hg.) (2013): Fokus Intersektionalität: Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzepts.Wiesbaden: Springer.
Lyotard, Jean-Francois (1993): Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? In: Engelmann, Peter (Hg.): Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Stuttgart: Reclam, S. 33-48.
Muñoz, José Esteban (2009): Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press.
Reynolds, Jack/Roffe, Jon (Hg.) (2004): Understanding Derrida. New York: Continuum.
Sullivan, Nikki (2003): A Critical Introduction to Queer Theory. New York: New York University Press.
Watson, Eve (2017): Queering Psychoanalysis und Psychoanalysing Queer. In: Hutfless, Esther/Zach, Barbara (Hg.): Queering Psychoanalysis: Psychoanalyse und Queer Theory – Transdisziplinäre Verschränkungen. Wien: Zaglossus, S. 377-419.
Zeillinger, Peter (2002): Nachträgliches Denken: Skizze eines philosophisch-theologischen Aufbruchs im Ausgang von Jacques Derrida. Münster: LIT Verlag.
Von Bisexualität zu Intersexualität
Geschlechterkategorien neu denken1
Jack Drescher Aus dem Englischen übersetzt und aktualisiert von Esther Hutfless Unter Mitarbeit von Nicole Alecu de Flers und Katja Langmaier
Während meines Medizinstudiums, als ich den Turnus in der gynäkologischen Abteilung absolvierte, wurde ich gebeten, die Krankengeschichte eines 16-jährigen Mädchens zu erheben. Bevor ich ihr begegnete, las ich ihre Krankenakte und erfuhr, dass die Patient*in an einer genetisch bedingten Androgenresistenz (androgen insensitivity syndrome – AIS) litt, was ihr selbst jedoch nicht bekannt war. Zwar im Besitz der männlichen XY-Chromosomen sind die sich entwickelnden Zellen eines Fötus mit Androgenresistenz jedoch unempfänglich gegenüber den Vermännlichungs-Effekten, die durch die von den eigenen Hoden produzierten Androgenen für gewöhnlich ausgelöst werden. Infolgedessen ist das äußere Erscheinungsbild von betroffenen Neugeborenen dasjenige eines Mädchens.2 Im Falle dieser Patient*in waren die Hoden hochstehend und wurden gleich nach der Geburt entfernt.
Laut Krankenakte war die Patient*in als Mädchen großgezogen worden. Um den Erfolg dieses Unterfangens nicht zu gefährden und weil es die medizinisch empfohlene Vorgehensweise in solchen Fällen war (Money/Ehrhardt 1996; Colapinto 2000), war die Patient*in nie über die ihre Geburt begleitenden Umstände aufgeklärt worden. Ihre medizinische Akte enthielt, sowohl innen als auch auf dem Umschlag, zahlreiche Warnungen, dass wer immer diese las, unter gar keinen Umständen mit der Patient*in über ihre ursprüngliche Veranlagung sprechen dürfe. Ausgerechnet mir, einem völlig Fremden, der ihr auch niemals wieder begegnen würde, wurde diese persönliche Information anvertraut.3
Das Gespräch war eines meiner ersten klinischen Interviews überhaupt mit einer „lebenden“ Patient*in; ängstlich stellte ich eine grundlegende Frage zur gynäkologischen Krankengeschichte: „Wann hatten Sie Ihre letzte Monatsblutung?“ Sie entgegnete eisig: „Ich habe keine.“ „Natürlich hat sie keine Monatsblutungen“, dachte ich bei mir, „sie hat keinen Uterus. Wie konnte ich nur so blöd sein, ihr diese Frage zu stellen?“ Ich fühlte mich schuldig und war verlegen. Später begriff ich, dass ich bei diesem „interessanten Fall“ nicht der erste neugierige Medizinstudent war, der diese Patient*in so stümperhaft zu ihrer gynäkologischen Krankengeschichte befragte.
Die Patient*in war sich im Klaren, dass sie ohne Uterus geboren war, erklärte jedoch, dass sie nichtsdestotrotz Mutter werden könne, wenn sie beschließen würde, zu heiraten und Kinder zu adoptieren. Sie sah sich selbst als junge Frau*, so wie ich es auch tat. Medizinisch wurde sie jedoch als männlicher Pseudo-Hermaphrodit bezeichnet. Männlich, weil sie mit Hoden geboren worden war, pseudo-, als Gegensatz zu einem „echten“ Hermaphroditen, weil sie zwar Hoden, aber keine Ovarien besaß. Was bedeutete das alles aus einer klinischen Perspektive? Der Oberarzt, dem ich nach dem Gespräch mit der Patient*in berichten sollte, scherzte damals: „Ein gutaussehender Kerl, was?“ Ich fühlte mich noch immer schuldig in Anbetracht meines Fauxpas und fand die Anmerkung nicht sehr erheiternd. Nichtsdestotrotz waren unsere Reaktionen vermutlich typisch für Rückmeldungen, die Begegnungen mit Menschen, die nicht unseren konventionellen Erwartungen von „männlich“ und „weiblich“ entsprachen, hervorriefen.
Die Forschung zu sexuellen Identitäten [sexual identities] verändert sich. Diese Veränderungen fordern Analytiker*innen geradezu zwingend heraus, über Geschlecht und Sexualität in einer Weise nachzudenken, wie es unsere psychoanalytischen Vorgänger*innen niemals vorhergesehen hätten. Diese Veränderungen erfordern außerdem, dass wir uns der durch unsere eigenen theoretischen Traditionen auferlegten Beschränkungen bewusst sind. Aus diesem Grund beginne ich diesen Artikel mit einer Definition von Begrifflichkeiten, auf die eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Grundannahmen folgt, die der Theorie der Bisexualität im Sinne Freuds zugrunde liegen. Der darauffolgende Abschnitt führt in die Funktion von Kategorien und Hierarchien im Allgemeinen und in die klinische Bedeutung von sexuellen Hierarchien im Besonderen ein. Daran anschließend werde ich die Bedeutungen und die Verwendung des Konzepts von „Natürlichkeit“ diskutieren. Der letzte Abschnitt des Beitrags schließt mit einer Diskussion von Intersexualität als Beispiel für sowohl die soziale als auch die chirurgische Konstruktion von Gender.
Begriffsklärung
In den letzten Jahren wurden Arbeiten zu Themen, die lesbische, schwule, bisexuelle und transgender (LGBT) Personen betreffen, zunehmend unter dem Sammelbegriff Queer Theory4 zusammengefasst. Anknüpfend an die vorangegangenen Arbeiten von Feminist*innen (de Beauvoir 1952; Friedan 1963; Dinnerstein 1976; Chodorow 1978) und jene aus dem Bereich der Gay and Lesbian Studies (Abelove et al. 1993) hinterfragt Queer Theory die impliziten Vorannahmen, die den konventionellen, binären Kategorien wie „Männlichkeit/Weiblichkeit“ oder „Homosexualität/Heterosexualität“ zugrunde liegen. Autor*innen der Queer Theory bemühen sich meist darum, diese als repressiv verstandenen kulturellen Normen zu hinterfragen, indem sie die impliziten Vorannahmen, auf denen diese Normen gründeten, dekonstruieren (Foucault 1978; Rubin 1984; Butler 1990; Sedgwick 1990). Während Queer-Theoretiker*innen die Position vertreten, dass sich Identitäten (einschließlich – jedoch nicht allein – sexueller Identitäten) nicht ausgehend von biologischen (essenzialistischen) Faktoren herausbilden, legen sie in ihren Arbeiten besonderes Augenmerk auf die Art und Weise, wie Identitäten durch Geschichte, Sprache und Konventionen sozial konstruiert werden. Queer Theory zu definieren stellt an sich einen paradoxen Akt dar, handelt es sich doch um eine Disziplin, die danach trachtet, allzu bequeme und herkömmliche Definitionen zu destabilisieren. Nichtsdestotrotz ist es zunächst notwendig zu verstehen, wie bestimmte Kategorien überhaupt definiert sind, bevor man nachvollziehen kann, wie diese konstruiert wurden. Das folgende Glossar von Begrifflichkeiten kann den Leser*innen im Hinblick auf das Verständnis der sozialen Konstruktion von Geschlecht [gender] und Sexualität dienlich sein.
Sexuelle Orientierung bezieht sich auf die erotische Reaktionstendenz oder sexuelle Attraktion einer Person, je nachdem kann diese homosexuell, bisexuell oder heterosexuell sein (Kinsey et al. 1948; Kinsey et al. 1953; für weiterführende Diskussionen siehe auch: Drescher et al. 2005). Die sexuelle Orientierung kann anhand von Parametern wie dem Verhältnis von Träumen und Phantasien in Bezug auf das eine oder das andere Geschlecht, das Geschlecht der Sexualpartner*innen und das Ausmaß der physiologischen Reaktion auf erotische Stimuli, die mit einem oder beiden Geschlechtern in Verbindung gebracht werden können, bemessen werden.
Die Begriffe schwul, lesbisch und bisexuell bezeichnen sexuelle Identitäten [sexual identities] und beziehen sich auf Männer* und Frauen*, die – bis zu einem gewissen Grad – offen ihre homo- oder bisexuellen Affinitäten anerkennen. Schwul oder lesbisch zu sein ist nicht dasselbe, wie ein/e Homosexuelle/r zu sein. Letzteres stellt – meist abwertend konnotiert – einen medizinischen Begriff dar, der einen Aspekt einer persönlichen Identität – die sexuelle Anziehung – behandelt, als stünde er für die Gesamtheit einer persönlichen Identität (Magee/Miller 1997). Sexuelle Identität und sexuelle Orientierung sind nicht dasselbe. Darüber hinaus können die eigene sexuelle Orientierung und die sexuelle Identität von der eigenen Sexualität bzw. vom sexuellen Verhalten unterschieden werden. Zum Beispiel hat jemand, der sich als „enthaltsamer schwuler Priester“ identifiziert, eine homosexuelle Orientierung, eine schwule sexuelle Identität, nimmt jedoch von sexuellem Verhalten Abstand. Männer*, die unter die Beschreibung Männer*, die Sex mit Männern* haben (MSM) fallen, können schwul sein oder aber sich selbst nicht notwendigerweise als schwul oder gar homosexuell verstehen. Jemand mit heterosexueller Orientierung zum Beispiel kann homosexuelle Handlungen vollziehen und sich niemals anders als heterosexuell identifizieren. Diese Beispiele illustrieren, wie Kategorien und Klassifizierungssysteme subjektiven Erfahrungen, was Homosexualität bedeutet, entgegenstehen können.
Während sex sich für gewöhnlich auf die biologischen Attribute des Mann*- oder Frau*-Seins bezieht, bezieht sich gender – das oftmals als gekoppelt an „sex“ verstanden wird – auf die psychologischen und sozialen Attribute des biologischen Geschlechts. Geschlechtsidentität [gender identity] bezeichnet eine anhaltende Wahrnehmung von sich selbst als männlich oder weiblich (Money/Ehrhardt 1996; Stoller 1968). In der Vergangenheit gingen Psychoanalytiker*innen in ihrem Versuch, Homosexualität zu fassen, von einer Konfusion der Geschlechtsidentität aus, die in weiterer Folge zu einer Verwirrung darüber führe, von welchem Geschlecht man sich angezogen fühlte. Die Geschlechterrolle [gender role] bezieht sich auf das öffentlich an den Tag gelegte geschlechtsspezifische soziale Verhalten, das die eigene soziale Position als Zugehörige*r zum einen oder anderen Geschlecht – sowohl für eine*n selbst als auch für andere – begründet (Kohlberg 1966). Die Geschlechterrolle repräsentiert die Wahrnehmung des Vermögens einer Person, sich so zu verhalten, wie es ein Mann* oder eine Frau* für gewöhnlich in der Öffentlichkeit tun sollte. Während die Geschlechtsidentität die innere, subjektive Erfahrung von Mann*- bzw. Frau*-Sein beschreibt, stellt die Geschlechterrolle die äußere Markierung von Männlichkeit, Weiblichkeit oder Androgynität dar.
Die Geschlechterstabilität [gender stability] ist an die Annahme gebunden, dass es für das Bewusstsein des Kindes evident ist, dass jenes Geschlecht, mit dem es geboren wird, das ganze Leben hindurch das gleiche bleibt; das bedeutet, dass Mädchen als Mädchen geboren werden und zur Frau* heranwachsen und Jungen zu Männern* heranwachsen. Die Geschlechtskonstanz [gender constancy] bezieht sich auf die Einsicht des Kindes, dass äußere Veränderungen des Aussehens oder von Aktivitäten und Tätigkeiten nicht das eigene Geschlecht verändern (Kohlberg 1966). Ein Junge zum Beispiel lernt, dass er ein Junge bleibt, auch wenn er sein körperliches Erscheinungsbild verändert, indem er ein Kleid anzieht oder sich die Haare lang wachsen lässt.
Geschlechtervorstellungen [gender beliefs] (Drescher 1998) stellen kulturelle Ideen über die essenziellen Eigenschaften von Männern* und Frauen* dar. Diese Vorstellungen finden in alltäglicher Sprache in Bezug auf die geschlechtlichen Bedeutungen menschlichen Tuns Ausdruck.
Transsexualität beinhaltet eine starke und anhaltende gegengeschlechtliche Identifizierung und ein Leiden am zugeschriebenen Geschlecht (Geschlechtsdysphorie), was zu dem Wunsch, die Merkmale des anderen Geschlechts zu erlangen, und nach geschlechtsangleichenden Operationen führen kann. Einige Trans*-Personen vollziehen durch das Tragen von Kleidung und Accessoires oder durch die Einnahme von Hormonpräparaten zur Erlangung der sekundären Geschlechtsmerkmale des anderen Geschlechts eine teilweise Transition5 (Blanchard 1993a und b). Personen, die bei der Geburt als männlich eingetragen wurden und eine Transition zur Frau* durchlaufen, bezeichnen sich oft als Trans*-Frauen. Personen, die bei der Geburt als weiblich eingetragen wurden und eine Transition zum Mann* durchlaufen, als Trans*-Männer. Gegengeschlechtliche Identifizierungen geben jedoch keinen Hinweis auf die mögliche sexuelle Orientierung einer Trans*-Person.6
Transgender ist ein Sammelbegriff und beinhaltet sowohl Transsexuelle als auch Personen mit Gender-Dysphorie, die keinen vollständigen Geschlechtswechsel vollziehen. Zudem gibt es auch die Diagnose des Transvestitismus.7
Intersexualität wurde früher als Hermaphroditismus bezeichnet. In den Worten der Organization Intersex International (OII) werden Intersex-Personen „mit Geschlechtmerkmalen geboren, die nicht in die typischen, binären Vorstellungen von männlichen oder weiblichen Körpern passen“8. Oder in den Worten von Intersex-Aktivist*innen der Intersex Initiative:
„Intersex-Personen sind mit äußeren Genitalien, inneren Reproduktionsorganen und einer möglichen endokrinen Organisation geboren, die sich von denen der meisten anderen Menschen unterscheiden. Es gibt nicht den ‚intersexuellen Körper‘ schlechthin; Intersexualität umfasst eine große Vielfalt an Gegebenheiten, die nichts gemein haben, außer dass sie von der Gesellschaft als ‚abnormal‘ angesehen werden. Was Intersex-Personen verbindet, sind ihre Erfahrungen mit Pathologisierung und Medikalisierung, nicht die Biologie. Intersexualität stellt keine Identität dar. Während einige Personen Intersexualität sehr wohl als Teil ihrer Identität beanspruchen, stellt Intersexualität keine frei wählbare Geschlechterkategorie dar. […] Die meisten Intersex-Personen definieren sich selbst als Mann* oder Frau*“ (Website Intersex Initiative, FAQ).9
Bisexualität: Tea for Two?
Die Molekular-Biologin Anne Fausto-Sterling hat ihren berühmt gewordenen Aufsatz provokant mit „The Five Senses: Why Male and Female Are not Enough“ (1993) betitelt. In ihrem Kategorisierungskonzept hat Fausto-Sterling das anatomisch Weibliche und Männliche als die beiden entgegengesetzten Enden eines Kontinuums platziert. Innerhalb dieses Kontinuums gibt es einen Übergang von Männern* zu männlichen Pseudohermaphroditen (Sterling bezeichnet sie als Merms); in der Mitte des Kontinuums finden sich echte Hermaphroditen; dann kommen weibliche Pseudohermaphroditinnen (sogenannte Ferms) und schließlich Frauen*.10





























