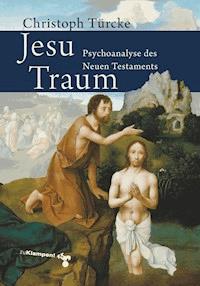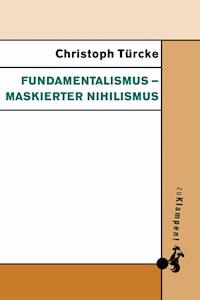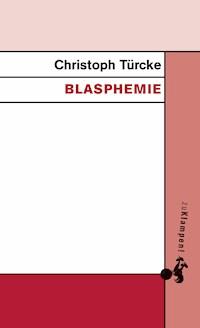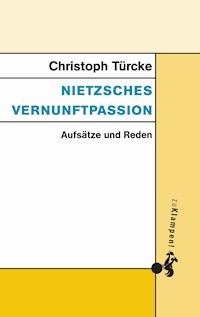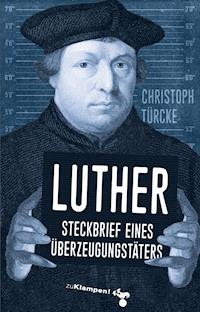11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Parlamenten und Betrieben, in Vorständen, Parteien und Universitäten – wo die Frauenquote nicht schon gilt, soll sie bald kommen. Aber noch bevor sie flächendeckend durchgesetzt ist, ist sie bereits überholt. Denn steht Diversen, People of Color, Juden, Muslimen, Menschen mit Behinderung nicht ebenso eine paritätische Vertretung zu wie Frauen? Wie die jüngere Frauen- und Queer-Bewegung ist auch der neue Antirassismus in erster Linie auf Parität aus. Gleichstellung gilt nicht als der Zustand, in dem man frei davon wird, länger auf die Verschiedenheit von Ethnie, Hautfarbe und sexueller Orientierung zu starren, sondern als der, in dem sie maximal sichtbar werden. Die basisdemokratische Gleichstellungsbewegung läuft auf immer kleinteiligere Kämpfe um Sichtbarkeit, Quoten und Finanzmittel hinaus. Und eine Sprache, die stets alle sichtbar machen soll, versinkt in Sprachverwirrung. Ein neues Stadium gesellschaftlichen Zerfalls kündigt sich an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christoph Türcke
Quote, Rasse, Gender(n)
Demokratisierung auf Abwegen
Eine Vorform des Abschnitts »Quote« erschien unter dem Titel »Lobby- demokratie« in Heft 858 (November 2020) der Zeitschrift Merkur.
© 2021 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Umschlaggestaltung: Martin Z. Schröder · Berlin
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH · Rudolstadt
ISBN Print 978-3-86674-810-1
ISBN E-Book-Pdf 978-3-86674-914-6
ISBN E-Book-Epub 978-3-86674-913-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
Quote
Rasse
Rassismus
Verneinung
Schwarze Vernunft
Kapitalismus-Genese
Black lives matter
Antisemitismus
Xenophobie
Gender(n)
Sprachzerfall
Naturmetaphysik
Dank
Der Autor
Weitere Bücher von Christoph Türcke
Endnoten
Einleitung
»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«, sagt das deutsche Grundgesetz. Doch wer ist dieses »Volk«? Dass ihm Personen jeden Geschlechts, die in einem Land dauerhaft wohnen, ab einem Mindestalter zuzurechnen sind, leidet keinen Zweifel. Aber wann ist das Mindestalter erreicht, was heißt »dauerhaft wohnen« und ab wann trifft Letzteres auch auf Migranten, Flüchtlinge, Asylanten zu? Das ist nach wie vor strittig. Zwar gilt als unhintergehbarer demokratischer Standard, dass das Volk das Parlament wählt und dieses die Regierung, während ein oberstes Gericht darüber wacht, dass Parlament und Regierung verfassungsgemäß handeln. Aber wann hat das Parlament zu viel Befugnisse, so dass die Regierung handlungsunfähig wird, wann zu wenig, so dass sie selbstherrlich walten kann? Wann wacht das oberste Gericht lediglich über die Verfassung, wann beginnt es, sie als Hebel zu nutzen, um selbst politisch einzugreifen? Diese Fragen flammen in jedem Konfliktfall neu auf. Das rechte Maß demokratischer Kontrolle und Ausgewogenheit ist bis heute nicht erreicht.
»Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter?«, fragte Immanuel Kant 1783 und antwortete: »Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.«1 Entsprechend gilt heute: Wir leben nicht im Zeitalter der Demokratie; günstigstenfalls in einem der Demokratisierung. Die aber ist ständig von Rückschlägen bedroht. Längst wurde von »Postdemokratie«2 gesprochen: vornehmlich im Hinblick auf die globalen Finanzmärkte, bei denen sogar die vergleichsweise reichen und demokratieaffinen westlichen Staaten dermaßen verschuldet sind, dass ihre Regierungen und Parlamente immer mehr Entscheidungsspielraum verlieren. Durch »Schuldenbremsen« versuchen sie, gegenzusteuern – und sind nun durch die Coronapandemie zu horrenden Neuverschuldungen genötigt, deren Langzeitfolgen für die Finanzierbarkeit von Gesundheits- und Bildungssystem, von Sicherheitskräften und Verkehrsinfrastruktur noch ganz unabsehbar sind. Wenn die privaten Gläubiger dieser Billionensummen den Geldhahn zudrehen oder Börsenrallyes auf Staatsbankrotte anzetteln, dann können die parlamentarischen Entscheidungsprozesse noch so demokratisch angelegt sein; sie laufen leer. Gleichwohl lässt das Wort »Postdemokratie« einen irreführenden nostalgischen Ton mitschwingen, als ob es, ehe sich die Finanzmärkte in den 1970er Jahren auftaten, irgendwo auf dem Globus eine rundum intakte Demokratie gegeben hätte. Genau genommen sind auch die demokratieaffinsten Staaten nie mehr als »Prädemokratien« gewesen – nirgends weiter gekommen, als der kapitalistische Weltmarkt es zuließ.
Vom Weltmarkt ist allerdings fast nur noch in Nachrichten zum Stand der Börsen und der globalen Lieferketten die Rede, kaum mehr im Demokratiediskurs. Den fesseln heute entschieden kleinteiligere Formate, die erst das Internet mit sich gebracht hat. Ermöglicht es doch jedem, mit ein paar Klicks ganze Datensätze »ins Netz zu stellen« und sich direkt öffentlich zu artikulieren – vorbei an allen Volksvertretungen, Regierungen, Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehenanstalten; vorbei an allen Repräsentanten und Vormündern, die sich für entscheidungsbefugt darüber halten, ob das, was öffentlich artikuliert wird, auch öffentlichkeits-würdig ist. Seither gibt es neue Formen politischer Direktmanifestation. Gern nennt man sie basisdemokratisch; etwa wenn sich Menschen bemerkbar machen und Beachtung verlangen, die in Parteiprogrammen und öffentlichen Diskursen zuvor gar nicht vorkamen; Menschen, die anders sind als die Mehrheit: andere Hautfarben, andere sexuelle Orientierungen, andere Konfessionen, andere kulturelle Gepflogenheiten, andere Bedürfnisse aufgrund von Behinderungen haben. Noch nie konnten sie sich so nachdrücklich und vielfältig öffentlich artikulieren wie zu Internetkonditionen. Doch seit sie das können, gibt es auch einen Unmutsdiskurs darüber, wie wenig sie das können, wie sehr der neue Weg der Direktmanifestation, auf dem nun jeder so ziemlich alles Beliebige »ins Netz stellen« darf, ihre besonderen Belange untergehen lässt. Was nützen ihnen die technischen Mittel zur öffentlichen Direktartikulation, solange sie damit nicht durchdringen, solange ihr Anderssein nicht gebührend respektiert wird, solange Parteien und Parlamente es nicht durch rechtliche Gleichstellungsmaßnahmen schützen, die es »sichtbar« machen?
Wie Coca-Cola einen besonderen Durst nach Coca-Cola erzeugt, so das neue Gleichstellungsmedium einen besonderen Durst nach sichtbarer Gleichstellung. Internetgestützte Basisdemokratie läuft auf eine Politik der Gleichstellung der gesamten Minderheitenvielfalt hinaus. Sie geht mit einer neuen Utopie schwanger. In dem Maße, wie in Parlamente, Regierungen, Unternehmensleitungen, Gewerkschaften, Aufsichtsräte, Akademien, Polizeidirektionen, Offizierscorps und Börsen eine paritätische Geschlechts- und Minderheitendiversität einzieht, hören Benachteiligung und Ausgrenzung auf, schwindet die binäre patriarchale Weltordnung, wächst die Vielfalt, gleicht sich die Gesellschaft demokratisch aus, entstehen »diskriminierungsfreie Räume«. Was kümmert da noch der Weltmarkt oder der Klimawandel, den der Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum vorantreibt? Auch sie werden sich durch Paritätsverhältnisse moderieren lassen, in denen die Andersheit der anderen respektiert und niemand mehr »abgewertet« wird.
Eine geradezu biedermeierliche Utopie in digitalem Gewand, diese diskriminierungsfreie Paritätsdemokratie. Doch wie soll man in einer komplexen Gesellschaft Paritäten feststellen? Man wird leider nicht umhinkommen, sie auszurechnen – sie wohl oder übel gegeneinander aufzurechnen. Spätestens dabei wird es ungemütlich. Soll nur das Quantum der Betroffenen zählen oder auch die Schwere und die zeitliche Länge ihrer Benachteiligung? Jede Berechnung fußt auf Bewertungen, die man auch anders gewichten könnte. Jedes Verfahren der Paritätsermittlung beflügelt den Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, Einfluss und finanzielle Zuwendung. Unterm Strich stehen dann Prozentzahlen: Quoten. Bei ihnen setzt dieses Büchlein an. Angeblich schaffen sie mehr Gerechtigkeit und festigen das demokratische Fundament der Gesellschaft. Dabei tun sie eher das Gegenteil.
Quote
Gleichstellungsbeauftragte gibt es reichlich. Aber kommt die Gleichstellung der Geschlechter auch gut voran? Daran zweifelt neuerdings sogar eine starke Strömung in der CDU. Eine Bundeskanzlerin, mehrere Ministerinnen, eine Parteivorsitzende – das genügt ihr nicht mehr, zumal nicht gewiss ist, ob mit den ausschließlich männlichen Bewerbern um das Erbe von Angela Merkel das Rad nicht wieder zurückgedreht wird. Erst wenn bis hinunter auf die kommunale Ebene alle Parteifunktionen und -ämter zur Hälfte mit Frauen besetzt sind, könne von durchgesetzter Gleichstellung die Rede sein. Das sagen auch immer mehr einflussreiche Männer in der Partei. Sie freunden sich mit der Fünfzig-Prozent-Frauenquote an. Deren Einführung ist kaum mehr aufzuhalten.
Andere sind da längst weiter. Die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung hat ein Paritätsgesetz erlassen. Es besagt: Bei Landtagswahlen muss jede Partei auf ihren Kandidatenlisten immer abwechselnd einen Mann und eine Frau aufführen (»Reißverschlussprinzip«). Wenn sich nicht genügend Kandidatinnen finden, bleiben die entsprechenden Listenplätze leer. Nur so bekommen die Parteien den nötigen Druck, Frauen gleichzustellen. Prompt hat die AfD gegen dieses Gesetz geklagt. Ganz offen gibt sie zu, nicht genügend Kandidatinnen für die Wahllisten zu haben. Sie sieht sich dadurch benachteiligt und in ihrer Betätigungs- und Programmfreiheit als Partei eingeschränkt. Brisant: Eine männerdominierte Partei, die keinerlei ernsthafte Anstalten macht, ihren Frauenanteil zu erhöhen, reklamiert Chancengleichheit für sich. Und der Thüringer Verfassungsgerichtshof gibt ihr Recht! Parteien seien »frei, das Personal zu bestimmen, mit dem sie zu einer Wahl antreten wollen« – ohne Ansehen des Geschlechts. Auch das Recht, sich zur Wahl zu stellen, dulde keine Kontingentierung von Listenplätzen nach Geschlechterparität.
So urteilte im Juli 2020 ein Gericht aus sieben Männern und zwei Frauen. Die beiden Frauen und ein Mann gaben zwar ein Minderheitsvotum ab. Das Paritätsgesetz habe lediglich »die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik« »durch begünstigende Regelungen ausgeglichen«, indem es »die Chancengleichheit von Männern und Frauen fördere, aber nicht ein paritätisch besetztes Parlament garantiere«.3 So habe es nach wie vor die Verteilung der Direktmandate nach Wählerstimmen vorgesehen, nicht nach Paritätsgesichtspunkten. Doch die Mehrheit von sechs Männern teilte die Sicht der AfD. Deren Thüringer Landesvorsitzender Björn Höcke, der Exponent jenes Partei-»Flügels«, der wegen vielfach aktenkundiger rechtsextremer Programmatik unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, durfte die Entkräftung eines Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung genüsslich als Sieg der Demokratie verbuchen. Wenige Monate später, im Oktober, gab auch in Brandenburg das Landesverfassungsgericht dem Einspruch von NPD und AfD gegen das ›Reißverschluss‹-Paritätsgesetz statt, das die rot-rot-grüne Mehrheit im Potsdamer Landtag durchgesetzt hatte – mit den gleichen Argumenten. Schließlich wies im Februar 2021 das Bundesverfassungsgericht die Klage einer Gruppe von Frauen ab, die die Gültigkeit der Bundestagswahl 2017 wegen fehlender Paritätsregeln bestritt. In all diesen Gerichten sind Frauen in der Minderheit. Könnte das parteiübergreifende Komplott weißer Männer offensichtlicher sein?
Nicht aus der Perspektive derjenigen, die in flächendeckender paritätischer Besetzung von Funktionen und Posten die Vollendung der Gleichstellung sehen – und das grundsätzliche Dilemma ignorieren, in dem der Begriff der Gleichheit steckt. Dass alle Menschen gleich seien, widerspricht jeglichem Augenschein. Jeder ist anders als die anderen und nur deshalb ein Individuum. Gleichheit gibt es immer nur in bestimmter Hinsicht: etwa des Alters, des Geschlechts, der Sprache, Ethnie, Hautfarbe, Nation, Religion, sozialen Klasse etc. Gleichheit als Menschenrecht ist zwar eine große, nicht wieder preiszugebende Errungenschaft, aber auch bloß eine Hinsicht. Sie besagt: Die Menschen eines Gemeinwesens mögen noch so verschieden sein, was Körperbeschaffenheit, Tätigkeit, Bildung, Einkünfte oder Lebensqualität betrifft. Als seine Bürger »sind sie vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.«
Wer hätte gedacht, dass es um diese schlichten Worte aus Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes (GG) einmal große Auslegungsdebatten geben würde? Heißt Gleichheit nicht eindeutig gleicher Zugang zu allem, was allen rechtlich zusteht: zu Bildung, Pflege, medizinischer Behandlung, öffentlichen Transport- und Kommunikationsmitteln, zu allen Konsumgütern, Wohnungen, Reisezielen, die man erschwingen kann, zu allen Berufen, für die man geeignet ist, zu allen Parteien, Vereinen, Glaubensgemeinschaften, die verfassungsgemäß sind? Diese kleine Aufzählung zeigt schon, wo der Haken ist. Nicht alle Weltanschauungen sind verfassungsgemäß; nicht alle Menschen sind für alle Tätigkeiten geeignet; nicht alle können alles erschwingen. Der Tochter der alleinerziehenden Verkäuferin und dem Sohn des Rechtsanwaltsehepaars stehen zwar das gleiche Schulsystem und die gleiche Berufswelt offen. Doch nur in den seltensten Fällen werden sie in der Lage sein, ihre rechtlich gleichen Chancen in gleicher Weise zu nutzen. Gleichberechtigung ist nicht schon Gleichstellung. Deswegen sind Gleichstellungsbeauftragte so wichtig, die darüber wachen, dass im Berufsalltag Frauen tatsächlich nicht benachteiligt oder belästigt werden und niemand unter seiner sexuellen Orientierung zu leiden hat. Auch in den Schulen gibt es so etwas wie Gleichstellungsbeauftragte: Förderlehrer, die sich lernschwachen Kindern aus prekären Verhältnissen widmen und deren soziale Benachteiligung so gut wie möglich auszugleichen versuchen.
Doch beim Übergang von der Gleichberechtigung zur Gleichstellung bleibt immer eine Lücke. Nur zum Teil kann sie rechtlich gefüllt werden: etwa durch Gesetze, die Gewalt in Ehe und Partnerschaft, Mobbing in Betrieben und Einrichtungen ahnden oder durch Bestimmungen, die bei Bewerbungen für einen Job im Falle gleicher Qualifikation die Bewerberin dem Bewerber vorziehen. Letzteres ist bereits grenzwertig. Bezieht sich Artikel 3 GG doch auf Individuen, nicht auf Gruppen. Dass, nachdem Frauen jahrhundertelang benachteiligt waren, nun auch mal einige von ihnen bevorzugt werden sollen, ist zwar ein verständlicher Wunsch. Doch ausgleichende Gerechtigkeit kann nicht in alternativer Rechtsbeugung bestehen. Der Mann, der leer ausgeht, obwohl er nicht minder qualifiziert war als seine Mitbewerberin, hat Anlass, sich wegen seines Geschlechts benachteiligt zu fühlen. Geschickte Auswahlbeauftragte regeln das Problem so, dass sie die ausgewählte Person für die geeignetste erklären. Qualifikation ist ein dehnbarer Begriff.