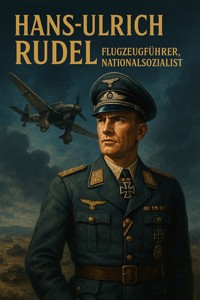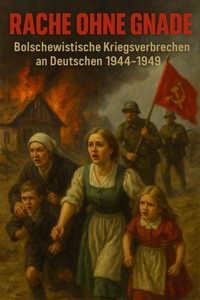
Rache ohne Gnade – Bolschewistische Kriegsverbrechen an Deutschen 1944–1949 E-Book
Dr. Markus Steinberg
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Vergessene Opfer – Die Wahrheit über die sowjetischen Kriegsverbrechen an Deutschen" Das Ende des Zweiten Weltkriegs markierte nicht nur den Sieg über den Nationalsozialismus, sondern auch den Beginn eines dunklen Kapitels deutscher Geschichte, das lange verschwiegen wurde: die systematischen Kriegsverbrechen der Roten Armee an der deutschen Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenen. Dieses Buch enthüllt die brutale Realität von Massenvergewaltigungen, Massakern, Plünderungen und unmenschlicher Gefangenschaft – Verbrechen, die im Schatten des Sieges jahrzehntelang vergessen wurden. Dr. Markus Steinberg zeichnet in umfassender und unverblümter Weise das Leid der deutschen Opfer nach, setzt es in den Kontext internationalen Rechts und fordert eine ehrliche, multiperspektivische Erinnerungskultur. Ein unverzichtbares Werk für alle, die der Wahrheit verpflichtet sind und eine gerechte Würdigung aller Kriegsschicksale suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Markus Steinberg
Rache ohne Gnade – Bolschewistische Kriegsverbrechen an Deutschen 1944–1949
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
EINLEITUNG
Kapitel 1: Der Weg zur Katastrophe
Kapitel 2: Der Vormarsch der Roten Armee (1944–1945)
Kapitel 3: Zivilbevölkerung in Ostpreußen, Schlesien, Pommern
Kapitel 4: Kriegsgefangene in sowjetischer Hand
Kapitel 5: Die Internierungslager in der SBZ
Kapitel 6: Vergewaltigung als Kriegswaffe
Kapitel 7: Erinnern oder Verschweigen?
Kapitel 8: Völkerrecht und moralische Bewertung
Schluss: Versöhnung trotz Erinnerung – Ein Plädoyer für Wahrheit und Gerechtigkeit
Impressum neobooks
EINLEITUNG
Ziel und Relevanz des Buches
Die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert ist eine Geschichte beispielloser Gewalt, ideologischer Radikalisierung und massenhafter Menschenrechtsverbrechen. Im Zentrum dieser Epoche steht der Zweite Weltkrieg – ein Konflikt, der durch das nationalsozialistische Deutschland entfesselt wurde und der auf allen Seiten millionenfaches Leid über Soldaten wie Zivilisten brachte. In der öffentlichen Erinnerung – besonders in Deutschland – dominiert zu Recht die Beschäftigung mit den monströsen Verbrechen des NS-Regimes, mit Holocaust, Vernichtungskrieg im Osten, Zwangsarbeit und der systematischen Vernichtung jüdischen Lebens. Doch diese Perspektive allein reicht nicht aus, um die vollständige Tragödie jener Jahre zu begreifen.
Mit diesem Buch wird eine Lücke in der deutschen Erinnerungskultur geschlossen: die gezielte, dokumentierte und systematisch vertuschte Gewalt, die durch die sowjetische Rote Armee und andere Organe der UdSSR während und nach dem Krieg an deutschen Zivilisten und Kriegsgefangenen verübt wurde. Es geht um Vergewaltigungen in apokalyptischem Ausmaß, um Massenerschießungen, Folter, Verschleppung, Zwangsarbeit und millionenfaches Sterben in Lagern. Diese Taten fanden unter dem Banner des Antifaschismus statt – und blieben daher über Jahrzehnte hinweg nicht nur ungesühnt, sondern auch weitgehend tabuisiert.
Das Ziel dieses Buches ist es, die historische Wahrheit über diese Verbrechen zu dokumentieren – nicht aus einem revisionistischen Impuls heraus, sondern im Sinne einer vollständigen, gerechten Erinnerung. Es geht nicht darum, NS-Verbrechen zu relativieren. Vielmehr ist es ein Gebot der moralischen Redlichkeit, das Leid aller Opfer – auch der deutschen – zu würdigen und sichtbar zu machen. Gerade weil der deutsche Angriffskrieg so viel Elend verursacht hat, dürfen wir nicht verschweigen, dass die Antwort der sowjetischen Seite in Teilen ebenfalls bar jeder Menschlichkeit war.
Diese Arbeit will den Opfern eine Stimme geben, deren Geschichten über Jahrzehnte unterdrückt oder ignoriert wurden – von westdeutschen Schuldabwehrstrategien ebenso wie von ostdeutscher Staatspropaganda. Sie will dokumentieren, wie Hunderttausende deutscher Frauen, Kinder, alter Menschen und Kriegsgefangener unter der Herrschaft der Roten Armee und des sowjetischen NKWD gelitten haben – und in vielen Fällen elend starben. In der Summe soll dieses Buch zu einer ehrlicheren, ganzheitlicheren Erinnerungskultur beitragen – jenseits politischer Ideologie, aber mit klarer moralischer Haltung.
Methodik und Quellengrundlage
Die wissenschaftliche und publizistische Auseinandersetzung mit sowjetischen Kriegsverbrechen an Deutschen steht seit Jahrzehnten im Schatten der weit umfassenderen Forschung zu den Verbrechen des Nationalsozialismus – aus gutem Grund, aber mit fataler Wirkung für die Sichtbarkeit der anderen Opfergruppen. Umso wichtiger ist es, sich auf eine solide methodische Grundlage zu stützen, die sowohl den historischen Quellen als auch den moralischen Anforderungen eines solchen Unterfangens gerecht wird.
Die vorliegende Arbeit basiert auf einem breiten Spektrum an Quellen. Dazu zählen in erster Linie Zeitzeugenberichte – Tagebücher, Briefe, Memoiren und Interviews von Überlebenden, die teils unmittelbar nach dem Krieg, teils in späteren Jahrzehnten aufgezeichnet wurden. Diese Berichte, so subjektiv sie auch sind, geben ein eindringliches Bild der Erfahrungen deutscher Zivilisten und Kriegsgefangener. Ihre Authentizität ergibt sich nicht nur aus ihrer persönlichen Note, sondern oft auch aus ihrer Übereinstimmung mit anderen unabhängigen Zeugenaussagen.
Daneben wurden offizielle Dokumente aus sowjetischen Archiven ausgewertet, soweit diese nach der Öffnung in den 1990er-Jahren zugänglich wurden. Dazu gehören Protokolle des NKWD, Lagerverzeichnisse, Transportlisten, interne Lageberichte der Roten Armee sowie gerichtliche Verurteilungen deutscher Kriegsgefangener oder sogenannter „feindlicher Elemente“ in der sowjetischen Besatzungszone. Leider bleibt der Zugang zu vielen Archiven in Russland heute wieder beschränkt oder wird gezielt politisch kontrolliert – eine Entwicklung, die die historische Aufarbeitung massiv erschwert.
Auch deutsche Quellen, insbesondere aus ost- und westdeutschen Behörden der Nachkriegszeit, fließen ein. Sie geben Einblicke in die damalige Wissenslage, in juristische Versuche der Ahndung und in politische Verschleierungstendenzen. Besonders wertvoll sind die Berichte westalliierter Beobachter sowie Dokumente der Internationalen Rotkreuz-Organisationen, die teilweise Augenzeugen der katastrophalen Zustände in den sowjetischen Lagern waren oder zumindest indirekte Kenntnis davon hatten.
Ein weiteres Fundament bilden historische Sekundärwerke. Autoren wie Norman M. Naimark („Die Rache der Sieger“), Anthony Beevor („Berlin 1945“), Alfred de Zayas, Heinz Nawratil oder Joachim Käppner haben durch akribische Recherche und eine klare moralische Haltung dazu beigetragen, die Verbrechen der sowjetischen Seite ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Ihre Arbeiten werden in diesem Buch regelmäßig herangezogen und kritisch eingeordnet.
Trotz aller Quellen bleibt die Darstellung lückenhaft – nicht, weil die Verbrechen weniger gravierend gewesen wären, sondern weil das Schweigen darüber jahrzehntelang politisch gewollt war. Die DDR glorifizierte die Rote Armee als „Befreier“, die BRD war auf internationale Anerkennung ausgerichtet und vermied alles, was als Umdeutung der Täter-Opfer-Rollen erscheinen konnte. Die Opfer sowjetischer Gewalt standen so zwischen den Fronten – zu unbequem, zu „politisch unkorrekt“, um in der offiziellen Gedenkkultur ernsthaft berücksichtigt zu werden.
In dieser Arbeit wird keine „falsche Ausgewogenheit“ gesucht. Sie stellt nicht NS-Verbrechen und sowjetische Gräueltaten nebeneinander, um sie gegeneinander aufzuwiegen. Vielmehr wird von einem humanitären und menschenrechtlichen Grundsatz ausgegangen: Verbrechen bleiben Verbrechen, unabhängig davon, wer sie begeht. Die Rote Armee hat bei ihrem Vormarsch auf deutschem Boden systematisch gegen das Völkerrecht verstoßen – nicht nur in Einzelfällen, sondern vielfach unter Billigung oder sogar auf direkte Anordnung ihrer Führung.
Zur Problematik der Erinnerungskultur
Die Erinnerung an die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts ist in Deutschland von einer tiefen moralischen Verpflichtung geprägt. Die systematischen Verbrechen des Nationalsozialismus, insbesondere die industrielle Ermordung der europäischen Juden, gelten – zu Recht – als zivilisatorischer Tiefpunkt. Die deutsche Gedenkkultur wurde nach 1945 (und vor allem nach 1968) mit großem Ernst und politischer Konsequenz auf die Schuld des eigenen Landes ausgerichtet. Diese kollektive Selbstvergewisserung hat Deutschland in vielerlei Hinsicht moralisch geadelt – sie ist ein weltweites Vorbild für Aufarbeitung und Verantwortung. Doch sie hat auch einen Schatten: die Verdrängung und Marginalisierung des deutschen Opferleids, vor allem durch fremde Täter wie die sowjetische Besatzungsmacht.
In der DDR war es ideologisch untersagt, über sowjetische Gräueltaten zu sprechen. Die Rote Armee galt als „Befreier vom Faschismus“, ihre Rolle war sakrosankt. Verbrechen an der Zivilbevölkerung wurden geleugnet oder der „berechtigten Rache“ zugeschrieben. Deutsche Opfer sowjetischer Gewalt wurden entweder zu „Konterrevolutionären“ oder gar zu Nazis erklärt, deren Schicksal keinerlei Mitleid verdiente. In diesem Klima der erzwungenen Bewunderung für den kommunistischen Bruderstaat wurde jede Erinnerung an das Leid, das von der Ostseite kam, im Keim erstickt.
Doch auch in der Bundesrepublik herrschte lange Zeit ein peinliches Schweigen. Der westdeutsche Staat war auf internationale Anerkennung und moralische Rehabilitierung bedacht. Jede zu laute Betonung deutschen Opferseins drohte, als „Revisionismus“ gebrandmarkt zu werden. Der Begriff des „deutschen Opfermythos“ wurde zum Totschlagargument gegen jede differenzierte Betrachtung der Kriegsfolgen. Wer auf sowjetische Kriegsverbrechen hinwies, geriet schnell in den Verdacht, die deutsche Schuld relativieren zu wollen. So wurde das Leid von Millionen verschwiegen – nicht nur aus politischen Gründen, sondern oft auch aus moralischer Selbstzensur.
Diese asymmetrische Erinnerungskultur hat tiefe Spuren hinterlassen. Ganze Generationen wuchsen mit einem einseitigen Bild vom Krieg auf – Täter dort, Opfer hier. Die deutsche Zivilbevölkerung wurde zwar als Leidtragende gesehen, etwa in Bezug auf die Bombenangriffe oder die Vertreibung aus dem Osten. Doch die Gewalt der sowjetischen Armee, die systematische Vergewaltigung von Frauen, die Entmenschlichung der Kriegsgefangenen, die Folter und Vernichtung in den Internierungslagern – all das blieb lange Zeit unsichtbar oder wurde nur am Rande erwähnt.
Gleichzeitig entwickelte sich – besonders in den betroffenen Familien – eine private Erinnerungskultur, die von Angst, Scham und Sprachlosigkeit geprägt war. Viele Frauen, die vergewaltigt wurden, schwiegen ihr Leben lang. Männer, die die Lager überlebt hatten, galten als gebrochen oder „unpolitisch“. Kinder, die ohne Väter aufwuchsen oder die Flucht aus Ostpreußen überlebten, konnten ihr Leid nie öffentlich artikulieren. Eine ganze Schicht von Opfern blieb ungehört – nicht, weil es an Stimmen mangelte, sondern weil es an gesellschaftlichem Willen fehlte, zuzuhören.
Erst in den letzten Jahrzehnten begann sich diese Dynamik langsam zu ändern. Mit der Wiedervereinigung, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Öffnung osteuropäischer Archive wurde es möglich, ein umfassenderes Bild der Kriegsfolgen zu zeichnen. Historiker, Journalisten und Autoren begannen, das „vergessene Leid“ zu thematisieren. Doch die Aufarbeitung steht erst am Anfang. Noch immer gilt die Thematisierung sowjetischer Verbrechen in manchen Kreisen als Tabubruch, als gefährliches Terrain, das mit rechter Vereinnahmung verwechselt werden könnte.
Umso dringlicher ist es, diesem Thema eine seriöse, fundierte und moralisch klare Stimme zu geben. Dieses Buch versteht sich als Beitrag zu einer ehrlichen Erinnerungskultur, die nicht selektiv ist, sondern ganzheitlich. Es geht nicht darum, eine „Gegenerinnerung“ zu schaffen, sondern darum, die blinden Flecken zu benennen, die Opfer zu würdigen und die Wahrheit beim Namen zu nennen. Wer ernsthaft an Versöhnung und historischer Verantwortung interessiert ist, darf nicht nur die eigenen Verbrechen, sondern muss auch das Leid der eigenen Bevölkerung anerkennen – besonders, wenn es durch andere Gewaltregime verursacht wurde.
Kapitel 1: Der Weg zur Katastrophe
Deutsch-sowjetische Beziehungen vor dem Krieg
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion in den Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg waren von Instabilität, Misstrauen und einem Wechselspiel zwischen pragmatischer Zusammenarbeit und ideologischer Feindschaft geprägt. Obwohl der Nationalsozialismus und der Kommunismus einander als Todfeinde begriffen, offenbarten die politischen Entwicklungen der 1920er und 1930er Jahre immer wieder eine zynische Bereitschaft beider Seiten, ihre ideologischen Prinzipien kurzfristigen Machtinteressen unterzuordnen. Die Eskalation zur Katastrophe von 1941 war deshalb nicht nur das Ergebnis schicksalhafter Konfrontation, sondern auch das Produkt bewusster Komplizenschaft.
Nach dem Ersten Weltkrieg standen beide Staaten – das geschlagene, vom Versailler Vertrag gedemütigte Deutsche Reich und die nach dem Bürgerkrieg erstarkende bolschewistische Sowjetunion – außenpolitisch isoliert da. In dieser Lage fanden sie überraschend schnell zueinander. Der Vertrag von Rapallo (1922) markierte eine Phase intensiver Zusammenarbeit. Deutschland erkannte die Sowjetunion diplomatisch an, beide Seiten verzichteten auf Reparationsforderungen und entwickelten bald darauf eine geheime militärische Kooperation: Deutsche Offiziere trainierten in der Sowjetunion, experimentierten mit verbotenen Waffensystemen – darunter Panzer und Kampfflugzeuge – und nutzten sowjetisches Territorium als Übungsplatz zur Umgehung der Versailler Abrüstungsklauseln. Diese Zusammenarbeit war nicht von ideologischer Nähe, sondern von Realpolitik geprägt – man nutzte den gegenseitigen außenpolitischen Schwächezustand für beidseitige Vorteile.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 änderte sich das Verhältnis zunächst drastisch. Hitlers Weltbild war klar auf Konfrontation mit dem Bolschewismus ausgerichtet. In seinem Buch Mein Kampf hatte er den „jüdischen Bolschewismus“ als existenzielle Bedrohung für das deutsche Volk dargestellt und die Eroberung von „Lebensraum im Osten“ – sprich: in der Sowjetunion – zur geopolitischen Kernforderung seines Regimes erklärt. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass ein frühzeitiger militärischer Konflikt mit der UdSSR das Deutsche Reich überfordern würde. So kam es zunächst zur ideologischen Feindseligkeit bei gleichzeitigem Zögern, diese in konkrete Politik zu übersetzen.
Ein Wendepunkt folgte im Jahr 1939, als sich Hitler entschloss, mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt zu schließen – ein diplomatischer Paukenschlag, der weltweit Schock und Fassungslosigkeit auslöste. Der Hitler-Stalin-Pakt (Molotow-Ribbentrop-Pakt) vom 23. August 1939 besiegelte nicht nur eine außenpolitische Koexistenz zweier Diktaturen, sondern regelte im geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung Osteuropas in deutsche und sowjetische Interessensphären. Polen sollte zerschlagen, das Baltikum sowjetisiert, Rumänien aufgeteilt werden. Es war ein Pakt zweier Tyrannen auf dem Rücken kleinerer Völker – kalt, berechnend und zutiefst unmoralisch.
Der praktische Vollzug dieser Abmachung begann nur wenige Wochen später. Am 1. September 1939 marschierte die Wehrmacht in Polen ein. Am 17. September folgten die sowjetischen Truppen von Osten. Polen wurde in einem gemeinsamen Akt der Aggression zwischen NS-Deutschland und der UdSSR aufgeteilt. Während deutsche Truppen im Westen mit systematischer Härte gegen polnische Soldaten, Intellektuelle und Juden vorgingen, begann im Osten eine Welle sowjetischer Repression: Tausende Polen wurden verschleppt, erschossen oder in sibirische Lager deportiert. Der Terror der Sowjets