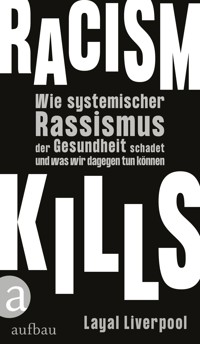
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das erste Buch über Rassismus im Gesundheitswesen auf dem deutschen Markt.
Layal Liverpool zeigt, wie tief Rassismus in das Leben von Menschen eingreift, deren Körper für die Medizin noch immer unsichtbar sind: Schwarzen Menschen und People of Colour wird unterstellt, sie könnten mehr Schmerzen ertragen als weiße Menschen. Schwarze Frauen sterben viermal häufiger bei der Geburt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden nicht erkannt, transgenerationale Traumata nicht ernst genommen. Die in Berlin lebende Medizinerin Layal Liverpool legt die Wurzeln dieser tödlichen Ungleichheiten frei und führt den Beweis, dass unsere Gesellschaft weit davon entfernt ist, ihre Mitglieder gleich zu behandeln. Doch es gibt Wege zu einem gerechteren Gesundheitssystem, das den Wert des Lebens wirklich schätzt.
»Ein bahnbrechendes, brillant argumentiertes Buch, das mit dem Mythos aufräumt, dass Krankheit der große Gleichmacher ist.« Siddharta Mukherjee.
»Klarsichtig und beeindruckend.« The Guardian.
»Ein Werk von überragender Bedeutung, das zweifellos die Wissenschaft verändern und Leben retten wird.« Chris van Tulleken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Eine bahnbrechende Untersuchung darüber, wie Rassismus in Wissenschaft und Medizin wirkt – und Menschenleben gefährdet
Layal Liverpool verbrachte als Teenager Jahre damit, einen (weißen) Arzt nach dem anderen aufzusuchen – keiner von ihnen war in der Lage, eine Diagnose zu stellen. Gerade als sie sich an den Gedanken gewöhnt hatte, dass sie eine seltene, unbehandelbare Hautkrankheit haben müsse, teilte ihr ein (Schwarzer) Dermatologe nach kurzer Untersuchung mit, dass es sich um ein klassisches Ekzem handelte, das auf dunklerer Haut anders aussehe. Diese Erfahrung blieb ihr im Gedächtnis. Sie fragte sich, welche weiteren Krankheiten bei BIPoC wohl übersehen werden.
In ihrem Buch zeigt Liverpool: Rassismus ist so tief in die Strukturen von Medizin und Wissenschaft eingewoben, dass eine strukturelle Ungleichheit bei der Behandlung sämtlicher Krankheiten besteht. Von der rassistischen Voreingenommenheit einer Medizin, in der der Mensch standardmäßig weiß ist, über die physischen und psychischen Auswirkungen alltäglicher Mikroaggressionen bis hin zu generationenübergreifenden Traumata und Datenlücken – die junge Medizinerin deckt die fatalen Stereotypen auf, die dazu führen, dass BIPoC undiagnostiziert, unbehandelt und unsichtbar bleiben, und sagt uns, was wir dagegen tun können.
»Ein überzeugendes Argument dafür, dass Rassismus eine eigenständige Krankheit ist und nicht nur die Freizeitbeschäftigung einzelner rassistischer Rüpel.« The Guardian
Über Layal Liverpool
Layal Liverpool ist Wissenschaftsjournalistin für die Themen Technologie, Physik, Umwelt und Gesundheit, wobei sie sich insbesondere mit Ungleichheiten in Wissenschaft, Gesundheit und Medizin befasst. Ihre Artikel sind unter anderem in Nature, New Scientist, WIRED und dem Guardian erschienen. Bevor sie in den Journalismus wechselte, arbeitete Layal als biomedizinische Forscherin am University College London und an der University of Oxford. Sie hat in Virologie und Immunologie an der Universität Oxford promoviert. Sie lebt in Berlin.
Regina M. Schneider ist Amerikanistin und seit Jahren als Literaturübersetzerin etabliert. Sie übersetzt erzählerische und wissenschaftliche Werke (u. a. Shahriar Mandanipur, Slavoj Žižek) sowie Biografien (u. a. Michael Moore, Rose McGowan, Dalai Lama). Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Barthold-Heinrich-Brockes-Stipendium 2023. Daneben ist sie Dozentin für Translationswissenschaften und Deutsch als Fremdsprache an diversen Universitäten.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Layal Liverpool
Racism kills
Wie systemischer Rassismus der Gesundheit schadet und was wir dagegen tun können
Aus dem Englischen von Regina M. Schneider
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Einleitung
TEIL I — Health Gaps
1: Schwangerschaft und Geburt
2: Leben und Tod
TEIL II — Rassismus in der Gesellschaft
3: Systemischer Rassismus
4: Alltagsrassismus
5: Colourism
TEIL III — Rassismus in der Medizin
6: Racial Bias im Gesundheitswesen
7: Race-basierte Medizin
TEIL IV — Data Gaps
8: Die fehlenden Daten
9: Die Schließung der Datenlücken
10: Die Illusion der Inklusion
Ausblick
Dank
Anmerkungen
Einleitung
1 Schwangerschaft und Geburt
2 Leben und Tod
3 Systemischer Rassismus
4 Alltagsrassismus
5 Colourism
6 Racial Bias im Gesundheitswesen
7 Race-basierte Medizin
8 Die fehlenden Daten
9 Die Schließung der Datenlücken
10 Die Illusion der Inklusion
Ausblick
Wichtige Organisationen und Quellen
Sachregister
Erläuterungen
Impressum
Für Mama und Yaz
Einleitung
Damals, als junges Mädchen mitten im Teenageralter, entdeckte ich auf einmal immer mehr kleine helle Flecken auf meiner Haut, im Gesicht und an den Armen. Ich war ohnehin wenig selbstbewusst, und jetzt auch noch das. Die Flecken gingen mit heftigem Juckreiz einher, weshalb meine Mutter mit mir zum Arzt ging. Ein jahrelanges Ärzt:innen-Hopping begann, von einem Spezialisten zum nächsten, darunter etliche Dermatologen, die mir alles Mögliche verschrieben, von Antibiotika bis Antimykotika. Nichts davon half. Die hellen Flecken auf meiner Haut blieben, wurden noch größer, noch auffälliger. Dann, inzwischen war ich erwachsen, zog ich von den Niederlanden, wo ich aufgewachsen war, nach England, und begann dort als Assistentin in der biomedizinischen Forschung in London zu arbeiten. Zu dieser Zeit hatte ich irgendwann einen besonders schlimmen Ausbruch und stellte mich einem weiteren Dermatologen vor. Bis dahin war ich bei so vielen Ärzten gewesen, hatte so viele Behandlungen durchprobiert, dass ich mich wohl oder übel mit dem Gedanken abfinden musste, an irgendeiner extrem seltenen Hautkrankheit zu leiden, die unmöglich zu diagnostizieren und schon gar nicht zu behandeln war.
Nach einem kurzen Gespräch und einer Begutachtung meiner Haut attestierte mir der Arzt jedoch einen klassischen Fall von atopischer Dermatitis, auch bekannt als endogenes Ekzem oder Juckflechte – eine der häufigsten Hauterkrankungen. Der Arzt hatte ebenfalls eine dunklere Hautfarbe, ähnlich der meinen und er erklärte mir, dass diese Form der Dermatitis vereinzelt zu Pigmentverlust (Hypopigmentierung) führen könne, die auf dunklerer Haut anders aussieht als auf hellerer. Die hauptsächlich weißen[1] Ärzt:innen, die ich bis dato aufgesucht hatte, so seine Einschätzung, hätten mein Ekzem möglicherweise deshalb nicht erkannt, weil sie mit deren Erscheinungsbild auf Haut wie meiner nicht vertraut waren. Glücklicherweise gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten. Und auch wenn ich immer mal wieder Schübe bekomme, sind meine Ekzeme heute weitgehend unter Kontrolle und meine Hautpigmente nahezu vollständig wieder da.
Die Erfahrung aber sitzt tief. Ich fragte mich, ob bei dunkelhäutigen Menschen nicht auch andere Erkrankungen unerkannt bleiben, möglicherweise auch ernstere, weil Ärzt:innen nicht darin geschult sind, die verschiedenen Arten zu erkennen, in denen sich ihre Symptome darstellen. Zum Glück war ich nicht die Einzige, die sich diese Frage stellte.
Malone Mukwende beispielsweise interessierte sich schon in jungen Jahren für die Wissenschaft, vor allem dafür, wie Krankheiten zu vielfältigen Veränderungen im menschlichen Körper führen können, was ihn letztlich bewog, Medizin zu studieren.1 Doch während seines Studiums am St. George’s Hospital der University of London bemerkte er eine beunruhigend einseitige Lehrausrichtung in der Diagnosestellung, erst recht, als er in den medizinischen Lehrbüchern nach Bildbeispielen von Krankheitssymptomen auf dunklerer Haut suchte und nirgendwo welche fand. »Ein großes Problem, denn ich wusste, dass bestimmte Symptome auf meiner Haut, einer Schwarzen Haut, einfach anders aussehen«, erklärte Mukwende 2002 in einem Interview gegenüber der Washington Post.2
Mukwende beschloss, etwas gegen diese beunruhigende Schieflage zu tun, wandte sich an Dozierende seiner Universität, und es entstand die gemeinsame Idee zu einem Handbuch, einem nützlichen Begleiter für die medizinische Praxis. Inzwischen steht das Buch mit dem Titel Mind the Gap: A Handbook of Clinical Signs in Black and Brown Skin kostenlos zum Download zur Verfügung3 und findet viel Beifall, vor allem unter Mediziner:innen und Wissenschaftler:innen wie Patricia Louie, Soziologin an der University of Washington. Ihre Forschungen ergaben 2018, dass fast 75 Prozent der Bildbeispiele, die sich in den gebräuchlichsten medizinischen Referenzwerken der USA finden, hellere Hauttypen zeigen, während dunklere mit weniger als 5 Prozent vertreten sind. Selbst in Südafrika, wo die Bevölkerung mehrheitlich Schwarz ist, lernen die meisten Medizinstudierenden aus ähnlich tendenziösen Lehrbüchern.4,5 Und dass Menschen durch diese einseitigen Perspektiven zu Schaden kommen, steht außer Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass verbreitete Hauterkrankungen wie Psoriasis undiagnostiziert bleiben, liegt in den USA für BIPoC (die Abkürzung bezieht sich auf Schwarze, Indigene und People of Colour) höher als für weiße Menschen.6,7
Das Problem der rassifizierten Verzerrungen (racial bias) in der Medizin beschränkt sich aber nicht allein auf die Dermatologie. Zahlreiche Studien belegen eine implizite oder unbewusste Voreingenommenheit unter medizinischem Fachpersonal auf breiter Basis.8 Und das ist nicht weiter verwunderlich – wir alle sind Menschen, und Menschen haben vorgefasste Meinungen. Unreflektiert jedoch können gesundheitsschädliche Stereotypen wie die feste Überzeugung, Schwarze seien weniger schmerzempfindlich als Weiße, dazu führen, dass Ärzt:innen die Schwere von Symptomen bei Schwarzen Patient:innen unterschätzen und eine adäquate medizinische Weiterbehandlung ausbleibt.9,10,11,12,13 Viele dieser Stereotype gründen auf der irrigen Überzeugung, es gebe biologische Unterschiede zwischen »Rassen«. Wie eine 2016 durchgeführte US‑Studie ergab, stimmte rund die Hälfte der 222 teilnehmenden weißen Medizinstudent:innen und Assistenzärzt:innen mindestens einer von mehreren falschen Aussagen über angebliche biologische Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen zu, darunter Aussagen wie »Die Nervenenden von Schwarzen Menschen sind weniger schmerzempfindlich als die von weißen Menschen«, oder »Die Haut von Schwarzen Menschen hat mehr Kollagen und ist damit dicker als die von weißen Menschen.«14 Im Ergebnis belegt die Studie anhand fiktiver Patient:innen, dass falsche Grundüberzeugungen unweigerlich in racial bias münden, was Schmerzbeurteilungen und anschließende Behandlungsempfehlungen anbelangt.
»Rasse« aber ist kein biologisches Merkmal[2] . Trotzdem kann ich es jedem verzeihen – auch den Medizinstudent:innen und Ärzt:innen der oben beschriebenen Studie –, der bei Betrachtung unserer Welt zu einem anderen Schluss kommt. Wohin man schaut, die Ungleichheiten in Bezug auf die Gesundheit zwischen rassifizierten und ethnischen Gruppen sind immens; die Zugehörigkeit zu einer marginalisierten Gruppe ist im Allgemeinen mit schlechteren Gesundheitsergebnissen (health outcome) verbunden. Deutlich bewusst wurde mir dies, als ich als Wissenschaftsjournalistin über in der Ethnie begründete Unterschiede im Zusammenhang mit Infektionen und Todesursachen berichtete, die während der Covid‑19‑Pandemie in einer Reihe von Ländern bereits sehr früh auftraten. Sogleich spekulierten einige Wissenschaftler:innen, dass gesundheitliche Disparitäten zwischen ethnisch diversen Gruppen, zumindest teilweise, genetisch bedingt sein könnten.15,16 Darin spiegelt sich ein langjähriger Trend innerhalb der Medizinwissenschaft, sich auf Biologie und Genetik zu stützen, um differente health outcomes zwischen Schwarzen und Weißen zu erklären, anstatt den eigentlichen Übeltäter namens Rassismus konkret zu benennen und umfassend zu erforschen. Racial bias in der Medizin zeigt beispielhaft die Vielfalt der negativen Auswirkungen von Rassismus auf die Gesundheit marginalisierter Gruppen. Es gibt immer mehr unabweisbare Indizien dafür, dass Rassismus in unseren Gesellschaften heute ein wesentlicher Treiber für eine wachsende ethnisch bedingte Kluft (health gap) im Gesundheitswesen ist.
Wissenschaftliche und medizinische Autoritäten sehen Rassismus zunehmend als eine ernste Bedrohung für das öffentliche Gesundheitswesen. In den Jahren vor Erscheinen dieses Buches bezeichnete das renommierte medizinische Fachblatt The Lancet Rassismus als einen »gesundheitlichen Notfall von globaler Tragweite« und veröffentlichte eine Sonderserie, um die gesundheitsschädigenden Wirkungen von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung samt der sie stützenden Strukturen aufzuzeigen.17,18 Zu einer ähnlichen Feststellung kommt ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2022: »Gesundheitliche Ungleichbehandlungen von Personen und Menschengruppen, die rassistische Diskriminierung erfahren, sind beträchtlich und in vielen Ländern auf dem Vormarsch (…), angetrieben von den Wechselwirkungen zwischen weiter gefassten sozialen Determinanten wie gesundheitlichem Wohlergehen, Strukturellem Rassismus und gesellschaftlicher Diskriminierung«.19
Doch die allgemeine Debatte über race und Gesundheit hinkt hinterher. Dass Schwarze im US‑Bundesstaat Louisiana überproportional häufig am Coronavirus erkranken und daran sterben, sei dadurch bedingt, dass »Afroamerikaner:innen ein um 60 % höheres Risiko haben, an Diabetes zu erkranken«, sagte Bill Cassidy, republikanischer Senator des Bundesstaates und studierter Mediziner, in einem Interview mit dem NPR (National Public Radio). Den Einwand, wonach Rassismus zur Stärkung derartiger gesundheitlicher Ungleichheiten beiträgt, ließ er nicht gelten20, ebenso wenig wie die Andeutung, wonach diese Ungleichheiten möglicherweise in einem jahrelangen systemischen Rassismus wurzeln: »Das ist populistische Rhetorik. Als Arzt halte ich mich an die Wissenschaft«, sagte er. Inzwischen empfiehlt ein von der britischen Regierung in Auftrag gegebener Bericht von 2021, bei der Erforschung ethnisch bedingter, gesundheitsbezogener Disparitäten »genetische und biologische Unterschiede« zu berücksichtigen und geht auf die Rolle von Rassismus als eigentliche Ursache für gesundheitliche Ungleichheiten nicht weiter ein.21 Die derzeitige Debatte um den Zusammenhang zwischen Rassismus, sozialer Ungleichheit und Gesundheit lahmt und behindert so wichtige Anstrengungen, ethnisch bedingte Verwerfungen im Gesundheitsbereich zu erforschen sowie Rückstände festzustellen und aufzuholen – in den USA, im Vereinigten Königreich und weltweit. Dies zu ändern, dazu möchte ich beitragen.
In vier großen Teilen untersucht das vorliegende Buch den schweren gesundheitlichen Tribut, den Rassismus und Diskriminierung fordern. Teil Eins beleuchtet das enorme gesundheitliche Gefälle, das zwischen ethnischen Gruppierungen innerhalb einzelner Länder rund um die Welt besteht. Über zwei Kapitel hinweg möchte ich hier ein besorgniserregendes Muster enthüllen, wonach Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören, tendenziell insgesamt einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen, und zwar von vornherein: beginnend mit Schwangerschaft und Geburt, über Kindheit und Jugend sowie (sofern überlebt) das ganze weitere Leben hindurch, durchgängig begleitet von ethnischen Ungleichheiten[3] in Bezug darauf, wer krank wird und infolgedessen stirbt.
Die anderen drei Teile des Buches befassen sich dann mit der Frage, warum diese Ungleichheiten überhaupt existieren und fortbestehen: In Teil Zwei des Buches werden die sich vielfach überlappenden und krankmachenden Facetten von Rassismus erörtert, und wir nehmen die schleichende Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch systemischen und sozialen Alltagsrassismus unter die Lupe. Wir lernen, inwiefern Systeme, Strukturen und Institutionen, die jede Gesellschaft untermauern, egal wo auf der Welt, ihren Anteil daran haben, dass ein voller und gleichberechtigter Zugang zu gesundheitsfördernden Lebensumständen nicht jedem gegeben ist, und dass Rassismus als chronisches Stressmoment und akut traumatisches Erlebnis verheerende Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden haben kann.
In Teil Drei vertiefen wir die Frage, inwiefern Rassismus in der Medizin bestehende ethnisch bedingte, gesundheitsbezogene Ungleichheiten weiter verfestigt – wie etwa durch racial bias unter Fachkräften im Gesundheitswesen, aber auch durch Rassifizierung, die in der medizinischen Ausbildung und Praxis sowie in den Medical Guidelines (den Medizinischen Versorgungsleitlinien) verankert ist.
In Teil Vier schließlich steht die wissenschaftliche Forschung im Mittelpunkt, die unser Verständnis von Gesundheit, einschließlich der bestehenden Ungleichheiten, untermauert. Wir werden verfügbare Daten ebenso wie offenkundige Datenlücken (data gaps) in der Gesundheits- und Medizinforschung genau betrachten und aufdecken, warum racial bias in Wissenschaft und Lehre der Gesundheit aller schadet.
Ich spreche hier absichtlich von unser »aller« Gesundheit, denn das Problem betrifft uns alle, ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht. Rassismus, wie er sich in allen Gesellschaften auf der ganzen Welt manifestiert, macht uns nicht nur insgesamt kränker, er bremst auch unsere medizinischen Forschungsbemühungen und verringert die Chancen auf wissenschaftliche Erkenntnisgewinne, die uns wirklich dabei helfen würden, alle, die erkranken, möglichst erfolgreich zu behandeln.
Auch wenn es in diesem Buch hauptsächlich um die schädigenden Auswirkungen von Rassismus auf die Gesundheit geht, möchte ich an dieser Stelle betonen, dass jedwede Form von Diskriminierung – ob aufgrund von sozialer Herkunft, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder Behinderung, um nur einige zu nennen – krank macht. Über die vielen alltäglichen Formen und Mechanismen der Unterdrückung und Ausgrenzung wurde und wird viel geschrieben, und ich werde nicht versuchen, sie in diesem Buch zu rekapitulieren. Aber es werden uns einige Fälle begegnen, in denen sich Rassismus mit anderen Arten von Diskriminierung im Zusammenhang mit Gesundheit überschneidet und intersektional überlappt. Das ist unvermeidlich: Rassismus schadet der Gesundheit, und daraus entstandener Schaden ist für Menschen mit sich überschneidenden marginalisierten Mehrfachidentitäten mitunter besonders akut.
Wenn Rassismus ein Virus wäre, so denke ich oft, wären wir höchst alarmiert bei all dem unnötigen Leiden und Sterben, das es weltweit verursacht. Eilends würden wir Impfstoffe entwickeln und nach Behandlungsmöglichkeiten suchen. Auch wenn Rassismus kein tatsächliches Virus ist, macht er die Menschen krankheitsanfälliger – wie sich unlängst zeigte, als das Corona-Virus die ganze Welt erfasste. In Gesellschaften, auch jenen, die von Rassismus angetrieben und erhalten werden, bieten Nester der Ungleichheit poröse Stellen, durch die hochinfektiöse Krankheiten einsickern können. Diese Stellen sind immer vorhanden, treten aber während gesundheitlicher Krisensituationen wie Pandemien besonders deutlich zutage. Tatsächlich ist Rassismus eine überaus heimtückische Bedrohung für unsere Gesundheit, gerade weil er so leicht übersehen und in manchen Fällen vielleicht auch absichtlich ignoriert wird. Wie wir jedoch sehen werden, ist Rassismus nicht nur in den Grundfesten unserer Gesellschaften verankert, sondern auch tief in der Medizin und Wissenschaft – ganz im Verborgenen. Und die schmerzhafte Ironie dabei ist: Er ist hausgemacht.
Rassismus ist die Folge einer Weltanschauung, die sich aus einem gesteigerten Expansionsdrang der europäischen Kolonialmächte im Zeitalter des Imperialismus heraus entwickelte und in alle Welt verbreitete. Kein Zufall: Bestimmte Gruppen von Menschen zu deklassieren, sie als biologisch andersartig und gar minderwertig gegenüber anderen zu bewerten, trug dazu bei, deren Unterdrückung durch Kolonisierung und transatlantischen Sklavenhandel zu legitimieren. Etliche brillante Bücher setzen sich mit der Erfindung von »Menschenrassen« und Rassismus innerhalb der Wissenschaft auseinander – darunter Fatal Invention von Dorothy Roberts, Superior von Angela Saini, Wie man mit Rassisten diskutiert von Adam Rutherford und Divided von Annabel Sowemimo. Und auch dieses Buch kommt an diesem einflussreichen Kapitel der Wissenschafts- und Menschheitsgeschichte nicht vorbei und braucht eine kurze Einordnung:22,23,24,25 Die ersten wissenschaftlichen Versuche, Menschen in »Rassengruppen« einzuteilen, wurden im 17. und 18. Jahrhundert unternommen. In seiner 1795 veröffentlichten Dissertation teilte der deutsche Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach die Ahnenreihe des Menschen in fünf »Stammrassen« ein: Kaukasier, Mongolen, Äthiopier, Amerikaner und Malaien. Mit geringfügigen Abwandlungen wurde diese Systematik fortan von Wissenschaftler:innen verwendet, die damit den Rassismus auf Jahrhunderte hinaus lebendig hielten und eugenische Betrachtungen beförderten. So griff beispielsweise auch Francis Galton, ein entfernter Cousin von Charles Darwin, im 19. und 20. Jahrhundert auf diese Theorien zurück und wurde zum »Vater der Eugenik« – was weltweit katastrophale Folgen zeitigen sollte.26 Und wir können es bis heute nicht lassen, Menschen in rassifizierte Kategorien einzuordnen.
Interessanterweise wandte sich Blumenbach selbst gegen die Idee, wonach Afrikaner (die er als Äthiopier bezeichnete) eine den weißen Europäern (die er Kaukasier nannte) unterlegene Menschenart seien, und widersprach damit vehement der seinerzeit vorherrschenden Auffassung.27 Gleichwohl schrieb er, dass die kaukasische Schädelform einer Georgierin die »schönste« sei, die er in seiner ganzen Forschungszeit je analysiert hätte. Er stellte auch – irrigerweise – die Theorie auf, dass Weiß als Hautfarbe »die ursprüngliche, ächte Farbe des Menschengeschlechts« sei, da aus ihr, so fährt er fort, »eine Verartung in Schwarz leicht ist, weit schwerer hingegen aus Schwarz in Weiß«.
Heute wissen wir, dass dies nicht stimmt. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft entwickelte sich der Homo sapiens vor etwa 300 000 Jahren in Afrika, von wo aus er hinaus in alle Welt wanderte – wir sind also alle Nachfahren afrikanischer Homo sapiens-Populationen.28 Dass sich in Teilen der Welt ein heller Hauttyp durchgesetzt hat, ist wohl einfach eine Anpassungsreaktion auf die geringere Sonneneinstrahlung in nördlichen Breiten. Daran ist nichts Einzigartiges oder Besonderes. Die Gene, die die Hautfarbe beeinflussen – oder auch andere Merkmale, die gemeinhin mit einer bestimmten race assoziiert werden, wie Nasen- und Augenform oder Haarstruktur – sind biologisch nicht bedeutsamer als all die zahllosen anderen proteinkodierenden Gene, die die menschliche Biologie beeinflussen. Entscheidend ist, dass die genetische Variation einzelner Individuen innerhalb einer menschlichen Population aus demselben geographischen Großraum größer ist als zwischen denen einzelner Populationen.
1972 erläuterte der Evolutionsbiologe und Genetiker Richard Lewontin in einem bahnbrechenden Aufsatz mit dem Titel The Apportionment of Human Diversity (»Die Aufteilung der menschlichen Vielfalt«) den wissenschaftlichen Irrtum im soziobiologischen Rassekonzept des Menschen.29 Als Lewontin im Juli 2021 im Alter von 92 Jahren verstarb, arbeitete ich gerade als Journalistin für das Wissenschaftsmagazin New Scientist, wo ich gerade zum Thema Rassismus in Wissenschaft und Medizin recherchierte. Unter den vielen Tabs, die ich auf meinem Computer-Bildschirm dazu geöffnet hatte, war auch eine PDF-Datei seines Aufsatzes, in dem er klar darlegt, dass die genetische Variation bei Menschen innerhalb einer allgemein definierten »Rassegruppe« größer sei als zwischen diesen einzelnen Gruppen.
Lewontin ordnete die Variationsbreite dieser »Rassegruppen« in »afrikanische Völker, europäische Völkerschaften, ozeanische Populationen, asiatische Völker und amerikanische Stämme«. Er macht es sich außerdem zum Prinzip, den Begriff »race« in Anführungszeichen zu setzen, vermutlich um deutlich zu unterstreichen, dass er die Verwendung entsprechender Kategorisierungen innerhalb der Wissenschaft rundweg kritisiert, so wie es inzwischen auch für das deutsche Äquivalent geschieht, sofern man es überhaupt noch nutzt. Lewontin analysierte Blutproteine von Menschen aus der ganzen Welt und nutzte sie als Marker für Verschiedenheiten in den Genen, die diese Proteine kodieren. Er fand heraus, dass annähernd 94 Prozent der genetischen Variationen innerhalb von Populationen – oder von ihm so genannten »Rassegruppen« – bestehen, gegenüber wenig mehr als 6 Prozent zwischen geographisch sortierten Gruppen. Ein extrem eindrucksvolles Ergebnis, vor allem, weil es das wachsende wissenschaftliche Verständnis von genetischer Varianz im menschlichen Erbgut mit Zahlen belegte.30
2002 veröffentlichte der US‑amerikanische Populationsgenetiker Noah Rosenberg eine weitere bahnbrechende Studie, »Genetic structure of human populations«, die die Unhaltbarkeit des biologischen Rassekonzepts bestätigte.31 Rosenberg und sein Team analysierten die DNA von mehr als 1000 Menschen in 52 unterschiedlichen Regionen der Welt. Wie sich zeigte, belaufen sich die genetischen Unterschiede zwischen Individuen innerhalb ein und derselben geographischen Population auf 93 bis 95 Prozent aller genetischen Unterschiede, während sie zwischen den großen geographischen Gruppen nur etwa 3 bis 5 Prozent ausmachen.
Anschließend speisten Rosenberg und Kolleg:innen die gewonnenen (genetischen) Daten zur Auswertung in ein Computerprogramm namens STRUCTURE ein, dem sie den Befehl gaben, die Daten in eine bestimmte Anzahl von DNA-Cluster zu segmentieren. Anhand der Vorgabe, die gesamte menschliche Spezies aufgrund ihrer genetischen Daten in fünf Cluster einzuteilen, ergab sich eine Zuordnung der Individuen in Afrikaner:innen, Europäer:innen, Vorderasiat:innen, Amerikaner:innen und Australier:innen – Gruppierungen, die jenen von Blumenbach oder den heute gebräuchlichen »rassischen« Kategorisierungen nicht ganz unähnlich sind. Tatsächlich wurde die Studie in einigen Medien damals als Beweis für »Rassen« als biologische Realität angeführt.32 Doch wie die US‑amerikanische Rechtsgelehrte und Gesellschaftswissenschaftlerin Dorothy Roberts in ihrem Buch Fatal Invention ausführt, war die Anzahl der genetischen Cluster völlig willkürlich festgesetzt: erhöht man die Anzahl der Cluster auf mehr als fünf, gruppiert das Programm kleinere, stärker isolierte Populationen in jeweils eigene Cluster, die sich ganz offensichtlich zunehmend überlagern. Stichproben mit Menschen aus weiteren geographischen Regionen würden diese Überlappung vermutlich noch deutlicher machen.33 In seinem Buch Eine kurze Geschichte von jedem, der jemals gelebt hat: Was unsere Gene über uns verraten erläutert der Genetiker Adam Rutherford, warum diese Studie im Ergebnis belegt, dass die Frage, wie viele menschliche »Rassen« es gibt, »bedeutungslos« ist.34 Die Genetik lehrt uns, dass es sehr viel genauer ist, die Menschheit auf einem Spektrum zu betrachten, als zu versuchen, sie in deutlich getrennte Kategorien einzusortieren. Genau aus diesem Grund ist es so problematisch, ethnische Ungleichheiten in Bezug auf die Gesundheit mithilfe der Biologie oder Genetik zu erklären. Jay Kaufman, Epidemiologe an der McGill University in Kanada, ist sich dessen nur allzu bewusst. Kaufman hat umfassende Studien über ethnische Ungleichheiten in Bezug auf Gesundheit und medizinische Versorgung durchgeführt, auch in Kanada und den USA. Das Problem, so erklärte er mir, bestehe darin, dass sozial definierte Kategorien wie race mit biologischen wie »Genetik« munter durcheinandergehen. »Unsere Kategorisierungen von Menschen nach Rassen basieren auf kontinentalen Populationen«, sagte er mir. »Nach der Definition von Rasse und Ethnie durch das United States Census Bureau fallen unter die Kategorie ›Schwarz‹ alle Menschen aus Subsahara-Afrika. Und das sind, unübersehbar, eine ganze Menge – fast eine Milliarde Menschen. Menschen mit sehr sehr unterschiedlichen lokalen Anpassungen, sehr sehr unterschiedlicher Physis, unterschiedlicher Ernährungsweise, unterschiedlicher gesellschaftlicher und biologischer Geschichte und so weiter. Schwarze Menschen sind untereinander nicht enger verwandt als Afrikaner:innen mit Europäer:innen. Es gibt einfach kein in sich schlüssiges, physiologisches Merkmal, das alle Weißen oder alle Schwarzen aufweisen, mit Ausnahme der Hautfarbe«, sagte er. Doch selbst die Hautfarbe reicht nicht aus, um alle Menschen dieser Erde eindeutig einer rassifizierenden oder ethnischen Kategorie zuzuordnen. Ich zum Beispiel identifiziere mich sowohl als Schwarz als auch als Mixed und witzele oft darüber, dass ich in allen europäischen Ländern, in denen ich gelebt habe, als Schwarze gesehen wurde, während mich die Menschen in Ghana oft »Oburoni« nennen, was auf Twi so viel heißt wie »weiße Person«. Meine Hautfarbe, die übrigens braun ist, ändert sich natürlich nicht mit dem Ort auf der Welt, an dem ich mich gerade befinde. Genauso wenig wie meine biologischen oder genetischen Merkmale. Aber soziale Kategorien wie race ändern sich durchaus – mit der Zeit und auch mit dem Ort. Der südafrikanische Comedian und Talkmaster Trevor Noah scherzt oft über sein »Upgrade« von »Coloured« oder »Mixed« zu »Schwarz«, nachdem er aus Südafrika in die USA gekommen war. Während Mixed People zur Zeit der Apartheid in Südafrika als »Coloured« eingestuft wurden, galt in den USA zur Zeit der Jim-Crow-Gesetze zwischen 1876 und 1964 die sogenannte »One-Drop Rule«, wonach jede Person mit auch nur einem Schwarzen Vorfahren rechtlich als »Schwarz« anzusehen war.35,36 Dieses Beispiel zeigt sehr gut, warum ethnisch-rassifizierende Kategorien aus wissenschaftlicher oder medizinischer Sicht unlogisch und inkonsistent sind.
Rassismus ist nicht nur unlogisch, er ist auch eine der am wenigsten eingestandenen und dabei gefährlichsten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit, mit denen sich die Welt heute konfrontiert sieht – und es ist höchste Zeit, dass wir das Kind beim Namen nennen. Wir sollten auf all die Menschen hören, die seit Jahrzehnten schon Alarm schlagen, und von denen wir einige in diesem Buch noch kennenlernen werden. Viele dieser Stimmen kommen von Angehörigen marginalisierter rassifizierter oder ethnischer Gruppen, zum Beispiel Ärzt:innen und akademischen Forschenden wie Jay Kaufman, aber auch von Medizinstudierenden und Patient:innen, von Kampagnenmacher:innen und Aktivist:innen, von Innovator:innen und politischen Entscheidungsträger:innen.
Mit ihrer Hilfe bin ich eingetaucht in riesige Mengen an Forschungsergebnissen und Daten, die zeigen, wie schädigend Rassismus für die Gesundheit ist. Und wie sehr sich diese Schäden im menschlichen Körper und Geist manifestieren, werde ich anhand von persönlichen Erfahrungen einiger Betroffener illustrieren. Ich werde zeigen, dass ethnisch bedingte Ungleichheiten im Zusammenhang mit der Gesundheit überall auf der Welt zu finden sind – unabwendbar aber sind sie keinesfalls. Eine Menge Leute, darunter viele innerhalb medizinischer und wissenschaftlicher Einrichtungen, arbeiten weltweit daran, Rassismus in all seinen Formen zu bekämpfen und gesundheitsbezogene Ungleichheiten zu beseitigen. Wir können sie in ihren Bemühungen unterstützen, uns ihren Forderungen nach Gerechtigkeit anschließen und gemeinsam an einer gerechteren und gesünderen Zukunft bauen.
TEIL I
Health Gaps
1
Schwangerschaft und Geburt
Serena Williams gehört zu den erfolgreichsten Menschen der Welt. Die 23‑fache Grand-Slam-Siegerin schafft es alljährlich auf die vielbeachteten Listen der »100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt« der US‑Magazine Time und Forbes. Doch kein noch so großer Erfolg, Reichtum oder Ruhm konnte Serena vor dem bewahren, was ihr im September 2017 widerfahren sollte.
Einen Tag nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia verspürte Serena plötzlich Atemnot. Bereits in der Vergangenheit hatten sich in ihrer Lunge immer mal wieder Blutgerinnsel gebildet, Auslöser für sogenannte pulmonale Thromboembolien. Das war der Grund dafür gewesen, dass sie ihre Tochter per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht hatte und die routinemäßige Einnahme ihrer blutverdünnenden Medikamente nach der Operation abgesetzt werden musste. In Anbetracht dessen und ihrer Vorgeschichte ging sie sofort davon aus, dass ihre jetzigen Symptome erste Anzeichen einer Lungenembolie waren. »Serena lebt in ständiger Angst vor Blutgerinnseln«, schrieb Rob Haskell in einer kurzen Biographie über die Sportlerin, die 2018 in der Vogue erschien.1 Sie verließ ihr Krankenzimmer kurz, um ihre Mutter nicht zu beunruhigen und die nächstbeste Krankenschwester anzusprechen. Sie brauche, sagte sie, während sie schwer nach Luft rang, schnellstmöglich ein CT samt Röntgen-Kontrastmittel zur Darstellung der Blutgefäße, intravenös injiziertes Heparin und Blutverdünner. Die Krankenschwester wimmelte sie zuerst ab, führte Serenas leicht benommenen Zustand auf die verabreichten Schmerzmittel zurück. Aber Serena blieb hartnäckig, bis ein Arzt sie schließlich untersuchte und einen Ultraschall ihrer Beinvenen machte. »Darauf ich: Dopplerultraschall? Ich hab’ doch gesagt, ich brauche ein CT, und einen Heparin-Tropf«, schilderte Serena dieses Erlebnis im Rückblick. Nachdem der Ultraschall unauffällig geblieben war, ordnete man nun doch eine Computertomographie an, und die bestätigte, was sie die ganze Zeit befürchtet hatte – ihre Lunge war von mehreren kleinen Blutgerinnseln besiedelt. In Minutenschnelle hing Serena an der Infusion. »Man hätte halt gleich auf Dr. Williams hören sollen!«, erzählte sie Haskell.
Doch damit waren Serenas Probleme leider nicht vorbei. Durch heftige Hustenanfälle, ausgelöst durch die Blutgerinnsel in ihrer Lunge, brach ihre Kaiserschnittnaht auf, und Serena musste erneut operiert werden. Dabei entdeckten die Ärzte ein lebensbedrohliches Hämatom in ihrem Bauch, das sich als eine Nebenwirkung des Blutverdünners dort gebildet hatte. Es folgte eine weitere Operation, bei der ein Filter in die Hohlvene eingeschoben wurde, um weitere Blutgerinnsel daran zu hindern, in ihre Lunge zu gelangen. Eine Woche später wurde Serena nach Hause entlassen, wo sie weitere sechs Wochen, sprich die ersten Wochen im Leben ihres neugeborenen Babys, ans Bett gebunden war, unfähig aufzustehen.
Eine Einzelgeschichte, klar, und kein Beweis für irgendwas an sich. Doch die Geschichte schlug hohe Wellen. Sie kam mir sowie offenbar auch vielen anderen Schwarzen Frauen und Gebärenden[4] nur allzu bekannt vor, denn was folgte, war eine wahre Flut an Reaktionen in den sozialen Medien, wo etliche von ihnen von eigenen Erlebnissen erzählten: davon, wie es ist, von medizinischem Personal abgewimmelt, angezweifelt oder nicht ernst genommen zu werden.2 Serena nutzte ihre Plattform, um darauf aufmerksam zu machen, dass Schwarze Frauen in den USA sehr viel häufiger an Komplikationen während der Schwangerschaft und bei der Geburt sterben als weiße. Die Beweise sind erschütternd: Laut des US Center for Disease Control and Prevention (CDC), einer Behörde des US‑amerikanischen Gesundheitsministeriums, starben zwischen 2014 und 2017 dreimal so viele nicht-hispanische Schwarze Frauen wie nicht-hispanische weiße Frauen infolge von Komplikationen bei Schwangerschaft oder Geburt (konkret: 42 Schwarze Frauen pro 100 000 Lebendgeburten gegenüber 13 weißen Frauen).3 Im gleichen Zeitraum lag die Sterberate der nicht-hispanischen amerikanischen Indigenen und Alaskischen Frauen zweimal höher als die von weißen Frauen. In einem Interview mit der BBC im Jahr 2018 beschrieb Serena diese Statistiken als »herzzerreißend«.4 »Die Ärzte hören uns einfach nicht zu«, sagte sie.
Elektrisiert von Serenas Geschichte und dem Echo, das sie im Netz fand, beschloss ich, tiefer in diese Zahlen einzutauchen. Mathematische Statistiken können todlangweilig sein, aber sie bilden auch eine solide Basis, um ein Verständnis für das Ausmaß des Problems zu entwickeln. Es ging mir darum, die schockierenden health gaps abzustecken, die sich bereits zu Beginn eines Lebens zeigen, ja, sogar noch bevor ein Leben beginnt. Ethnisch bedingte Ungleichheiten in Bezug auf die Gesundheit finden sich in allen Ländern, überall auf der Welt, beginnend mit der Schwangerschaft über die Geburt und weiter durch Kindheit und Jugend hindurch. Wir werden diesen Zahlen auf den Grund gehen und ein paar der Menschen hinter diesen Zahlen kennenlernen. Und von Forschenden werden wir erfahren, auf welche Weise Rassismus zu diesen verheerenden Ungleichheiten beiträgt.
Die nackten Zahlen, mit denen Serenas Geschichte die Aufmerksamkeit erregte, stammen aus US‑Statistiken des Pregnancy Mortality Surveillance System des CDC, das einen schwangerschaftsbedingten Tod definiert als den »Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder binnen eines Jahres nach Ende der Schwangerschaft aus jedweden Gründen, die mit der Schwangerschaft verbunden sind oder durch diese aggraviert werden«.5 Das CDC erhebt diese Daten aktiv seit 1987 durch Auswertungen der Sterberegister und der damit verknüpften Geburtenregister. Laut CDC war es vor 2006 nicht möglich, die Statistiken verlässlich in ethnische Kategorien jenseits von »Schwarz«, »Weiß« und »Sonstige« aufzuteilen, da statistisch ausreichende Daten für andere ethnische Gruppen fehlten. Dies änderte sich im Laufe der Zeit, als immer mehr Daten verfügbar wurden – ein besorgniserregender Umstand aber blieb bestehen: die Kluft zwischen Schwarzen und weißen Frauen, bezogen auf die schwangerschaftsbedingten Sterblichkeitsraten. Wie die Zahlen von 1987 bis 2017 zeigen, liegt die Sterblichkeit von Schwarzen Frauen durchweg drei- bis viermal höher als von die weißen Frauen.
Und nach 2017 sieht es nicht viel besser aus. Das National Vital Statistics System (NVSS), ein zwischenstaatliches System zur Auswertung der Mortalität (Sterberate) der US‑amerikanischen Bevölkerung, sammelt auch Daten zur maternalen Mortalität (Müttersterblichkeit) in den USA, die definiert ist als der »Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder binnen 42 Tagen nach einem Schwangerschaftsabbruch«, ausgenommen unfall- oder zufallsbedingte Todesfälle.6 Trotz dieser etwas restriktiveren Definition bleibt das Datenmuster unverändert. Stand 2019, dem Jahr mit den aktuellsten Zahlen zum Zeitpunkt meiner Recherchen für dieses Buch, starben zweimal mehr nicht-hispanische Schwarze Frauen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt als nicht-hispanische weiße Frauen.7 Aus weiteren Studien geht hervor, dass das Risiko einer hohen maternalen Morbidität und Mortalität bei indigenen Frauen in den USA etwa doppelt so hoch liegt wie bei nicht-hispanischen weißen Frauen.8
Doch erst ein paar Jahre später, als ich mit Michele Evans, einer Onkologin, die an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, zu ethnisch bedingten Ungleichheiten im Zusammenhang mit Gesundheit forscht, über Serena Williams’ Martyrium sprach, wurde mir richtig klar, warum das, was dem Tennis-Star widerfuhr, für dermaßen großes Aufsehen gesorgt hatte. »Schauen Sie sich Serena Williams an, sehr reich, Sportlerin. Serenas Erfahrung zeigt, dass die Vorstellung, man könne sich von Rassismus freikaufen, falsch ist«, sagte mir Evans. »Rassismus trifft nicht nur Frauen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status (socioeconomic status, SES). Auch Frauen mit einem hohen SES sind davon betroffen«, sagte sie. Und das spiegelt sich in den Daten wider: Es gibt Belege dafür, dass es im Zusammenhang mit Komplikationen und Mortalität bei Schwangerschaft und Geburt auch in den höchsten Einkommens- und Bildungsschichten ethnische Ungleichheiten gibt.
Wie eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, lag die schwangerschaftsbedingte Sterberate unter allen Frauen mit einem akademischen Abschluss bei Schwarzen Akademikerinnen immer noch mehr als fünfmal so hoch wie bei weißen Frauen.9 Tatsächlich lag die schwangerschaftsbedingte Sterberate unter Schwarzen Akademikerinnen fast doppelt so hoch wie bei weißen Frauen mit höchstenfalls High-School-Abschluss. Das bedeutet nicht, dass der Bildungsgrad – der stark mit Wohlstand und Einkommen verbunden ist – egal ist.10 Im Gegenteil: Der sozioökonomische Status, ob am Bildungsniveau oder am Einkommen gemessen, hängt eindeutig mit dem generellen Gesundheitszustand zusammen. Die mit einer Schwangerschaft verbundenen Letalitätsraten gingen mit zunehmendem Bildungsniveau zurück, nämlich ab dem Highschool-Abschluss, und zwar in allen ethnischen Gruppen. Kritisch zu betrachten aber ist, dass der sozioökonomische Status offenbar eine Art Schutzeffekt auf die Gesundheit hat, der bei weißen Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Schwarzen oder Indigenen Frauen. Das legt nahe, dass weitere Faktoren mit im Spiel sind.
Serena war sich ihres relativen Privilegs sehr bewusst. Der BBC gegenüber sagte sie, dass ihr Martyrium ohne die relativ gute medizinische Versorgung, die sie sich finanziell leisten kann, sicherlich noch schwieriger gewesen wäre: »Wenn ich mir vorstelle, dass all die anderen Frauen so etwas durchstehen müssen ohne die Versorgung, ohne die große Aufmerksamkeit, wie ich sie bekommen habe – furchtbar.«
Und sie hat recht: Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist von Bedeutung. Laut einem Bericht der US‑amerikanischen Wohltätigkeitsorganisation March of Dimes aus dem Jahr 2020 leben in den USA rund 7 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter in Gegenden, wo es keinen oder nur begrenzten Zugang zur Schwangerenversorgung gibt.11 Darüber hinaus stellen die Schließungen von immer mehr Geburtsstationen eine überproportionale Benachteiligung für Schwarze Frauen dar, und das schon seit Jahrzehnten. Eine Studie aus dem Jahr 2017 dokumentiert diesen Rückgang der klinikbasierten geburtshilflichen Versorgung in ländlichen Regionen quer durch die USA zwischen 2004 und 2014.12 Wie sich herausstellte, lag die Wahrscheinlichkeit, sämtliche klinikbasierten Leistungen zu verlieren, in Regionen mit einem vergleichsweise hohen Anteil an nicht-hispanischen Schwarzen Frauen und einem Haushaltseinkommen deutlich unter dem Mittelwert sehr viel höher. J’Mag Karbeah, Gesundheitsforscherin an der University of Minnesota, bereitet dieses Muster schon seit langem Sorgen. »Wie kann man behaupten, man tue alles für positive Geburtsergebnisse, zumal für Schwarze Frauen, wenn man in den Schwarzen Vierteln munter eine Entbindungsstation nach der anderen schließt?«, meinte sie. »Die Frauen werden wohl kaum in der Lage sein, vorgeburtliche Termine wahrzunehmen, wenn sie erst eine Stunde oder länger fahren müssen, um Zugang zu der Versorgung zu erhalten, die sie benötigen.«
Zugang zu gesundheitlicher Versorgung ist das eine, die Qualität dieser Versorgung das andere. Wie US‑amerikanische Studien zeigen, entbinden Schwarze Frauen im Vergleich zu weißen Frauen sehr viel häufiger in Kliniken, die hohe maternale Morbiditätsraten aufweisen und bei Indikatoren wie Geburtsbegleitung und Patientensicherheit ebenfalls schlecht abschneiden.13,14 Eine 2015 vorgenommene statistische Auswertung von Daten aus über 5000 Kliniken in allen Teilen der USA ergab für den Zeitraum von 2010 bis 2011, dass ein Viertel dieser Kliniken drei Viertel aller Schwarzen Frauen rund um die Entbindung betreute.15 Diese sogenannten »high Black-serving«-Kliniken mit einem hohen Anteil Schwarzer Frauen wiesen vergleichsweise höhere Raten schwerer maternaler Morbidität auf. Kein Zufall, denn diese Kliniken befinden sich häufig in Gegenden, die noch heute schwer am historischen Erbe der Rassentrennung (segregation) und den damit verbundenen Benachteiligungen für die Schwarze Bevölkerung tragen. Karbeah hob hervor, dass die Rassengesetze (racial covenants), wonach der nicht-weißen Bevölkerung ein Hauskauf in bestimmten Vierteln untersagt war, in ihrem Heimatbundesstaat Minnesota erst 1962 für verfassungswidrig erklärt worden waren.16 »Wenn wir heute die ethnischen Ungleichheiten im Gesundheitswesen betrachten«, sagte sie, »müssen wir gleichzeitig auch die nachhaltig spürbaren Auswirkungen, die die Geschichte der Rassentrennung hat und wohl noch lange haben wird, in den Blick nehmen.«
Versuche, so Karbeah weiter, ethnische Ungleichheiten in der schwangerschaftsbezogenen Mortalität ausschließlich auf die soziale Klasse oder den sozioökonomischen Status zurückzuführen, gingen am Kern der Sache vorbei. »Es gibt etliche Leute, die tönen, ›Nicht die Rasse, sondern die Klasse treibt all dies voran‹«, sagte sie. »Doch wir wissen, dass das nicht stimmt. Punkt. Aus.«
Wie wir in Kapitel Drei sehen werden, ist der systemische Rassismus ein wesentlicher Treiber für sozioökonomische Ungleichheiten in den USA und anderswo. Doch statt einfach zu behaupten, dass in den USA überproportional viele Schwarze Bürger:innen sterben, weil sie arm sind, sollten wir uns die Frage stellen, warum Schwarze in den USAüberhaupt überproportional arm sind. Es ist unmöglich, diese Frage zu beantworten, ohne sich mit der rassistischen Geschichte der USA und dem anhaltenden Erbe des systemischen Rassismus auseinanderzusetzen. »Durch diese Linse«, so Karbeah, »müssen wir die ethnische Kluft und ihre Auswirkungen auf die Müttergesundheit betrachten. Sie zeigt eine biologische Folge des Lebens in einem rassistischen Umfeld.«
Auch nachdem sich der Medienrummel um Serena Williams’ Geschichte gelegt hatte, ging sie mir nicht aus dem Kopf und beschäftigte mich weiter: Es gab so viele Menschen, die sich damit identifiziert hatten, so viele düstere Statistiken, die für die USA deutliche, ethnisch determinierte Ungleichheiten in der maternalen Mortalität offenbarten. Ich fragte mich, ob ähnliche Daten auch für Großbritannien verfügbar waren, wo ich damals lebte, um an meiner Dissertation zu arbeiten. Es dauerte nicht lange, bis ich auf ähnliche Ungleichheiten auch für Großbritannien stieß, obwohl die maternale Mortalitätsrate hier insgesamt fast viermal niedriger liegt als in den USA.
Eine Studie aus Großbritannien, in der Schwangerschaftsergebnisse für die Jahre 2017 bis 2019 erfasst sind, verzeichnet eine mehr als vierfach höhere maternale Mortalität unter Frauen mit afroamerikanischer Herkunft im Vergleich zu weißen Frauen, eine annähernd zweifach höhere Rate unter Frauen gemischt-ethnischer Herkunft und unter Frauen asiatischer Herkunft.17 In absoluten Zahlen: Von 100 000 Gebärenden starben 32 Schwarze Frauen, 15 Frauen mit gemischt-ethnischer Herkunft, 12 Frauen mit asiatischer Herkunft und 7 weiße Frauen. Über die bestehende Ungleichheit zwischen Schwarzen und weißen Frauen heißt es in einem Bericht des Britischen Parlaments aus dem Jahr 2020 mit dem Titel »Black people, Pregnancy and childbirth racism and human rights«: »Der NHS [National Health Service] erkennt diese Schieflage an und bedauert sie, entwickelt und formuliert aber keinerlei Gesundheitsziele, selbige zu beheben. Dies muss korrigiert werden.«18
Diese Unterschiede sind nichts Neues: Eine Analyse zur Entwicklung der maternalen Mortalität im Zeitraum von 2009 bis 2017 in Großbritannien konstatiert ähnliche Ungleichheiten zwischen asiatischen und weißen Gruppen sowie zwischen Schwarzen und weißen Gruppen und kommt zu dem Schluss, dass die Schere der maternalen Mortalität zwischen Schwarzen und weißen Frauen im Verlauf der Zeit immer weiter auseinanderging.19 Und die Corona-Pandemie trug nicht gerade zur Verbesserung der Lage bei. Wie aus einer britischen Studie hervorgeht, die zu Beginn der Pandemie zwischen dem 1. März und dem 14. April 2020 durchgeführt wurde, gehörten 56 Prozent der schwangeren Frauen, die mit Corona in ein Krankenhaus aufgenommen wurden, einer Schwarzen, asiatischen oder anderen ethnischen Minderheit an.20
Am 19. April 2021 debattierte das Britische Parlament über eine Petition zur Senkung der Müttersterblichkeit und einer verbesserten Gesundheitsversorgung für Schwarze Frauen im Vereinigten Königreich.21 Die Petition wurde von Tinuke Awe und Clotilde Abe eingebracht, Mitbegründerinnen von Five X More, einer Grassroots-Initiative, die sich in Großbritannien für Gleichbehandlung und mithin bessere maternale Gesundheitsergebnisse bei Schwarzen Frauen und Gebärenden starkmacht. Die Labour-Abgeordnete Bell Ribeiro-Addy berichtete in der Debatte von ihrer eigenen erschütternden Erfahrung während der Schwangerschaft.
»Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich ein Lied davon singen, dass man als Schwarze schwangere Frau nur selten wahr- oder gar ernst genommen wird, und dass dies einen drastischen Einfluss auf die weitere Behandlung hat – artikulierte körperliche Beschwerden oder Schmerzen werden ignoriert, CT- oder MRT-Scans werden verweigert. Wir alle wissen, dass man Schwarze Frauen für schmerzresistenter hält als weiße. Wir wissen das, haben aber kein ausformuliertes Gesundheitsziel, dies zu beenden«, sagte Ribeiro-Addy vor dem Parlament. »In meinem Fall verschlechterte sich mein Zustand immer weiter. Ich war komplett aufgequollen. Mein Blutdruck stieg dermaßen stark an, dass mir schwindelig wurde und ich Nasenbluten bekam«, erinnerte sie sich. Einmal war ihr so elend, dass ihr Arzt sie für weitere Untersuchungen und Scans eilends in ein Krankenhaus einwies, wo sich der Verdacht auf Gestose (auch Schwangerschaftsvergiftung oder Präeklampsie genannt) bestätigte – eine schwangerschaftsbedingte Anpassungsstörung des Körpers, die sich durch arteriellen Bluthochdruck äußert. »Und die Fachärzt:innen sagten, meine Schwangerschaft habe sich höchst gefährlich entwickelt, und es gebe nur zwei Möglichkeiten: entweder mein Kind werde sterben, oder wir beide, ich und mein Kind. Für irgendwelche Eingriffe sei es bereits zu spät, und auch einfachste Maßnahmen – ich fand heraus, dass in einem früheren Stadium bereits Aspirin geholfen hätte – würden nichts mehr bringen.«
Die Ärzt:innen empfahlen Ribeiro-Addy einen Schwangerschaftsabbruch und die Einleitung der Geburt, um ihr eigenes Leben zu retten. Man sagte ihr, dass sich ihr Zustand rapide verschlechtern würde, so dass sie umgehend jemanden benennen müsse, der Entscheidungen für sie treffen könne, sollte sie das Bewusstsein verlieren. »Um diese Entscheidung kam ich noch mal herum, denn der tags darauf anberaumte Ultraschall zeigte, dass das Herz meines Babys aufgehört hatte zu schlagen.« Die Geburt wurde eingeleitet, und nach etwa 18 Stunden Wehen gebar Ribeiro-Addy eine Tochter. »Gläubig, wie ich bin, hatte ich selbst da noch die Hoffnung, dass die Ärzt:innen sich vielleicht geirrt hätten und alles gut werden würde … aber die Kleine rührte sich nicht, sie weinte nicht, und es geschah auch kein Wunder.«
Ribeiro-Addy verwies auf weitere Studien für den Zeitraum von 2005 bis 2013: Im Vergleich zu weißen Frauen in Großbritannien lag das Risiko für eine schwere mütterliche Morbidität bei afrikanischen Frauen, zu denen sie sich selbst zählt, um 83 Prozent höher, bei afrokaribischen Frauen um 80 Prozent.22 Und das nach der Bereinigung um andere Faktoren, die bekanntermaßen mit schwerer mütterlicher Morbidität verbunden sind, also zum Beispiel bestehende Vorerkrankungen, Body-Mass-Index (BMI), sozioökonomischer Status und verhaltensgebundene Risikofaktoren wie beispielsweise das Rauchen. »Wir haben weder ein nationales Gesundheitsziel formuliert, um diesen Zustand zu beenden«, sagte Ribeiro-Addy, »noch wissen wir, mit welchen gesundheitsrelevanten Problemen Schwarze Frauen weiterhin permanent konfrontiert sein werden.«
Die USA und Großbritannien bilden hier keine Ausnahme. Auch in vielen anderen Ländern, für die entsprechende Statistiken vorliegen – darunter Indien, China, Brasilien, Nigeria, Mexiko und Australien, um nur einige zu nennen –, zeigen sich auffällige Ungleichheiten bezüglich der maternalen Gesundheit zwischen rassifizierten und ethnisch markierten Gruppen wie auch benachteiligten Gruppen im Kastensystem.23,24,25,26,27,28,29,30 Ein großes Problem, das durch ein enormes Gefälle der maternalen Mortalitätsraten je nach Weltregion noch verschärft wird. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Gesamtrate der maternalen Mortalität stark vom Einkommen abhängig und lag 2020 in Ländern mit niedrigem und niedrig-mittlerem Einkommen bei knapp 94 Prozent.31 Infolgedessen sind People of Colour auch auf globaler Ebene überproportional stark betroffen; auf Subsahara-Afrika und Südasien entfielen im selben Jahr etwa 87 Prozent der geschätzten Gesamtzahl der Fälle von Müttersterblichkeit weltweit.
■
D’lissa Parkes war überglücklich, als sie erfuhr, dass sie schwanger war. Die in London ansässige Erzieherin liebte Kinder und riss sich darum, auf ihre Nichten und Neffen aufzupassen. »Sie war Familienmensch durch und durch, freute sich immer riesig auf Familientreffen, fieberte Geburtstagen und Weihnachten entgegen und konnte es jedes Jahr kaum abwarten, sich an Heiligabend in einen schönen neuen Pyjama zu kuscheln«, schrieb ihre Mutter Sylvia in einem Blog auf der Website Five X More.32 »Sie war das Herz und die Seele jeder gemeinsam verbrachten Zeit mit der Familie.«
Ungefähr in der siebten Woche ihrer Schwangerschaft kam es bei D’lissa zu Blutungen. Ihre Ärztin veranlasste einen Ultraschall, der eine Wucherung in ihrem Unterleib zeigte. Sie hatte in der Vergangenheit unter schweren Verstopfungen gelitten und die Diagnose Dickdarmerweiterung bekommen. Die Wucherung, so Sylvia, sei auch bei allen nachfolgenden Ultraschalluntersuchungen sichtbar gewesen, dabei aber ignoriert und nicht mit ihrer Schwangerschaft in Verbindung gebracht worden. Dann, in der 37. Woche, wurde eine Steißlage ihres Babys festgestellt. Bei einer Erstgeburt, und das war es für D’lissa, sollte sich das Baby um diese Zeit bereits in die Schädellage gedreht und sich mit dem Kopf voran nach unten ins Becken geschoben haben, genau richtig rum für die Geburt. Doch das passiert nicht immer, und das Baby bleibt bis zum Einsetzen der Wehen in Steißlage. D’lissa begab sich für eine manuelle Drehung, eine sogenannte äußere Wendung bei Beckenendlage, ins Krankenhaus, wo fachmännische Hände durch sanften Druck auf den Bauch versuchten, das Baby in die Schädellage zu bringen. Eine Woche später war D’lissa zurück im Krankenhaus, wo sie derselbe Arzt untersuchte, der die äußere Wendung durchgeführt hatte. Sie habe starke Schmerzen gehabt, erzählte Sylvia später in einem Interview für eine BBC-Dokumentation, und der Muttermund sei bereits um einen Zentimeter geweitet gewesen.33 Zu diesem Zeitpunkt, so Sylvia, war der Kopf des Babys noch nicht tief in den Geburtskanal eingetreten, was die Weitung des Muttermunds erklärt hätte. Aber der Arzt beteuerte, es sei alles normal, denn die Becken von Schwarzen Frauen seien nun mal anders geformt als die von weißen Frauen. Und so schickte er D’lissa wieder nach Hause.
Einen Tag später, in den frühen Morgenstunden, setzten bei D’lissa die Wehen ein, und sie kam erneut ins Krankenhaus, wo schnellstmöglich ein Notkaiserschnitt vorgenommen wurde. D’lissa starb. In ihrer Lunge hatte sich ein Blutgerinnsel gebildet, und ihr Herz blieb stehen. Ihre Tochter, S’riaah Christina, überlebte mit schweren Hirnverletzungen und es wurde eine Zerebralparese, eine Gehirnlähmung, diagnostiziert.
Eine gerichtliche Untersuchung ergab, dass der Hauptrisikofaktor für D’lissas Tod die Schwangerschaft gewesen war.34 Andrew Walker, der Gerichtsmediziner, konstatierte aber auch grobe Sorgfaltsmängel, darunter das Versäumnis seitens des medizinischen Personals, D’lissas Krankenakte anzufordern, die Informationen über ihre langjährige Obstipation und vorherige Diagnosen enthielt. In ihrem Dickdarm hatte sich eine Koprostase gebildet, eine Anhäufung verfestigten Kots, die ihre Gebärmutter verformte, was die sie betreuenden Hebammen während der Wehen- und Geburtsphase aufgrund der fehlenden Einsicht in die Krankenakte nicht wussten. »Dies hat allenfalls in geringem Maße zu ihrer Lungenembolie [Blutgerinnsel in der Lunge] beigetragen, der Hauptrisikofaktor lag in der Schwangerschaft an sich«, so Walker in seinem Befund. Er sagte auch, dass es eigentlich angezeigt gewesen wäre, D’lissa bei ihrem Klinikbesuch einen Tag vor ihrem Tod stationär aufzunehmen, da ein akutes Risiko für mögliche Schädigungen an ihrem ungeborenen Baby bestanden habe; für ihre eigenen Überlebenschancen, so fügte er hinzu, habe die Entlassung allerdings keine Rolle gespielt. In ihrem Blog schrieb Sylvia: »Ich bleibe dabei. Ihr Tod hätte verhindert werden können, hätte man sie ernst genommen, als sie am Tag vor ihrem Tod das Krankenhaus aufsuchte und man sie wieder nach Hause geschickt hatte. Ich bin keine Medizinerin … aber ich bin ihre Mutter.«
Als ich erstmals hörte, was mit D’lissa passiert war, war ich am Boden zerstört. Ich war damals sechsundzwanzig – zufälligerweise genauso alt wie sie, als sie starb. Das Team von Five X More hatte Sylvias Blog über den Verlust ihrer Tochter auf seiner Website veröffentlicht, und zwar an D’lissas 31. Geburtstag, der in Großbritanniens erste Black Maternal Mental Health Week fiel, die für September 2020 organisiert war. Die Wissenschaftlerin in mir grübelte immer wieder über die medizinischen Details, die Sylvia so freimütig veröffentlicht hatte. Und während ich die Details genauer betrachtete, fiel mir eine Sache auf: Die Vorstellung, wonach das Becken einer Schwarzen Frau anders geformt sein soll als das einer weißen Frau (worauf sich der Arzt bezog, den D’lissa nur einen Tag vor ihrem Tod aufgesucht hatte) ist, gelinde gesagt, fragwürdig.
1933 veröffentlichten die in New York ansässigen Geburtshelfer William Caldwell und Howard Moloy eine Beschreibung der weiblichen Beckenanatomie. Noch heute sind ihre Darstellungen in Lehrbüchern für Medizin und Geburtshilfe zu finden.35 Caldwell und Moloy analysierten die menschlichen Skelette einer im frühen 20. Jahrhundert zusammengetragenen Sammlung und kategorisierten vier Subtypen weiblicher Beckenformen: »gynäkoid«, »platypeloid«, »android« und »anthropoid«. Diese Kategorisierungen bauten auf früheren Bezeichnungen von William Turner auf, einem britischen Arzt und Anatom des 19. Jahrhunderts.36 Turner konzentrierte sich in seiner Arbeit auf die vorherrschenden Beckenformen der verschiedenen races und deren vermutete Geburtstauglichkeit. Turner zufolge war die »gynäkoide« Beckenform »charakteristisch für die höher zivilisierten und entwickelten Rassen der Spezies Mensch« – soll heißen der weißen Europäer:innen, wie er selbst einer war –, während die »anthropoide« Formung »häufiger bei Rassen von eher niederer Art der Spezies Mensch beobachtet wurde und eine degradierte oder animalisierte Ausprägung aufwies«.
Die Caldwell-Moloy-Klassifikation trug dazu bei, diese rassifizierten Kategorisierungen in die geburtshilfliche Literatur des 20. Jahrhunderts zu übertragen, zu einer Zeit, da Krankenhausgeburten in der westlichen Welt immer üblicher wurden.37 1949 veröffentlichte der deutsch-schweizerische Primatologe und Anthropologe Adolph Schultz an der Johns Hopkins University School of Medicine in Maryland eine Arbeit, in der er Messungen der Beckenknochen einer »adulten N*****« mit denen von adulten weiblichen Menschenaffen und anderen Affenarten verglich.38 Auch in den USA gab es permanent vergleichende Studien zu Beckenformungen von Schwarzen Frauen und weißen Frauen.39,40 Im Jahr 2002 wurden im Rahmen einer vergleichenden Studie 80 Skelette aus der Hamann-Todd-Sammlung analysiert[5] . Das Ergebnis: Die Beckenbodenfläche bei Afroamerikanischen Frauen war im Schnitt um 5 Prozent kleiner als bei weißen europäisch-amerikanischen Frauen. Doch zu jener Zeit, als man die Skelette zusammentrug, erfolgte die Einteilung lediglich in die Kategorien »Schwarz« und »Weiß«, teils basierend auf rassistischen Annahmen über Becken-Anatomie. Einer der Sammler, Thomas Wingate Todd, konstatierte gar, dass »das schmale Becken ein so auffälliges N****-Merkmal ist, und der ermittelte Durchschnitt um so viel schmaler als das von Proben anderer amerikanischer N****, dass es sehr wohl als Indiz für einen reinen N****-Beckentyp gelten kann.«41 Dies zeigt insofern eine klare einseitige Verzerrung, als dass die Sammler damals für die Einteilung der Menschheit in verschiedene »rassische Großgruppen« nach phänotypischen Merkmalen genau solche vermuteten anatomischen Unterschiede heranzogen, um die Idee der Einteilung in »Rassen« zu untermauern. Für die Autor:innen der Studie von 2002 ist das allerdings viel zu kurz gegriffen: »Diese Klassifizierungen [nach phänotypisch zusammengehörigen ›Großrassen‹] machen keine vollständigen Angaben zur Herkunft der Proben. Rasse ist ein abstrakter Begriff, der auf die gesellschaftliche Deutung beschränkt ist.«
Eine aktuellere Auswertung der Becken-CTs von 64 freiwilligen Probandinnen in Australien ergab keine offensichtliche Einteilung in vier Subtypen von Beckenformen, wie sie Caldwell und Moloy klassifiziert hatten, sondern vielmehr ein »amorphes, diffuses Kontinuum von Formvarianten«.42 Die 2015 veröffentlichte Studie empfahl Dozent:innen und Autor:innen in Bereichen rund um die Geburtshilfe und Gynäkologie, die Klassifizierung nach Caldwell-Moloy mit Vorsicht zu genießen. Spätere Forschungen haben gezeigt, dass die Form des Geburtskanals sowohl innerhalb als auch zwischen menschlichen Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Regionen der Welt stark variiert. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die Geburtskanalformen bei Populationen auf fünf Kontinenten untersuchte, ergab eine »durchgängige Variationsbreite des Geburtskanals, ohne abrupte Unterschiede zwischen den Regionen«.43
Weibliche Becken gibt es in allen Formen und Größen, und das hat nichts mit irgendeiner »Rasse« zu tun. D’lissas Arzt lag falsch – und ist damit leider nicht allein. Das hartnäckige Stereotyp, wonach sich die Becken Schwarzer Frauen von denen weißer Frauen unterschieden und ihnen sogar unterlegen seien, ist nur ein Beispiel von vielen, wie sehr wissenschaftlicher Rassismus in der medizinischen Praxis immer noch verhaftet ist. Darauf werden wir später in diesem Buch noch detaillierter eingehen. Diese besondere Form des wissenschaftlichen Rassismus zielt aber nicht nur auf Schwarze Frauen. Im Mexiko des 19. Jahrhunderts beschrieb der Entbindungsarzt Francisco Flores y Troncoso die Becken von Indigenen Frauen als »nach unten und hinten« gerichtet und als minderwertig gegenüber denen von weißen spanischen Frauen. Flores y Troncoso vertrat sogar die Ansicht, dass »Rassenvermischung« die eigentliche Ursache für die »nach unten und hinten« gerichteten Becken der mexikanischen Frauen sei. Diese Vorstellungen dienten später als Legitimation von Plänen zur eugenischen Sterilisation aufgrund einer vermeintlichen »Becken-Unzulänglichkeit« bei Indigenen Frauen in Mexiko.44
Rassistische Vorstellungen über die weibliche Becken-Anatomie sind Teil einer längeren Geschichte von Rassismus und Diskriminierung in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Der US‑amerikanische Arzt William Potts Dewees, einer der frühen Pioniere auf dem Gebiet der Geburtshilfe, glaubte, dass wohlhabende weiße Frauen während der Geburt mehr litten als vergleichsweise arme weiße oder Schwarze Frauen, da die Zivilisation ihre Gehirne empfindlicher gemacht habe.45 Unterdessen führte der Arzt und Chirurg James Marion Sims, oft als »Vater der modernen Gynäkologie« bezeichnet, experimentelle Operationen ohne Narkose an versklavten Schwarzen Frauen durch.46
Dieses Versagen, sich in den Schmerz Schwarzer Frauen einzufühlen oder ihn gar anzuerkennen, stellt bis heute ein Problem dar. »Es ist diese Verpflichtung, Schwarze Menschen in ihrem Menschsein zu ignorieren, die uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind«, bemerkte Karbeah. »Die Leute glauben [Schwarzen Frauen und Gebärenden] einfach nicht, wenn sie so was sagen wie ›Mir geht es nicht gut‹. So wie im Fall von Serena Williams, es wird ihnen einfach nicht zugehört, wenn sie Sorgen und Ängste äußern«, sagte sie.
Laut Jenny Douglas, Forscherin im Bereich Public Health an der Open University in Milton Keynes, der größten staatlichen Universität in Großbritannien, könnte die über so lange Zeit geradezu besessene Fokussierung darauf, nach biologischen Unterschieden zwischen »Rassen« zu suchen, davon ablenken, die Grundursachen heutiger Unterschiede in der Müttergesundheit zu erforschen. Mit Blick auf die Erforschung von Faktoren, die zu ethnischen Ungleichheiten bei Schwangerschafts- und Geburtsergebnissen beitragen, sagte sie mir: »Wir verschwenden nur Geld, indem wir nach biologischen Erklärungen suchen.« In Großbritannien beispielsweise, wo Douglas seit Jahrzehnten zur Gesundheit Schwarzer Frauen forscht, würde sie es begrüßen, wenn Studien zu Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frauen stärker in den Blick genommen würden.
»Was wir dringend brauchen, sind noch viel mehr qualitative Forschungen über die Erfahrungen Schwarzer Frauen in der Gesundheitsversorgung und Schwangerenbetreuung«, erklärte sie. »Schwarzen Frauen wird nicht zugehört, Schwarzen Frauen wird nicht geglaubt, Schwarze Frauen erfahren nicht die gleiche Versorgung wie weiße Frauen.« Und in der Tat, trotz des großen Gefälles der Müttersterblichkeit zwischen Schwarzen und weißen Frauen gibt es nur wenige Studien, die sich mit den real empfundenen Wahrnehmungen Schwarzer Frauen und Gebärender in der Gesundheits- und Schwangerenversorgung in Großbritannien systematisch befassen. »Wir haben Forschungsvorschläge eingereicht, die nicht finanziert wurden«, sagte Douglas. Die Grassroots-Initiative Five X More arbeitet daran, diese Informationslücke zu schließen und hat dazu im April 2021 erstmals eine landesweite Studie namens »Black Maternity Experiences Survey« gestartet, geleitet von einem Team Schwarzer Frauen – darunter auch Douglas und weitere Expert:innen für maternale Gesundheit in Großbritannien.
Die Ergebnisse dieser Studie veröffentlichte Five X More im Mai 2022:47 43 Prozent der Schwarzen oder Mixed Frauen berichteten, sich im Verlauf ihrer Schwangerschaftsbetreuung diskriminiert gefühlt zu haben; ein ähnlich hoher Anteil bewertete die Betreuung während der Geburt als »schlecht« oder »sehr schlecht«. Im Rahmen der umfassenden Befragung mit mehr als 1000 Schwarzen oder Mixed Frauen, die in Großbritannien zwischen 2016 und 2021 schwanger gewesen waren und gesundheitliche Versorgung vor und während der Geburt in Anspruch genommen hatten, konnten die Teilnehmerinnen auch untereinander ihre persönlichen Geschichten austauschen. Was dabei immer wieder durchklang, war das Gefühl, vom medizinischen Personal links liegen gelassen worden zu sein. Ihre »Sorgen« seien ignoriert worden, als würden ihre »Gedanken und Gefühle gar keine Rolle« spielen, was sie »verängstigt« zurückließ. In einigen Fällen führte dies zu Notfallsituationen, wie eine der Teilnehmerinnen berichtete: »Am Ende musste meine Tochter per Notkaiserschnitt geholt werden, weil ihr Herzschlag abgefallen war […] Und alles nur, so mein Eindruck, weil die Hebamme mich stundenlang wie Luft behandelt hatte, während ich ihr begreiflich zu machen versuchte, dass irgendwas nicht stimmte.«
Laut Bericht von Five X More zu dieser Befragung schilderten viele Frauen auch Situationen, in denen man ihnen indirekt zu verstehen gegeben hatte, sich gefälligst nicht so anzustellen und ihre Wehenschmerzen doch bitte zu beherrschen. Aber auch im Vorfeld des eigentlichen Geburtsvorgangs sind rassistische Unterstellungen keine Seltenheit, wie die folgende Episode verdeutlicht: »Gleich beim ersten Vorsorgetermin sagte eine Krankenschwester, sie könne es kaum fassen, dass ich wisse, wer der Vater sei. Menschen wie ich wüssten das normalerweise nicht.« Eine andere Frau erzählt von ihrem Erlebnis während der Geburtswehen: »Dass die Eröffnungsphase bei mir so lange dauere, liege ›wahrscheinlich am afrikanischen Becken‹, sagte mir eine Hebamme während der Untersuchung. […] Ich war unglaublich verletzt, da sie wirklich glaubte, es gäbe so etwas wie ein ›afrikanisches Becken‹.« Der Bericht von Five X More kam zu dem Schluss, dass die Erfahrungen Schwarzer Frauen in Großbritannien während der vor- und nachgeburtlichen Betreuung insgesamt »von rassistischer Ungleichheit geprägt sind«.
In derselben Woche, in der Five X More 2022 ihren Bericht veröffentlichte, brachte auch die britische Wohltätigkeitsorganisation Birthrights – ursprünglich gegründet, um zu verhindern, dass Frauen und Babys während der Schwangerschaft und bei der Geburt sterben – einen eigenen Bericht heraus, der auf einer langjährigen Untersuchung zu rassistisch motivierten Ungerechtigkeiten und Menschenrechten in der Geburtshilfe und Mütterversorgung in Großbritannien basierte.48 Er kam zu dem Schluss, dass Schwangere und Gebärende Schwarzer und asiatischer Herkunft durch rassistische Diskriminierung in der Betreuung Nachteile erlitten.
Des Weiteren legen frühere britische Studien zur Schwangerenversorgung nahe, dass Frauen ethnischer Minderheiten diesbezüglich generell schlechtere Erfahrungen machen als weiße Frauen. Eine britische Erhebung aus dem Jahr 2010 zu Betreuungsverläufen während Schwangerschaft und Geburt mit 24 000 teilnehmenden Frauen kam zu folgendem Ergebnis: Frauen aus ethnischen Minderheitengruppen berichteten seltener als weiße Frauen von einer rundum guten Begleitung durch Schwangerschaft und Geburt, hatten vergleichsweise seltener das Gefühl, verständlich und nachvollziehbar über alles aufgeklärt, empathisch und freundlich begleitet und ausreichend in Entscheidungen einbezogen zu werden oder sich vertrauensvoll in betreuende Hände begeben zu können.49 Diese Ergebnisse decken sich mit denen einer kleineren, offen angelegten Umfrage mit anonymisierten Antworten, die in etwa zur gleichen Zeit ebenfalls in England durchgeführt wurde.50 So etwa erzählt eine dieser anonymen Schwarzen Frauen: »Auf der Wöchnerinnenstation wurde ich ignoriert, hatte das Gefühl, hier überhaupt nicht erwünscht zu sein. Als man mich dann aufforderte, nach Hause zu gehen, obwohl ich noch eine Zeit der Ruhe und Erholung gebraucht hätte, gab ich klein bei und ging.« Eine andere anonyme Teilnehmerin der Umfrage, eine asiatisch-stämmige Frau, beschrieb folgende Situation: »Die Hebamme nahm die Schmerzen, die ich hatte, nicht weiter ernst und ging darüber hinweg … und obwohl ich sie wiederholt darauf ansprach und mehrfach betonte, dass ich und mein Mann studierte Ärzt:innen seien, wurde ich vorzeitig entlassen, unter höllischen Schmerzen.«
Geschichten wie diese spiegeln sich auch in Statistiken aus den USA wider, wo es sehr viel mehr Studien und dokumentierte Erfahrungen mit impliziten Formen von Vorurteilen und Rassismus in der Schwangerenbetreuung gibt, die dann teilweise sogar mit schlechteren Geburtsergebnissen in Verbindung gebracht werden, insbesondere bei Schwarzen und Indigenen Frauen.51,52,53,54,55,56 Landesweit berichten BIPoC-Frauen tendenziell häufiger als weiße Frauen, während ihrer Schwangerschaft oder Geburt mindestens eine Form von falscher oder schlechter Behandlung durch eine medizinische Fachperson erlebt zu haben.57 Und laut einer 2016 durchgeführten Befragung unter Frauen, die in jenem Jahr im US‑Bundesstaat Kalifornien entbunden haben, berichten mehr als 10 Prozent der befragten Schwarzen Frauen von einer wahrgenommenen Ungleichbehandlung aufgrund rassistischer Vorurteile, im Vergleich zu nur 1 Prozent der befragten weißen Frauen. Darüber hinaus berichten Schwarze Frauen häufiger als weiße Frauen, sich während der Wehen und des Geburtsvorgangs unter Druck gesetzt und sich zu medizinischen Interventionen wie der Gabe von Wehenmitteln, PDA (Periduralanästhesie) etc. gedrängt gefühlt zu haben, sowie davon, nicht ermutigt worden zu sein, das Geburtsprozedere aktiv und selbstbestimmt nach ihren individuellen Bedürfnissen mitzugestalten.58 Negative Erfahrungen wie diese, kombiniert mit Klischees über Schwarze Frauen, die angeblich immer wütend oder schwierig sind, halten Schwarze Schwangere und Gebärende möglicherweise davon ab, um Hilfe zu bitten, wenn sie sie brauchen. »Wenn du als Schwarze Frau etwas willst und Ansprüche stellst, wirst du als Problem gesehen«, so Douglas. »Und so sprechen Schwarze Frauen oft gar nicht aus, wie sie sich fühlen, weil sie wissen, dass ihnen sowieso niemand wirklich zuhört.«
Neben impliziten Formen von Vorurteilen und Erfahrungen mit Alltagsrassismus in der Gesundheits- und Schwangerenversorgung haben Women of Colour auch noch mit Vorurteilen zu rechnen, die in medizinischen Algorithmen und Behandlungsrichtlinien verankert sind. In den USA enthielt ein Algorithmus namens Vaginal Birth After Caesarean (VBAC) – ein Verfahren zur Bewertung der Sicherheit einer Vaginalgeburt nach einem vorangegangenen Kaiserschnitt – noch bis Mai 2021 spezifische Anpassungsmöglichkeiten nach race und ethnischer Herkunft.59 Diese Faktoren bedeuteten, dass für Schwarze und hispanische Frauen und Gebärende systematisch eine geringere Aussicht auf die sichere Option einer VBAC angenommen wurde als für weiße Frauen und Gebärende. Dies ist umso besorgniserregender angesichts der Tatsache, dass eine erfolgreiche spontane Entbindung nach vorausgegangenem Kaiserschnitt nachweislich gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel ein deutlich verringertes Risiko für Blutungen und Infektionen nach der Geburt oder Komplikationen bei weiteren Schwangerschaften.60
Faktoren wie race und ethnische Herkunft wurden in den VBAC





























