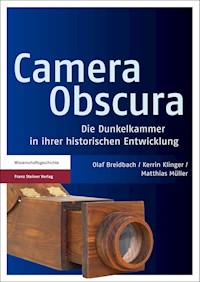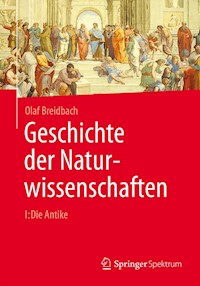10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Diskussion um Urteilsgrundlagen und Geltungsansprüche moderner Wissenschaften verweisen die Geisteswissenschaften häufig auf den sogenannten hermeneutischen Zirkel, der besagt, daß man immer nur nach den Mustern seiner Kultur zu denken vermag. Aber auch die Naturwissenschaften sind Teil unserer Kultur, und deren Objektivität wäre demnach ebenfalls historisch zu relativieren. Wie innerhalb dieser Relativierung dennoch Positionen bezogen und Orientierungen gefunden werden können, zeigt Olaf Breidbach in seinem neuen Buch. Er plädiert für eine konsequente, radikale Historisierung, die einen Weg weist, wie wir uns in unserer Geschichte selbst vergewissern und im Relativen zurechtfinden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
In der Diskussion um Urteilsgrundlagen und Geltungsansprüche moderner Wissenschaften verweisen die Geisteswissenschaften häufig auf den so genannten hermeneutischen Zirkel, der besagt, dass man immer nur nach den Mustern seiner Kultur zu denken vermag. Aber auch die Naturwissenschaften sind Teil unserer Kultur, und deren Objektivität wäre demnach ebenfalls historisch zu relativieren. Wie innerhalb dieser Relativierung dennoch Positionen bezogen und Orientierungen gefunden werden können, zeigt Olaf Breidbach in seinem neuen Buch. Er plädiert für eine konsequente, radikale Historisierung, die einen Weg weist, wie wir uns in unserer Geschichte selbst vergewissern und im Relativen zurechtfinden können.
Olaf Breidbach ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Naturwissenschaften an der Universität Jena, Direktor des Ernst-Haeckel-Hauses und Sprecher des SFB 482 »Ereignis Weimar-Jena – Kultur um 1800«.
Olaf Breidbach Radikale Historisierung
Kulturelle Selbstversicherung im Postdarwinismus
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-76720-7
www.suhrkamp.de
9Vorwort
Warum eigentlich betrachtet sich die Biologie, die durch die Evolutionslehre fundiert ist, als eine ahistorische Wissenschaft? Baut sie ihren Erkenntnisansatz auf der Evolutionslehre auf, ist sie von ihrer ganzen Konzeption her historisch angelegt. Wenn derart die von ihr betrachteten Strukturen als Resultat eines Prozesses begriffen werden, sie also nicht einfach als vorgegebene Größen zu beschreiben sind, dann stehen sie keineswegs in einem Raum absoluter Bestimmtheit. So lehrt uns denn auch heute die Physik, dass unsere Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten nur eine der möglichen Ordnungen der Materie darstellt. Die Naturwissenschaft mit ihrem Kalkül, den mathematischen Beschreibungen ihrer Aussagenzusammenhänge, operiert demnach in einer relativen Bestimmtheit, einer relativen Zeit – ohne den Halt absoluter Gewissheit. Einstein zeigt in seiner speziellen Relativitätstheorie, dass wir in unseren Beobachtungen immer nur auf uns selbst bezogen bleiben und dass das andere nach den uns zugänglichen Maßstäben zu bemessen und so an uns (beziehungsweise wir in ihm wieder an uns zurück) verwiesen ist. Dennoch werden mit diesem Ansatz eine in sich stimmige Beschreibung und damit eine Weltsicht möglich. Wieso verzweifelt dann aber eine Geisteswissenschaft, wenn ihr nichts bleibt als ein Relativismus, der ihr das Wahre, Schöne und Gute nicht mehr in den reinen Formen absoluter Gewissheit, sondern im Stil ihrer jeweiligen Kultur offeriert? Diese Relativierung führt nicht an den Abgrund, sie gibt vielmehr eine erste Sicherheit; sie lehrt, sich zu bescheiden, und erlaubt so, auch außerhalb des Absoluten Halt und Geltung zu finden.
Der vorliegende Text versucht darzulegen, was zu machen ist, um den Selbstzweifel an einer nur relativen Bestimmung abzulegen. Nur so sind die falschen Sicherheiten einer Weltsicht zu erkennen, die den Halt des bloß Relativen verwirft, ohne den universellen Maßstab zu besitzen, mit dem aus solch kleinteiliger Bestimmtheit herauszufinden wäre. Er zeigt auf, dass auch die in sich rückverwiesene Selbstbestimmung Halt bietet. Sie kann dies, indem sie in ihre Geschichte sieht. Nehmen wir die für uns zu überblickende Geschichte und damit auch die Geschichtlichkeit der eigenen Position 10ernst, finden wir aus den Unsicherheiten und Fehlbestimmungen eines inkonsequenten Relativismus heraus. Wir kennen die Positionen eines universellen Kulturalismus. Wir erfahren Naturalismen, in denen das Hirn den Geist, die Evolution den Sinn und das Schöne und vielleicht die Physik die Erlösung oder eben auch die Verdammnis unserer Kultur bestimmen sollen. Wir handeln nach und orientieren uns an diesen objektivierbar erscheinenden Konzepten, bleiben so aber in den alten Phantasien der vorobjektivierten Zeit stecken und sehen aus der Geschichte in das Grundlose einer uns nicht mehr verfügbaren Natur. In dieser suchen wir dann all das zu finden, was uns ansonsten verloren ginge. Die alten Fragestellungen und Heilsperspektiven hüllen wir derart allerdings nur in neue Kleider und kleiden uns so in unserer Gedankenführung damit eben nur oberflächig um, anstatt etwas Neues zu wagen. Gehen wir diesen Weg, bleiben wir auf den bekannten Lösungspfaden und gelangen auch nicht an neue Horizonte. Wie aber gewinnen wir neue Perspektiven, wie charakterisieren wir das dort in den Blick zu nehmende Fremde?
Zunächst sehen wir uns in einer Geschichte, die nichts als Verlauf ist, die als Geschichte nirgendwo hinführt, uns kein Ziel, keine Heilsperspektive ausweist. Wenn aber das, was wir tun, das, was sich um uns ereignet, nicht zu Höherem und Besserem führt, woran können wir uns dann noch festhalten, aus welcher Haltung können wir dann noch auf unser eigenes Leben zurück- oder vielleicht sogar in eine uns bestimmende Zukunft blicken? Bloß geschichtlich verortet, in einem Erinnerungsraum, der nur der Vorhof des möglichen Vergessens ist, findet sich keine Bestimmtheit, sondern nur Relativierung, kein Maßstab, sondern nur die Erfahrung des Momentanen. Dieses bloß Geschichtliche ist unsere Realität. Und an dieser Realität können wir festhalten. Wir müssen es auch – schon deswegen, weil wir gar keine andere haben. In der Bescheidung auf das Gegebene, im Eingehen auf das, was uns verfügbar ist, ist ein Grund gelegt, weiter ausgreifen zu können. Hier wird ein Raum durchmessen, in dem wir uns positionieren können. Hier findet sich der Ansatz, dem Problem der universellen Relativierung unserer Wertvorstellungen zu begegnen und mit ihm umzugehen. Solch ein Umgang ist möglich, wenn unsere Perspektive sich konsequent relativiert, um so ihre Bezugsgrößen kenntlich zu machen. Dies geschieht in der radikalen Historisierung unserer Position. Dabei 11akzeptieren wir, dass wir unsere Wertvorstellungen und Geltungsbestimmungen nur für eine bestimmte Zeit zu sichern vermögen. Dieser Eingrenzung unserer Sicherheiten können wir standhalten. Allerdings müssen wir dazu die Relativierung aushalten, der zufolge wir eben nicht mehr für alle Ewigkeiten tauglich sind. Hierzu müssen wir uns bescheiden und dann neu entdecken, wo in einer nur relativen Kennung Wege, Perspektiven und Horizonte zu finden sind. Im Auge des Sturms ist es ruhiger als in dessen Peripherie, und so ist es möglich, gerade dort das ein oder andere, wenn auch nur für einen Moment, dann aber mit nachhaltiger Konsequenz, in den Blick zu nehmen. Das vorliegende Buch ist solch ein Versuch. Es offeriert einen Text mit Stolpersteinen. Schließlich ist auf der einen Seite ein theoretischer Entwurf herauszuarbeiten, auf der anderen Seite aber sind die Geschichten zu erzählen, in denen sich dieser Entwurf realisieren lässt. Dabei ist zu fragen, ob in einer konsequent relativierenden Position überhaupt noch Geschichten zu erzählen sind, die etwas anderes als uns selbst reflektieren. Es ist zu fragen, ob in der Darstellung der Geschichte Positionen zu markieren sind, in denen das andere zu verstehen ist, und das ist dabei auch das, was vormals gesagt, gedacht und getan wurde. Nun ist Leopold von Rankes Idee, darzustellen, wie es eigentlich gewesen ist, alles andere als der Mainstream der heutigen geschichtlichen Forschung. Im Gegenteil, es scheint doch klar, dass das, was wir jetzt betrachten, immer nur durch unsere Brille gesehen wird. Diese Brille können wir nicht abnehmen, wir können aber ihre Abbildungswerte bestimmen – und so gibt es einen Weg heraus aus dem Engpass der Selbstbeschau. Es geht also darum, uns in der Geschichte zu verorten und die Ordnungen, in denen wir unser Wissen um unsere Kultur und unsere Positionen setzen, in ihrer historischen Bedingtheit zu erkennen. Es hilft uns nicht, in die Natur zu flüchten, die uns immer nur im Maßstab und nach den Vorgaben unserer Kultur verfügbar ist. Nur dann, wenn wir unsere Position konsequent relativieren, finden wir den Bezugsgrund, über den wir uns unsere Positionen zu sichern vermögen, um dann auch über den Rand des uns Offerierten hinausschauen zu können.
Der vorliegende Band sucht diese Idee eingehender darzulegen. Er beginnt mit einer Exposition, die uns zeigt, wie sehr unser Bild von Geschichte in den letzten 200 Jahren verändert wurde. Der Bruch einer Weltsicht, die 1859 mit Charles Darwins Konzept einer 12Evolutionslehre in eine neue Offenheit geführt und zeitgleich mit der ersten Messung von Sternabständen und der Entdeckung der Sternenalter, sowohl im Raum wie auch in der Zeit, in neue Dimensionen gesetzt wurde, ist uns bis heute noch nicht ganz bewusst geworden. Was bedeutet es für unsere Historie, wenn die Sonnen in einer Galaxis Tausende von Lichtjahren voneinander entfernt sind und wenn nunmehr das Alter der Erde in Milliarden Jahren zu messen ist? Die Menschheitsgeschichte und der Ort, an dem sie sich findet, werden in dieser Sicht zu einer Marginalie. Wenn dann noch klar ist, dass unser Sonnensystem selbst nicht ins Unendliche fortdauert, sondern seine Entwicklung enden wird, und wenn weiter eingesehen wird, dass wir nur in unserer Phantasie aus diesem System hinaus in andere Sternenreiche zu reisen vermögen, so stehen wir mit unserer Geschichte faktisch vor einem Ende. Wir haben die ins Absolute führende Zukunft verloren und behalten nur das uns nahe Morgen. Wir sind somit eingeschworen auf den Moment unseres Existierens und finden uns damit da, wo sich schon im Mittelalter ein Nikolaus von Cusa als der ganz Kleine zu verorten vermochte. [1] Nur haben wir nicht mehr das Absolute, auf das hin er sich selbst auch noch in seiner Kleinheit zu bemessen vermochte. Unsere Natur führt sich selbst an ihr Ende, sie wird verpuffen und alles das, was wir in ihr denken, mit sich nehmen. Das bedeutet, all die Phantasien eines Isaac Asimov, unsere Zivili13sation ins Unendliche wachsen zu lassen und so den Sinn unserer Existenz auch in der Säkularisierung einer rein naturwissenschaftlich getragenen Weltsicht in die Zukunft zu setzen, [2] zeigen sich an ihrer natürlichen Grenze. Es gibt für unsere Geschichte nicht dieses Übermorgen, aus dem heraus auf eine für den Einzelnen an sich verlorene Geschichte zurückzublicken ist. Die Menschheit steht nicht über der Natur, sie steht in ihr und ist mit ihr in deren Geschichte gesetzt. Dies ist zu verdauen, aber dies zeigt zugleich, dass wir in der Naturgeschichte zwar in anderen Dimensionen denken als in der Humangeschichte, dass sich aber strukturell das Geschehen in der Natur und das Geschehen der Historie im Endeffekt nicht unterscheiden. In beiden finden wir in sich unbestimmte, nur von den jeweiligen Bedingungen des Gegenwärtigen für Weiteres bestimmte Prozesse, beide laufen frei, beide haben nur den Moment sicher, und beide laufen an ein Ende.
Natürlich ist diese Idee, dass sich Zeiten begrenzen und demnach die Einbindung in eine Geschichte auch an ein Ende führen kann, alles andere als neu. Im ausgehenden 19. Jahrhundert diskutierte die Naturwissenschaft den Kältetod des Planeten. [3] Mitte des 20. Jahrhunderts entstand die Vorstellung, dass die Erde, bedingt durch die sich in einer späteren Phase der Sternenentwicklung aufblähende Sonne, den Wärmetod zu erleiden hätte. [4] Wobei sie dann nach der Idee eines pulsierenden Weltraumes nur der Endlichkeit des in einer bestimmten Pulsfolge immer wieder neu expandierenden Universums insgesamt vorwegliefe. Es geht hier aber nicht um den Pessimismus einer Geschichtsvorstellung, in der nun, nachdem ein positives Ziel für diese Geschichte als Schein enttarnt wurde, ein Ende gesetzt wird, so dass die Entwicklungsreihe einer sich kosmologisch bestimmenden Naturgeschichte zumindest in ihrer Negation bestimmt ist. Schließlich arbeiten wir in solchen Negativszenarien mit Werten, die in Dimensionen liegen, die weit 14über das hinausführen, was wir erdgeschichtlich bisher überhaupt beschreiben konnten. Die bezogen auf die Skalierung unserer Existenz faktisch ins Unendliche führende Naturgeschichte setzt ganze Kulturen in einen von ihnen noch nicht einmal näherungsweise zu erfüllenden Zeitrahmen. Wie wären in diesen Zeiträumen Erinnerungen zu führen, überhaupt das zusammenzustellen, was wir als Geschichte unserer Kulturen beschreiben könnten? Hier zeigt schon ein erster Blick, dass die Dimensionen auch des Zeitlichen eben nicht einfach als eine immer weiter fortzuschreibende Skala aufzunehmen sind. Es geht hier zunächst um kleine Einheiten, um Positionen, die zu überschauen und die demnach denn auch zu bestimmen sind. So ist Geschichte für uns immer auf das zu beschränken, das wir uns wirksam machen können. Geschichte ist Vergangenheit und damit immer beschränkt. Die apokalyptischen Szenarien einer über das uns Denkbare hinausführenden Realität, all die Träume einer ins Unendliche führenden Zivilisation sind doch nur Wolken, in denen nichts zu gründen ist. Sicherheit finden wir nur in dem uns Verfügbaren; und das ist das, was vergangen ist und auf dem wir aufbauen. Niemand käme auf die Idee, den Naturwissenschaften Geltung abzusprechen, wenn sie zeigen, dass der Kosmos endlich ist und demnach auch die für ihn grundlegenden Gesetzmäßigkeiten nur für eine bestimmte Zeit in Geltung sind: Eine so ihr Ende postulierende Physik setzt sich damit nicht selbst außer Kraft. Vielmehr gewinnt sie mit diesen Aussagen über die von ihr zu bestimmenden Grenzen, in denen sie ihren Gegenstandsbereich zu beschreiben vermag, einen hohen Grad an Bestimmtheit. Warum sollte dies in der radikalen Historisierung der Aussagen über kulturelle Geltungsbestimmungen anders sein? Schließlich ist die Kulturgeschichte stets auf eine Gegenwart bezogen, damit immer von einem momentanen Ende her zu erfassen und so dann auch faktisch immer auf dieses hin zu denken.
Die philosophische Diskussion um den Stellenwert des Historischen in seiner anthropologischen Dimension versuche ich nach der Exposition der Problemansatzes im zweiten Teil dieses Buches mit einer Darstellung der Aussagen Nicolai Hartmanns einzufangen. Daran schließt eine Diskussion der Heidegger’schen Auffassung von Zeit an, in der Zeit umfassend als Erlebniszeit begriffen und damit in einer neuen Weise verfügbar gemacht wird. Aufbauend auf der Position Martin Heideggers entwickelte Hans-15Georg Gadamer seine philosophische Hermeneutik, der für die Reflexionen um eine Verortung historischer Positionen speziell im deutschen Sprachraum große Bedeutung zukommt. Auch dieser Theorie suche ich zu folgen und ihre Konsequenz festzuhalten, um dann zu einer ersten Sicht der uns verfügbaren Begrifflichkeiten zu kommen.
Im dritten Teil des Buches geht es dann um die methodischen Grundlagen dieses Ansatzes. Dabei konzentriere ich mich auf wissenschaftsgeschichtliche Diskussionen, nicht zuletzt deshalb, weil es hier darum geht, einen Gesamtbestand des Historischen auf einer Mikroebene in der Vielfalt der Vernetzungen von Konzepten, Praktiken und Strukturen exemplarisch darzustellen und zu bewerten. Die Wissenschaftsgeschichte hat sich seit Jahrzehnten dieser Diskussion gestellt und dabei ein methodisches Repertoire erarbeitet, das gerade heute in umfassender Weise auch in der Kulturgeschichte rezipiert wird. [5] Den Ansatzpunkt der Analyse bildet Foucaults Konzeption des Diskurses, die hier eingehender verfolgt wird. In meinen Augen weitet sich insbesondere durch die Ansätze von Ian Hacking und Bruno Latour, die beide in jeweils anderer Weise neben die Entwicklung der Sprache und des Redens über Dinge die Praktiken des Umgangs mit den Dingen gesetzt haben, diese Problemstellung noch einmal aus. [6] Dabei sind dann eher wissenschaftshistorisch relevante Positionen wie die von Thomas Kuhn zu thematisieren, der am Ende des 20. Jahrhunderts die Vorstellung einer Entwicklung der Wissenschaften und damit auch der Kultur dieser Wissenschaften postulierte, die den Charme des Diskontinuierlichen zu vermitteln vermochte. [7] In meinen Augen zeigt sein Ansatz auf, wie Geschichte in den Wissenschaften gerade nicht gedacht werden kann. Es gibt eben nicht die radikalen Faunenschnitte der Ideen, [8] sondern Übergangsphasen, in denen sich 16Praktiken verfügbar halten, Versetzungen, in denen sich Konzepte verlagern; und es gibt Strukturvorgaben, die sich in einer Reihe von konzeptionellen Veränderungen erhalten. Damit aber gewinnt sich auch im anderen immer wieder ein Moment des Übernommenen und damit für die Analyse ein Ansatz, das Neue in Bezug auf etwas, was zumindest einmal bekannt war, zu verorten.
Ausgehend von diesen Positionen suche ich dann im abschließenden vierten Teil der vorliegenden Arbeit den Neuansatz einer radikalen Historisierung darzustellen, die kein Geschichtsbild, sondern eine Methode zur Analyse eines Traditionsgefüges an die Hand gibt. Es wird der methodische Ansatz vorgestellt, mit dem eine Reihe von Versetzungen verfolgt und somit das andere für uns in einer Weise verfügbar gemacht wird, dass es sich nicht auf das reduziert, was wir schon kennen. Diese Vorstellung ist vielleicht nur in ihrer Konsequenz innovativ, sie nimmt denn auch bewusst Momente der vorab diskutierten Positionen auf und führt sie durchaus im Sinne der Rheinberger’schen Episteme fort. Entsprechend werden dann im Anschluss an diese methodische Darstellung einzelne Positionen benannt, die, wie der Ansatz Hans-Jörg Rheinbergers, für die radikale Historisierung wertvoll sind und so in einer erweiterten oder leicht veränderten Interpretation in die hier vorgelegte Diskussion einfließen. Das betrifft außerdem die Konstellationsforschung sowie den Ansatz einer Ethnologie der Kultur, wie ihn Claude Lévi-Strauss vorgelegt hat und etwa Bruno Latour als Ideal einer Wissenschaftsgeschichte umriss, die für ihn mehr sein soll als die Darstellung wissenschaftlicher Ideen, sondern die in diesen Ideen eben eine Kultur insgesamt widerzuspiegeln erlaubt. [9]
Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen, wenn uns in Jena die Deutsche Forschungsgemeinschaft nicht erlaubt hätte, über Jahre die Mikrostudie Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 zu erarbeiten. Hier ließ sich jeweils im Detail testen, wie Geschichte in einem umfassenden interdisziplinären Sinne zu schreiben ist. Meinen Kollegen in diesem Unterfangen sage ich von Herzen Dank für im17mer währende Anregungen. Natürlich ist das, was ich hier darstelle, in all dem, was verquer und verstellt erscheint, nur mir zuzuschreiben. Das, was auch die Historiker »Daten« nennen können, Mikrosondierungen und Neubewertungen konkreter Abläufe, verdanke ich aber den Forschungen im Rahmen dieses Sonderforschungsbereiches. Hierzu allen und vor allem meinen engeren jetzigen und vormaligen Mitarbeitern im Sonderforschungsbereich und im Ernst-Haeckel-Haus der Universität Jena, Thomas Bach, Andreas Christoph, Christian Forstner, Jan Frercks, Uwe Hoßfeld, Kerrin Klinger, Matthias Müller, Nicolas Robin, Claudia Taszus, Daniel Ulbrich, Heiko Weber und Gerhardt Wiesenfeldt, sowie meinen langjährigen Kollegen im Vorstand des Sonderforschungsbereichs Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800, insbesondere Georg Schmidt und Klaus Manger, meinen Dank. Zu danken habe ich auch für die Diskussionen mit meinen Kollegen und Freunden Gian Franco Frigo, Wolfgang Neuser, Jürgen Jost, Stefano Poggi, Wilhelm Schmidt-Biggemann und Federico Vercellone. Frau Rita Schwertner unterzog den Text einer gründlichen Revision. Danken möchte ich ferner dem Lektorat des Suhrkamp Verlages, vor allem Frau Eva Gilmer und Philipp Hölzing, für ihre eingehende Betreuung dieses Textes. Meine Familie sah mir die Schreibtischstunden an unseren knappen Wochenenden nach. Meine Frau hat mich immer wieder ermutigt. Ihr ist der vorliegende Band gewidmet.
Ernst-Haeckel-Haus, Jena – wo nach den Worten des seinerzeitigen Hausherrn, des Biologen Ernst Haeckel, noch vor einhundert Jahren »der Centralheerd des deutschen Darwinismus« stand –, [10] im März 2011.
Olaf Breidbach
18I. Exposition
Mit der Neuentdeckung von Ich und Individualität um 1800 wird die Frage nach der Souveränität des Einzelnen in seiner Geschichte und im Gefüge der Kulturen neu gestellt. Es geht um die Versicherung des Einzelnen, der sich, auf seine Kultur und seine Zeit rückverwiesen, nunmehr in einer neuen Weise in seiner Geschichte findet und zugleich die Natur in ihrem Werden aus sich zu begreifen sucht. Die Ordnung der Dinge und die Ordnungen, in denen sich der Einzelne finden kann, werden neu konzipiert. Es formen sich neue, alternative Muster von Gesellschaft, Staatlichkeit und Natürlichkeit. In diesen Konzeptionen wird nun auch das Werden der Natur nach dem Muster von Geschichte (Herder), die Vielfalt der Organismen nach dem Muster von Gesellschaften (Darwin) neu gedacht. Dabei sind Vorstellungen des Werdens einerseits geprägt durch die Idee der Perfektibilität (Kant) und damit unter der Idee eines sich im Werden generierenden Ganzen (Goethe), andererseits aber auch aus den Konzeptionen von natürlichen Ordnungen begriffen (Oken). Auf diese Weise wird seitdem das Werden von Natur und Geschichte nach vereinheitlichenden Mustern neu begriffen und bedacht.
1. Geschichte denken
1.1. Historisierungen
1.1.1. Tradierte Historismen
Die radikale Historisierung richtet sich nun nicht einfach auf die Rekonstruktion eines Ereignisses im Sinne der derzeitigen Diskussion um die Faktizität des Geschichtlichen. Sie zielt auf die Darstellung von Phasen, in denen etwas als Ereignis begriffen, das heißt in seinen Effekten als solches überhaupt erst identifiziert werden kann. Schon der alte Historismus diagnostizierte eine Relativierung. Für ihn gab diese Diagnose dann aber erst einmal die Möglichkeit, die geschichtlich ansetzenden Bereiche unserer Wissen19schaften einzugrenzen und gegenüber dem analytischen Anspruch der Naturwissenschaften zu sichern: Das bloß Geschichtliche gab den Geisteswissenschaften einen Gegenstandsbereich, der sich dem Ansatz und Ansinnen der Naturwissenschaften zu entziehen schien. Historisierung bedeutete demnach nicht etwa eine neue Form zur Sicherung unserer Erkenntnis, sondern die Einsicht in das nur Vorläufige eines bestimmten und momentan leitenden Aussagebereiches. Dieser musste entsprechend in einer stärker deskriptiv orientierten, kulturell ausgreifenden Analyse beschrieben werden, die ihn als tradiert, nicht als eine vom Himmel gefallene Wahrheit begriff. Das, was so zusammenzutragen war, gab die Daten für eine dann auch analytische Durchdringung der momentanen Wissensordnungen. Diese wurden in ihre Geschichte gesetzt. In dieser und aus dieser verstanden waren sie als Resultate einer Vielfalt von zu unterschiedlichen Zeiten wirkenden Faktoren zu beschreiben. Dabei zeigten sich in dem unübersehbaren Gefüge einzelner »historisch« nachzuzeichnender Wirkungszusammenhänge keine klaren Gesetzmäßigkeiten im Sinne physikalischer Reaktionsbeschreibungen. Entsprechend waren nach diesem Ansatz dann auch Naturwissenschaften und historisch operierende Geisteswissenschaften von grundsätzlich differenten Erkenntnisinteressen geleitet und demnach voneinander abzusetzen. So weit der alte Historismus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!