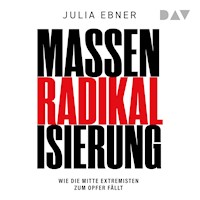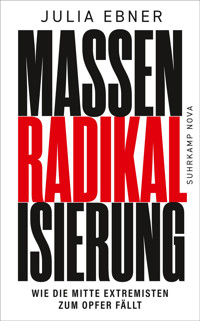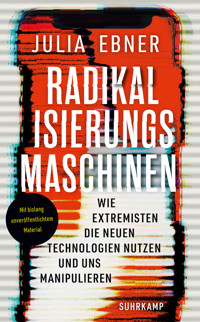
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Julia Ebner verfolgt hauptberuflich Extremisten. Undercover mischt sie sich unter Hacker, Terroristen, Trolle, Fundamentalisten und Verschwörer, sie kennt die Szenen von innen, von der Alt-Right-Bewegung bis zum Islamischen Staat, online wie offline. Ihr Buch macht Radikalisierung fassbar, es ist Erfahrungsbericht, Analyse, unmissverständlicher Weckruf.
Als Extremismusforscherin stellen sich ihr folgende Fragen: Wie rekrutieren, wie mobilisieren Extremisten ihre Anhänger? Was ist ihre Vision der Zukunft? Mit welchen Mitteln wollen sie diese Vision erreichen? Um Antworten zu finden, schleust sich Julia Ebner ein in zwölf radikale Gruppierungen quer durch das ideologische Spektrum. Sozusagen von der anderen Seite beobachtet sie Planungen terroristischer Anschläge, Desinformationskampagnen, Einschüchterungsaktionen, Wahlmanipulationen. Sie erkennt, Radikalisierung folgt einem klaren Skript: Rekrutierung, Sozialisierung, Kommunikation, Mobilisierung, Angriff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Titel
Julia Ebner
Radikalisierungsmaschinen
Wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren
Aus dem Englischen von Kirsten Riesselmann
Suhrkamp
Widmung
Für meine Eltern
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einführung
1 Rekrutierung
Whites Only: Angeworben von Neonazis
Redpilling für Anfänger: Undercover bei den Identitären
2 Sozialisierung
Trad Wives: Unter Antifeministinnen
Sisters Only: Eingeführt bei den Terror-Schwestern
3 Kommunikation
Infokriege: Konfrontiert mit dem Medienimperium von Tommy Robinson
Meme-Kriege: Undercover bei der größten Troll-Armee Europas
4 Vernetzung
Alt-Tech: Radikale Netzwerke weltweit
der Verschwörungstheorien
5 Mobilisierung
Unite the Right: Im Organisationsteam der Charlottesville-Proteste
Schild & Schwert: Besuch bei einem Neonazi-Festival
6 Angriff
Jihobbyisten: Unterricht bei den Hackern des
IS
Black Hats: In Weevs Hacker-Armee
Bilanz
Tech gegen Terror
Strategisch gegen Spaltung
Hilfe gegen Hass
Intervention
Elfen vs. Trolle
Trolle trollen
Hacker hacken
Kunst gegen Wut
Die Mitte mobilisieren
Bildung gegen Extremismus
Christchurch: Ein Nachtrag
Gamifizierter Terrorismus
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einführung
Im März 2016 fingen Drucker überall in den USA plötzlich an, Neonazi-Flyer auszudrucken. Bei den Bundestagswahlen im September 2017 verdankte sich der Kampagnenerfolg der AfD zu großen Teilen den Aktivitäten der Troll-Armee Reconquista Germanica. Ein Jahr später launchte die Hamas eine gefakte Dating-App und attackierte Hunderte Soldaten der israelischen Armee mit einer Schadsoftware, die sich hinter den gestohlenen Profilen junger Frauen verbarg. Das gesamte Jahr 2018 über bekam das Lager der Brexit-Hardliner massive Unterstützung vom internationalen verschwörungstheoretischen Netzwerk QAnon. Kurz vor Weihnachten 2018 stellten rechte Hacker die privaten Daten von Hunderten deutscher Politikerinnen und Politiker ins Netz. Im März 2019 ging der Live-Stream des antimuslimischen Terroranschlags in Neuseeland mit 1,5 Millionen geteilten Videos viral.
Neue Technologien haben Extremisten neue Plattformen zur Anwerbung sowie neue Handlungsfelder beschert. Sie haben gleichzeitig auch bewirkt, dass Extremisten heute stärker miteinander vernetzt sind als jemals zuvor. Nationalistische Bewegungen sind transnational geworden. Sie haben globale Armeen aus digitalen Soldaten aufgebaut. Man geht davon aus, dass die sozialen Medien in 90 Prozent aller Radikalisierungen eine virulente Rolle spielen und für einen signifikanten Anteil terroristischer Aktionen Unterstützung generieren.
Das Wechselspiel von Technologie und Gesellschaft ist schon seit langem ein zentraler Faktor bei radikalen Umbrüchen. 1936 schrieb Walter Benjamin, der Aufstieg des Faschismus sei von Erfindungen wie dem Siebdruck und der frühen Fotokopiertechnik befördert worden, weil diese die öffentliche Wahrnehmung von Medien, Kunst und Politik verändert hätten. Das Aufkommen technologisch progressiver, sozial jedoch regressiver Bewegungen war formgebend für die Machtdynamiken im Europa des 20. Jahrhunderts.
In diesem Buch stelle ich die These auf, dass wir momentan erneut Zeugen einer toxischen Paarung aus ideologischer Vergangenheitssehnsucht und technologischem Futurismus werden, die möglicherweise der Politik des 21. Jahrhunderts die Richtung weist. Die Radikalisierungsmaschinen, die die heutigen Extremisten zusammenbauen, sind technisch auf dem neuesten Stand: Sie sind künstlich intelligent, emotional manipulativ und wirken mit Macht in die Gesellschaften hinein. In ihnen verschränken sich Hightech und Hypersozialität, mit dem Ziel, Gegenkulturen hervorzubringen, die die Jungen, Wütenden und Technologieaffinen ansprechen. Sollten diese Maschinen Wirkung zeigen, könnten sie potenziell zu einer gefährlichen Triebkraft der Veränderung werden. Sie würden dann nicht nur die Erscheinungsformen von Extremismus und Terrorismus verändern, sondern auch unsere Informationssysteme und demokratischen Prozesse neu definieren und in der Folge unsere größten bürgerrechtlichen Errungenschaften rückgängig machen.
Als ich sieben war, wollte ich Tornados erforschen. Meine Standardantwort für alle Erwachsenen, die eine Erstklässlerin unbedingt fragen mussten, was sie denn später mal werden wolle, lautete: »Sturmjägerin!« Ich hatte den Film Twister im Kino gesehen und war fasziniert von der Geschwindigkeit, Gewalt und Unvorhersagbarkeit von Wirbelstürmen. Meine Twister-Helden kamen zu dem Schluss: Um einen Tornado vollständig begreifen und dann angemessene Warnsysteme entwickeln zu können, muss man sich in sein Zentrum begeben.
Heute verfolge ich beruflich keine Stürme, sondern Extremisten. Was in vielerlei Hinsicht gar kein so großer Unterschied ist. Genau wie Stürme bewegen sich auch Extremisten schnell, haben ein hohes zerstörerisches Potenzial und können ständig die Richtung wechseln. Bei meiner Arbeit im Londoner Institute for Strategic Dialogue (ISD) beobachte ich extreme Bewegungen in Europa und Nordamerika, berate Regierungen, Sicherheitsdienste und Tech-Unternehmen. Trotzdem bleiben meine Einblicke einseitig: Sie liefern mir nur die Katzenperspektive auf dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen denjenigen, die unsere Demokratien stören und ins Wanken bringen wollen, und denjenigen, die sie zu beschützen suchen. Im Laufe der letzten Jahre wurde mir klar: Um zu verstehen, was dieses ganze Chaos um uns herum anrichtet, muss man ins Innere vordringen, in die Maschinenräume, dorthin, wo die Motoren extremistischer Bewegungen laufen, wo sie aber eben auch beobachtet und erforscht werden können. Wie mobilisieren die extremen Ränder ihre Unterstützer, wie ziehen sie anfällige Individuen hinein in ihre Netzwerke? Welche Vorstellungen von der Zukunft haben sie und wie wollen sie diese umsetzen? Wie sieht die soziale Dynamik aus, die Mitglieder bei einer Gruppe bleiben lässt, und wie entwickelt sie sich weiter?
Um hierauf Antworten zu bekommen, war ich zwei Jahre undercover unterwegs: Ich habe mir fünf unterschiedliche Identitäten zugelegt und bin einem Dutzend technikaffiner extremistischer Gruppen einmal quer durchs ideologische Spektrum beigetreten – Dschihadisten, christlichen Fundamentalisten, weißen Nationalisten, Verschwörungstheoretikern, radikalen Frauenfeinden und Hackern. Bei der Arbeit war ich die Katze, in meiner Freizeit jedoch lief ich zu den Mäusen über. Meine Recherchen haben mich an einige sehr seltsame und manchmal auch gefährliche Orte gebracht, sowohl on- als auch offline. Ich habe beobachtet, wie Extremisten Terroranschläge planen, Desinformationskampagnen starten und Einschüchterungsfeldzüge koordinieren.
Die Masse von widerwärtigem Content, auf den ich im Laufe dieser Zeit gestoßen bin, war ernüchternd, die Zahl der daran beteiligten jungen Menschen bedrückend. Oberflächlich betrachtet haben die Gruppierungen, denen ich mich angeschlossen habe, nur wenig gemeinsam. Aber ihre interne Funktionsweise ist doch sehr ähnlich: Ihre Anführer generieren geschützte soziale Blasen, in denen sie zu antisozialem Verhalten im Rest der Welt aufrufen. Und ihre Mitglieder verbreiten rund um den Globus antiglobalistische Ideologien und nutzen hochmoderne Technik, um ihre antimodernen Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.
Dieses Buch beleuchtet unterschiedliche Aspekte des Lebens in extremistischen Gruppierungen. Die einzelnen Kapitel behandeln verschiedene Stadien im Radikalisierungsprozess: von der Rekrutierung und der Sozialisierung über die Kommunikation, Vernetzung und Mobilisierung bis hin zur geheimen Planung von Angriffen. Am Ende ziehe ich Bilanz und denke über Ausmaß und Art der an uns gestellten Herausforderung nach. Dabei stelle ich eine Reihe innovativer und mutiger Initiativen vor, die das Potenzial haben, für eine kommende Generation, die global etwas verändern will, Vorbild und Ideengeber zu sein.
1 Rekrutierung
Das Internet und die neuen Technologien haben die Rekrutierung von neuen Leuten deutlich einfacher gemacht, sowohl für Top-Arbeitgeber als auch für radikale Gruppierungen. Die Reichweite eines Gesuchs kann nach Belieben vergrößert werden, der Auftritt der eigenen Marke beständig an die Zielgruppe angepasst und die Sicherheitsüberprüfung möglicher Kandidatinnen und Kandidaten spielerisch gestaltet werden. Um labile, empfängliche junge Menschen in ihre Netze zu locken, nutzen Extremisten das gesamte technologische Spektrum: von aggressiven Anwerbekampagnen in den sozialen Medien bis hin zu intensiven Überprüfungsphasen mit verschlüsselten Apps. Spektakuläre Aktionen, die man in der realen Welt durchführt, streamt man live und lässt sie so auf Facebook und Twitter trenden, um auch über sein bereits angestammtes Publikum hinaus Aufmerksamkeit zu bekommen. Bestimmte Communitys im Netz versucht man entweder mit direkten Referenzen auf die aktuelle Jugendkultur oder mit Gamer-Wortschatz zu kriegen, und Neumitglieder fordert man auf, Ergebnisse von Gentests online zu stellen und sich auf Live-Voice-Interviews einzulassen. Das folgende Kapitel taucht ein ins Rekrutierungsprozedere einer US-amerikanischen Neonazigruppe und der rechtsextremen Identitären Bewegung in Europa.
Whites Only: Angeworben von Neonazis
»Wo bin ich denn hier gelandet?«, will Bryan wissen.
»In einer rechtsnationalen Diskussionsgruppe, die sich vor allem mit Rassefragen, Volkstum, Spiritualität, Philosophie, Ästhetik und Literatur beschäftigt«, antwortet ihm der Administrator. Er heißt Aldritch. Aldritch ϟ, um genau zu sein.
»Um Zugang zu erhalten zu den nur für Mitglieder offenen Kanälen, schick ein Foto von deiner Hand oder deinem Handgelenk, zusammen mit einem Stück Papier, auf dem steht: MAtR– dein Benutzername – Zeitstempel«, weist er alle Neulinge an.
»Dann beantworte folgenden Fragebogen:
Q1. Wie sieht deine Abstammungslinie aus (so vollständig, wie du sie kennst)?
Q2. Wie alt bist du?
Q3. Wie würdest du deine politische Haltung beschreiben?
Q4. Welche religiösen bzw. spirituellen Einstellungen hast du?
Q5. Bist du homosexuell oder anderweitig sexuell anormal?«
Kurze Zeit später erscheint ein Foto von Bryans Hand im Chatroom, begleitet von einer Entschuldigung für den knallblauen Widerschein von seinem Laptop.
»Kein Problem«, schreibt Aldritch ϟ. Bryans Hand ist weiß genug, um ihn in die Gruppe zu lassen. Bryan behauptet, finnischer Abstammung zu sein, mit ein paar europäischen und indianischen Einflüssen.
Er ist 17 Jahre alt und beschreibt sich als Nationalanarchisten und finnischen Neuheiden, einen so genannten Suomenusko. »Aber leider muss ich sagen, dass ich mal schwul war, was an meiner Degeneriertheit lag«, schreibt er. »Aber mehr als hin und wieder so ein Gedanke war es eigentlich nicht, und ich bin dabei, meinen Kopf von solchen Gedanken frei zu kriegen.«
Ein paar Tage später ist Bryan nicht mehr da. Statt seiner taucht Jason auf im Anwerbe-Hub des rechtsradikalen Online-Kanals.
»Ich stehe jetzt schon auf massenhaft Watchlists«, schreibt er, »und ich bin erst 14.«
»Aber weiß bist du schon? ;)«, fragt Aldritch ϟ, selbst Anglo-Bulgare mit deutschen, schottischen und kroatischen Wurzeln auf der mütterlichen Seite. Niemanden in der Gruppe scheint es zu stören, dass Jason noch minderjährig ist.
»2 % Nigger – und ab in die Mülltonne mit dem 23andMe-Test«, kommt Jasons Antwort prompt zurück. Der Junge stellt eine Kopie seines Gentests in die Gruppe, um sein Weiß-Sein zu belegen. »War nurn Scherz, ich bin zu drei Vierteln Deutscher und zu einem Viertel Este.«
Deus Vult, ein zweiter Administrator, betritt den Chatroom und schickt ihm darauf gleich ein Grinsegesicht-Emoji. »Wusstest du, dass Alfred Rosenberg, der Führer der NSDAP während Hitlers Zeit im Gefängnis, zu einem Viertel Este war?«
Mir läuft es bei dieser Unterhaltung kalt den Rücken hinunter, und ich trinke mein Glas Wein in einem Zug aus, um es etwas erträglicher zu machen.
»Hallo, bist du eine Frau?«, wendet sich Deus Vult via Direktnachricht an mich, als hätte er über den Bildschirm die Qual in meinem Gesicht gesehen.
Ich zögere. Tagelang habe ich mich bedeckt gehalten und bin nur so im Eingangsbereich der Neonazi-Chatgruppe herumgeschlichen.
Mein Username Jen Malo klingt aber auch verdächtig unschuldig. Als ich mich umsehe, entdecke ich kaum einen Namen ohne Bezug auf entweder die NS- oder die Alt-Right-Symbolik. Deus Vult, der Schlachtruf der Kreuzritter – lateinisch für »Gott will es« –, ist da eher noch von der harmloseren Sorte. In vielen Namen kommen die Buchstabenkombinationen ›WP‹ (für ›White Power‹) oder ›W. O. T. A. N.‹ (für ›Will of the Aryan Nation‹) vor. Andere beinhalten die Zahlen 4/20, die auf Hitlers Geburtstag verweisen, oder die ›14‹, die sich auf die ›Fourteen Words‹ bezieht (»We must secure the existence of our people and a future for White children«), oder auch gleich die ›88‹ als Bezugnahme auf die Initialen ›HH‹ (›Heil Hitler‹). Aldritch ϟ ist mit seiner Kombination aus SS-Rune und dem recht willkürlich wirkenden Ausdruck der Bewunderung für Aldrich Ames, einen Doppelagenten im Kalten Krieg, ein klarer Außenseiter.
»Ja, ich bin eine Frau«, antworte ich schließlich. Habe ich zu lang gewartet?
»Keine Sorge, wir nehmen auch Frauen«, schreibt Deus Vult. »Hast du ein paar Minuten für einen Voice-Chat?«
Dass es früher oder später dazu kommen würde, war mir klar, sinnlos also, das Ganze zu vertagen.
»Bereit?« Ich versuche, mir ein Gesicht hinter dieser Stimme vorzustellen. Ist er jung oder alt? Schwer zu sagen, es gibt heutzutage keine prototypischen Neonazis mehr.
»Klar.« So bereit man eben sein kann für ein Gespräch mit einem Nazi.
Meine Hände auf der Tastatur zittern, aber ich bemühe mich, meiner Stimme einen festen Klang zu geben. Die Buchstaben ›MAtR‹ stehen groß auf meinem Handgelenk. Sie sind die Abkürzung für Men Among the Ruins, dem einflussreichsten Buch des italienischen Philosophen Julius Evola. Evola, ein früher völkischer Vordenker eines spirituellen Rassismus, war Ideengeber für Benito Mussolinis faschistisches Regime. Er arbeitete auch für die SS, deren Führer Heinrich Himmler er bewunderte. Er wies es weit von sich, ein Faschist zu sein, und bevorzugte stattdessen die Bezeichnung ›Superfaschist‹. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb sein Entwurf einer gesellschaftlich-politischen Ordnung, die auf strengen Hierarchien, charakterlichen Eigenschaften, Rasse, Mythen, Religion und Ritualen beruht, für rechtsextreme Terroristenund Neofaschisten in Italien eine wichtige Inspirationsquelle. Heutzutage lassen sich Evolas Bücher gut an die Alt-Right-Bewegung verkaufen. Sogar Stephen Bannon, Präsident Trumps vormaliger politischer Berater, zitiert aus seinen Schriften. Laut Gianfranco De Turris, in Rom lebender Evola-Biograf und Vorstand der Evola-Stiftung, ist es »das erste Mal, dass ein Berater des amerikanischen Präsidenten Evola kennt oder vielleicht sogar eine traditionalistische Vorbildung hat.«
»Dein Sicherheitscheck ist erfolgreich abgeschlossen«, schreibt Deus Vult nach einem kurzen Voice-Chat, in dem ich ihm sage, was er hören will: »Ich bin Weiße, von der Nationalität her Österreicherin und habe ausschließlich europäische Vorfahren. Ich glaube, dass unser genetisches und kulturelles Erbe durch die Masseneinwanderung aus dem Ausland bedroht ist, und sorge mich um die Zukunft meiner Kinder, die in einem multikulturellen Europa aufwachsen müssen.« Warum ich Mitglied der Gruppe werden will? »Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht so ganz, was mich erwartet, aber ich weiß sicher, dass ich Kontakt haben will mit Gleichgesinnten und dass ich erfahren möchte, wenn Aktionen geplant sind für die patriotische Revolution in den USA und in Europa.«
»Willkommen bei MAtR.«
Ich betrete den Hauptraum der Chatgruppe und sehe mich um. Dort treffe ich auch Jason wieder, der seinen Namen mittlerweile in ›General Jason‹ abgeändert hat. Der Titel will mir passend scheinen, ist doch der gesamte Kanal streng hierarchisch und nach militärischen Rängen organisiert. Der Server hat ein paar Dutzend Mitglieder von überall auf der Welt. Auf den ersten Blick sichte ich Leute, die sich als Amerikaner, Kanadier, Südafrikaner, Europäer und Australier zu erkennen geben. Da ist ein christlich aufgewachsener Kanadier Anfang 20, der behauptet, an »esoterischem Hitlerismus« interessiert zu sein, ein 16-Jähriger, der sich als »Nationalsozialist aus Litauen« bezeichnet und sich an die Traditionen der Romuva-Religion hält, sowie eine »komplett areligiöse, agnostische« 17-Jährige aus Neuseeland, die erst seit kurzem in den USA lebt. Die Unterhaltungen sind so unterschiedlich wie die an diesem Austausch Beteiligten. Mal geht es darum, ob Jesus Jude war oder nicht, dann wieder darum, ob Trump und Kim wohl miteinander klarkommen werden. Aber Genetik und Biologie scheinen bei allen Lieblingsthemen zu sein.
»Also, was weißt du über Gentests?«, wird Jason von einem gewissen Mr White gefragt.
Mr White ist 32 und seit seinem 15. Geburtstag »Teil der Bewegung«, wie er schreibt. Wenn Neonazis von ›der Bewegung‹ sprechen, meinen sie üblicherweise nationalsozialistische Netzwerke, was aber heutzutage alles sein kann von einer konkreten Gruppenmitgliedschaft bis hin zu einem losen Online-Zusammenschluss von Menschen, die sich noch nie getroffen haben und die im echten Leben vielleicht auch nie aufeinandertreffen werden.
»Um ehrlich zu sein: nicht viel. Aber ich möchte gern mehr darüber erfahren.«
»Verständlich«, antwortet Mr White. »Ich habe mich tiefergehend damit beschäftigt, weil es doch extrem schwierig geworden wäre, an meinen rassischen Überzeugungen festzuhalten, wenn meine Abstammung damit über Kreuz gelegen hätte. Aber auch ich habe im besten Fall nur ein oberflächliches Verständnis von Genetik«, räumt er ein.
Mr White ist nicht der einzige Verfechter der Überlegenheit der weißen Rasse, der über jedes einzelne Prozent seiner Abstammung Bescheid wissen will. Viele Rechtsextreme haben geradezu eine Besessenheit in Sachen Genetik entwickelt. Von den Dutzenden geschlossener Chatgruppen, die ich im Laufe der Jahre 2017 und 2018 beobachtet habe, verlangte mindestens die Hälfte von ihren Mitgliedern eine detaillierte Offenlegung ihrer genetischen Abstammung. Manche wollten als Teil des Bewerbungsverfahrens sogar die Ergebnisse eines Gentests sehen.
Vor diesem Hintergrund bin ich nicht überrascht zu lesen, dass 23andMe, Ancestry, MyHeritage und andere Gentestanbieter seit dem Sommer 2016 einen noch nie da gewesenen Anstieg ihrer Verkaufszahlen verzeichnen. 2017 ließen mehr Menschen ihre DNA analysieren als in sämtlichen Jahren zuvor zusammengenommen. Aber die Testergebnisse ihrer genetischen Abstammung passen bei Rechtsextremen und weißen Nationalisten nicht immer zu ihrem Reinheitsanspruch, was schwere Identitätskrisen bei ihnen auslösen kann. Wenn deine vorrangigen Sündenböcke Juden und Muslime sind und du Schwarze und Araber für biologisch minderwertig hältst, kann die Erkenntnis, dass du selbst zu einem Viertel jüdisch und zu einem Achtel Marokkaner bist, doch ein kleines Bisschen unangenehm sein.
Auch wenn neue Technologien Radikalisierungsdynamiken tendenziell verstärken, können sie im Fall von Gentests tatsächlich auch den gegenteiligen Effekt haben: Die kognitive Dissonanz, die sich auftut, wenn die monoethnischen Ideale einer imaginären Zukunft auf die multiethnische Realität der eigenen Vergangenheit treffen, kann eine tiefgreifende Einstellungs- und Verhaltensänderung bewirken.
Aaron Panofsky, Soziologe an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, und Joan Donovan vom Data & Society Research Institute haben in Foren der Neonazi-Plattform Stormfront Diskussionen rund um das Thema der genetischen Abstammung analysiert. Dabei haben sie herausgefunden, dass viele, die ein unerwünschtes Testergebnis bekommen, trotzdem versuchen, ihre politischen Ansichten mit ihrer multiethnischen Abstammung in Übereinstimmung zu bringen, und sich dabei einer verqueren Logik bedienen.
»Man würde denken, dass Mitglieder des Forums in einem solchen Fall sagen: ›Raus mit dir! Wir wollen dich hier nicht!‹«, schreibt Panofsky. »Stattdessen aber finden sie Mittel und Wege, die Mitglieder ihrer Community zu unterstützen und sie in der Gruppe zu halten.«
Manchmal führen jedoch Verdrängungsmechanismen auch zur Verstärkung der rassistischen Überzeugungen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Eskalation und immer absurderen Verschwörungstheorien kommen, die es den Betroffenen dann gestatten, die Gültigkeit ihrer Testergebnisse komplett in Frage zu stellen. Laut Mr White zum Beispiel werden die Gentests vom so genannten ›ZOG‹, dem ›Zionist Occupied Government‹, absichtlich verfälscht, auch das ein Teil des geheimen Plans zur Auslöschung der weißen Rasse. Er schreibt: »Um ehrlich zu sein: Seit dem Artikel letztens, darüber, dass 23andMe manipuliert wird, damit den Kunden in ihren Gutachten mehr aschkenasische und subsahara-afrikanische Anteile angezeigt werden, fällt es mir schwer, überhaupt noch in irgendetwas zu vertrauen.« Die Überzeugung, dass ihr Leben in jeglicher Hinsicht von den Juden, den ›globalen Eliten‹ oder den ›Kulturmarxisten‹ beherrscht wird, sitzt so tief, dass sich kaum etwas finden lässt, was für ihre Augen nicht manipuliert aussieht. Und auch die Gentest-Anbieter 23andMe und Ancestry sind von diesem umfassenden Misstrauen nicht ausgenommen.
Misstrauen ist eine der Konstanten, die Menschen in rechtsextreme Kanäle im Internet treibt. Dass sie dann dort bleiben, hat andere Gründe: Spaß, Freundschaft und Sinnstiftung. »Es war mir ein Vergnügen«, schreibt Mr White. »Ich bin regelrecht schockiert darüber, wie viele intelligente Menschen hier unterwegs sind. Ich bin's eher gewohnt, mit Babyboomern über die guten alten Zeiten zu quatschen.« Andere drücken ihre Zustimmung aus: »Lol. Ja, mir macht es hier in diesem Chatroom auch immer viel Spaß«, schreibt einer.
Worte wie ›Spaß‹ und ›Vergnügen‹ wollen in einen Chatroom, der mit »Juden ins Gas! Rassenkrieg jetzt!« aufmacht, nicht so recht hineinpassen. Aber die Allianz von Spaß und Hass ist – genau wie die Schnittmenge von menschlichem und unmenschlichem Verhalten – weder überraschend noch neu. Über hundert der von dem SS-Offizier Karl-Friedrich Höcker während der Nazizeit gesammelten Fotografien zeigen Angehörige des Personals von Konzentrationslagern, die sich auf dem Höhepunkt der Massenvernichtung durchaus gut amüsieren. Während im Sommer 1944 Hunderttausende ungarischer Juden gefoltert und ermordet werden, sieht man das SS-Personal von Ausschwitz 30 Kilometer südlich des Konzentrationslagers im Erholungsheim Solahütte beim Trinken, Singen und Feiern. Das Höcker-Album ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass sogar Menschen, die unvorstellbare Grausamkeiten begehen, in vielerlei Hinsicht menschlich bleiben: Man genießt gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie, ausgelassene Trinkabende mit den Freunden und gelegentlich einen Flirt mit der Kollegin, auf die man ein Auge geworfen hat.
Der Spaßfaktor ist auch heute noch der Dreh- und Angelpunkt, wenn man vorhat, rechtsextreme Ideologien und Verschwörungstheorien gesellschaftlich hoffähig zu machen. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2016 haben Ironie und grenzüberschreitender Humor den Akteuren am äußeren rechten Rand stark dabei geholfen, für junge Leute attraktiv zu werden. Nachdem ich ein paar Wochen im MAtR-Chatroom verbracht, die nächtlichen Diskussionen verfolgt und bei Voice-Chats mitgehört habe, beginne ich zu begreifen, dass der Spaß am Tabubruch ein Mittel gegen Langeweile und virtuelles Zugehörigkeitsgefühl ein Gegengift gegen Einsamkeit sein kann. Die Mitglieder teilen hier ihre intimsten Erfahrungen, Ängste und Wünsche miteinander und entwickeln eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Symbolik und sogar Insiderwitze. Schritt für Schritt werden die namen- und gesichtslosen Fremden auf der Plattform zu einem Ersatz für Familie und Freunde.
Hat man das erst mal begriffen, versteht man vielleicht etwas besser, warum MAtR-Mitglieder sich an mehreren Tagen pro Woche in diese kleine Echokammer begeben. Wie aber kommt ein Online-Kanal wie dieser überhaupt zustande? Sagt da jemand: ›Hey, lasst uns doch mal einen Neonazi-Chat für Gamer aufmachen!‹? Wird diskutiert, ob man als Logo lieber das Hakenkreuz oder die Wolfsangel nimmt, gibt es eine Auseinandersetzung darüber, ob Neulinge mit dem Runenalphabet oder doch besser mit kryptischen Emojis begrüßt werden?
Fast. Den Server MAtR hat im Sommer 2017 jemand mit dem Alias ›Comrade Rhodes‹ aufgesetzt. Während seine Freunde draußen grillten und schwimmen gingen, saß er vor seinem Computer und dachte darüber nach, wie er seine nationalsozialistische Ideologie am besten ins Herz der Gesellschaft befördern könnte. »Okay, unser erstes Ziel ist es, hierfür ca. 300 Mitglieder zu gewinnen«, schrieb Aldritch ϟ am Tag 1 von MAtR.
»Aber wo kriegen wir die Leute her?«, wollte ein gewisser Comrade Rhodes wissen.
»Ich richte einen Check-Channel ein und bearbeite den, wenn ich am PC sitze. Gegen elf heute Abend fange ich an, Einladungen rauszuschicken.«
Die ersten Wochen waren für die Initiatoren ein leichtes Spiel. Niemand hatte sie auf dem Schirm, niemand beobachtete sie, weder Sicherheitskräfte noch Tech-Firmen schenkten den Kampagnen, die sie sowohl on- als auch offline anschoben, irgendwie Beachtung. MAtR war einfach einer von Dutzenden ähnlich gesinnter Kanäle auf der verschlüsselten Gaming-App Discord und einer von Hunderten im Internet. Aber mit dem 12. August 2017 veränderte sich die Atmosphäre, in der Aldritch ϟ und Comrade Rhodes ihrer Tätigkeit nachgehen konnten.
Nachdem in Charlottesville die Aufmärsche von Neonazis und weißen Nationalisten mit dem Tod der Bürgerrechtsaktivistin Heather Heyer zu Ende gegangen waren, fingen sowohl die offenen wie auch die verschlüsselten Messaging-Plattformen an, rechtsextreme Kanäle zu schließen. Die MAtR-Administratoren waren zwar nicht in die Planung der Aufmärsche involviert gewesen – ja, sie verurteilten die Organisatoren sogar für ihre unausgereifte Medienstrategie und ihr vorschnelles Bemühen um eine Einigung der Rechten. Für sie war Charlottesville ein laienhafter, egoman motivierter Versuch, maximale mediale Aufmerksamkeit zu generieren, ein Versuch, dem eine ordentlich durchdachte ideologisch-strategische Basis fehlte. Obwohl die MAtR-Administratoren also auf Abstand gingen zu den Organisationsteams von Charlottesville, wurden sie aus Angst vor Enttarnung doch immer paranoider. Wie andere Online-Gruppen auch fingen sie an, strengere Aufnahmehürden einzurichten, Hintergrundchecks ihrer Mitglieder durchzuführen und Codewörter zu entwickeln.
Viele Rechtsextreme verlegten sich auf die Taktik, ihre Chatgruppen als sichere Häfen für die freie Meinungsäußerung zu verkaufen, und behaupteten, Mitglieder jeglicher politischer Couleur seien herzlich willkommen. So wird die Verschwörungstheorie über die schleichende muslimische Machtübernahme in Europa als faktengestütztes Diskussionsexperiment präsentiert und ein Thread zum Thema ›Warum der Holocaust nicht stattgefunden hat‹ als Versuch, die Grenzen der Meinungsfreiheit auszutesten, geframt. Wer allerdings anderer Meinung ist, wird in den Online-Foren schnell zum Schweigen gebracht, der Lächerlichkeit preisgegeben und bezichtigt, »Teil des Zensur-Problems unseres Landes zu sein«.
Andere Gruppen verwenden humoristische oder satirische Illustrationen, um ihre extremistischen Standpunkte zu vertuschen. Ein Witz darüber, dass Juden hinter der globalen Finanzkrise stecken? Nur Satire. Ein herabwürdigendes Bild von einem homosexuellen Paar? Eine harmlose Grenzüberschreitung, die die »scheinheilige Linke« ein bisschen »triggern« soll. Dann heißt es gern mal: »Wer das nicht kapiert, ist entweder unterbelichtet oder politisch überkorrekt oder beides.«
Die Vision der Köpfe hinter MAtR ist die Errichtung eines weißen Ethnostaats, einer arischen Nation in Nordamerika, »was ja keine neue Idee ist«, wie Mr White betont. »Den Plan dafür gibt es schon seit den 90er Jahren.« Er teilt einen Link zur Ethnostaat-Verfassung:
Artikel IV. Wohn- und Bürgerrechte in der Northwest Republic sollen uneingeschränkt und für alle Zeit nur solchen Personen zustehen, die eine unvermischte kaukasische Abstammung haben, also historisch zu einer der Familien der europäischen Nationen gehören, die keine bekannten oder feststellbaren nichtweißen Vorfahren haben und keinerlei sichtbare nichtweiße Anteile in ihrem Erbgut.
Artikel V. Die gemeinhin als Juden bezeichnete Rasse ist kulturell und historisch gesehen ein asiatisches Volk und soll nicht als weiß gelten und vor dem Gesetz nicht den weißen Rassestatus zuerkannt bekommen. Unter keinen Umständen soll es einem Juden erlaubt werden, die Northwest American Republic zu betreten oder sich hier niederzulassen.
Harold Covington, der Mann, der diesen Verfassungsentwurf geschrieben hat, war Ideenlieferant für viele rechtsextreme Aktivisten. Er gründete die Northwest Front, eine »politische Organisation arischer Männer und Frauen, die erkannt haben, dass eine unabhängige und souveräne Weiße Nation im amerikanischen Nordwesten die einzige Möglichkeit für das Überleben der Weißen Rasse auf diesem Kontinent ist«. Sein Geld verdiente Covington mit dem Verkauf von Science-Fiction-Romanen und von T-Shirts mit aufgedruckten Kalaschnikows. Seine Northwest-Romane seien jedoch »keine reine Unterhaltung«, heißt es auf der Internetseite der Organisation. »Sie sind gedacht als selbsterfüllende Prophezeiungen.«
Prophezeiungen mit konkreten Konsequenzen allerdings. Der 21-jährige Dylann Roof zitierte die Northwest Front in seinem Manifest, bevor er am 17. Juni 2015 in einer Kirche in Charleston neun Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner erschoss. Roof hielt es allerdings für unzureichend, alle Nichtweißen nur aus dem Nordwesten Amerikas zu vertreiben, denn ihm gefiel die Vorstellung nicht, dorthin umzusiedeln: »Warum sollte etwa ich die Schönheit und Geschichte meines Bundesstaates aufgeben und in den Nordwesten gehen?«, schrieb er.
Mr White bekennt, Roofs Punkt nachempfinden zu können: »Während der vergangenen 70 Jahre hat die so genannte Elite ewig nur Probleme benannt, nie aber Lösungen präsentiert. Ein solches Vorgehen bringt eben Jungs wie Dylann Roof hervor. Sie hören immer nur von Problemen, für die es keine Lösungen gibt. Also finden sie selbst eine.« Wie Roof denkt auch er, dass die Idee der Northwest Front nicht weit genug gehe. Derartige ideologische Meinungsverschiedenheiten sind eher kosmetisch, denn letzten Endes sind sie sich alle darin einig, dass Rassismus »die reinste Form von Patriotismus« sei. »Das müssen die Leute erst mal begreifen«, schreibt ein Mitglied namens Pretentieux. Zum Gewehr greifen wie Roof würde er allerdings nicht: »Ich denke, es ist sehr viel wertvoller, den Versuch zu unternehmen, das Wissen unter die Leute zu bringen, sie sozusagen zu redpillen. Das allein ist schon eine Menge Arbeit und braucht viel Fingerspitzengefühl.«
Der Ausdruck ›Redpilling‹ – jemandem die rote Kapsel geben – bezieht sich auf den Film Matrix. »Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus«, sagt dort Morpheus zu dem Helden Neo. »Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland, und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.« Neo entscheidet sich für die rote Kapsel und stellt fest, dass er in einer von Robotern mit künstlicher Intelligenz erschaffenen Computersimulation lebt, die darauf ausgelegt ist, die Menschheit zu versklaven und ihre Körper zur Energiegewinnung zu nutzen. Diese längst Kult gewordene Szene ist für die internationale Neue Rechte zu einer Quelle der Inspiration, Hoffnung und Selbstkasteiung geworden. Anwerber benutzen die Metapher des Films, um interessierte Sympathisanten davon zu überzeugen, dass sie gefangen sind in einer vom ›globalen Establishment‹ erschaffenen Scheinwelt. In ihrer Besessenheit, ›die Wahrheit ans Licht zu bringen‹, verbringen manche ihre Feierabende bis tief in die Nacht hinein damit, ›rote Kapseln‹ zu sammeln und in großen Datenbanken abzulegen. ›Redpills‹ wären zum Beispiel (verzerrte) Statistiken zu von Migration verübter Gewalt oder zum demografischen Wandel. Wenn man ›Redpilling‹, also das Sammeln und Weiterreichen vermeintlicher Wahrheitskapseln, als einen Euphemismus für Radikalisierung betrachtet, dann sind große Teile des Internets inzwischen zu Redpilling-Fabriken geworden. Die Überzeugung, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat, ist im Übrigen die ultimative rote Kapsel für Rechtsextremisten. Der Film Matrix gehört zu einem großen Arsenal netzkultureller Referenzen – von japanischen Animes bis hin zu Popstar Taylor Swift –, die die Neue Rechte für ihre Zwecke benutzt und zur Waffe macht.
Pretentieux ist einer dieser Menschen, die in den 2000er Jahren Teenager waren und heute auch als ›Millennials‹ bezeichnet werden. Er ist jetzt 31 Jahre alt. Redpilling hat ihn nicht interessiert, bis vor fünf Jahren seine Nichte geboren wurde: »Meine Schwester sitzt im Gefängnis, und ich helfe meinen Eltern, sie großzuziehen. Ich habe also zwangsläufig angefangen, auf Dinge zu achten wie: Wie wird sie wohl später mal behandelt werden, mit wem oder was wird sie es zu tun bekommen, während sie aufwächst?« »Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen«, meint Mr White und fährt fort: »Bald fliegt alles in die Luft, so kurz davor standen wir noch nie.« Wie viele andere Mitglieder der Gruppe glaubt er, wir stünden kurz vor einem Rassenkrieg und dem Zusammenbruch des demokratischen Systems. »Erst seit ungefähr vier Jahren begegnen mir Leute unter 40, die bereits ethnisch wach sind.« Mr White ist zum ersten Mal auf dem Discord-Server unterwegs. Pretentieux bekennt, der Server sei für ihn »zu einer Sucht geworden«, und erklärt, hier finde man einfach so leicht »vernünftige, ehrliche Menschen« und könne sich mit ihnen unterhalten. Nach einer kurzen Pause gesteht er: »Ob ich selbst vernünftig bin, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Aber ehrlich, das bin ich … Eigentlich sogar ziemlich geraderaus.« Dann wendet er sich an Mr White: »Man muss nur ein bisschen suchen, dann findet man mit der Zeit doch eine ganze Menge Discord-Server mit Gleichgesinnten. Und jeder davon hat sein eigenes Flair.«
Genau davor hatte Kevin Thomson, Experte für Cyber-Sicherheit, zu Beginn der Massenkommerzialisierung des Internets gewarnt. In seiner 2001 durchgeführten Studie zu den Gesprächen auf der Neonazi-Plattform Stormfront kam er zu dem Schluss, dass die computermoderierte Kommunikation es sozial stigmatisierten, machtlosen Individuen ermögliche, alternative Handlungsorte auszubilden und so traditionelle nachbarschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen zu ersetzen. Dass der Cyberspace von Extremisten in Stellung gebracht werden kann, um andere zu radikalisieren sowie Kampagnen und Gewaltanwendung zu koordinieren, wurde schon in der Steinzeit des Internets klar, den späten 1990er Jahren: Bei der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich planten deutsche Neonazis und Hooligans über ihre Handys und unter Einsatz des Internets rassistisch und ideologisch motivierte Angriffe. Bei einem Match zwischen Deutschland und Jugoslawien im nordfranzösischen Lens wurden 96 Menschen verhaftet, Hitlergrüße beobachtet und ein Polizist schwer verletzt.
Aber die Rechtsextremen haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie man das Internet am besten nutzt. Pretentieux spricht sich dafür aus, es vor allem einzusetzen, um Köpfe und Herzen der jungen Leute zu erreichen. Die Demokratisierung der publizistischen Mittel und die Verbreitungsmöglichkeiten von (Des)Information wertet er dafür als zentral. Die Northwest Front nennt die Veröffentlichung via Print-per-Order als Beispiel dafür, wie »die großen jüdischen Monopole in Kunst und Unterhaltung zerschlagen wurden«. User wie LifeOfWat hingegen sind überzeugt davon, dass es nicht ausreiche, einen Bogen zu machen um die etablierten Medien: »Der Krieg ist der einzige Weg. Freiheit durch das Schwert.«
Quer durch das ideologische Spektrum sind aber alle rechtsextremen Akteure vereint in dem festen Glauben, dass die neuen Technologien ausschlaggebend dafür sind, zu wachsen und das eigene politische Gewicht zu festigen. Ein MAtR-Mitglied resümiert: »Zuerst kommt das virtuelle Schlachtfeld.«
Die mittlerweile ganz Europa umfassende Bewegung, der ich mich im nächsten Kapitel anschließe, begrüßt den Einsatz von Gewalt nicht ganz so offen wie MAtR. Anders als US-amerikanische Extremisten tragen ihre Mitglieder auch keine Waffen, da schlichtweg der Zugang dazu fehlt. Aber wie geschickt sie die neuen Kommunikationstechnologien und die dadurch entstehenden sozialen Räume nutzen, hat dazu geführt, dass eine ganze Reihe nationaler Geheimdienste dieser Gruppierung oberste Beobachtungspriorität geben. Ihren Anwerbern ist es gelungen, für eine breite Öffentlichkeit junger, technikaffiner Menschen aus Europa interessant zu sein. Diese Gruppierung setzt neue Maßstäbe bei der Entwicklung subtilerer, innovativerer Formen von Branding und beim systematischen Ausbau der eigenen Reichweite.
Redpilling für Anfänger: Undercover bei den Identitären
»Hallo Jenni!« Ein großgewachsener Typ mit rechteckiger Brille und kurzen, zurückgegelten Haaren erwartet mich im traditionellen Café Prückel in der Wiener Innenstadt. Für einen Rechtsextremen sieht er fast zu normal aus: Er trägt keine sichtbaren Tattoos, noch nicht mal einen ›fashy Undercut‹, diesen Haarschnitt, der zum Markenzeichen der Neuen Rechten wurde.
»Oh, hallo! Bist du Edwin?« Eine rhetorische Frage, denn ich kenne den Obmann der Identitären Bewegung Salzburg aus seinen diversen Auftritten in den Medien. Schließlich ist er ein prominenter Kopf der europäischen Identitären. Ein unbeholfener Händedruck, ein verstohlener Blick auf die Nachbartische, dann setze ich mich zu Edwin Hintsteiner.
Meine blonde Perücke passt zu meinem Profilbild auf Twitter, wo ich extra für die Kontaktanbahnung einen Account eröffnet habe. Jennifer Mayer, rufe ich mir ins Gedächtnis, du bist Jennifer Mayer, Philosophiestudentin aus Österreich, zurzeit im Auslandssemester in London. Eine falsche Identität anzunehmen oder sich eine Romanfigur auszudenken – fast dasselbe: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft muss man kennen, sonst kauft einem niemand die Geschichte ab.
Es ist der Tag der Nationalratswahlen in Österreich, die meisten Menschen um uns herum nippen an ihrem Kaffee und diskutieren mit ihren Nachbarn über das zu erwartende Wahlergebnis. Niemand scheint uns zu bemerken, nur eine elegant gekleidete ältere Dame blickt kurz von ihrem Standard auf, einer linksliberalen Tageszeitung. Ich bezweifle, dass sie einen von uns erkennt.
Damals wusste ich noch nicht, dass Hintsteiner nur wenig später insbesondere bei älteren Menschen in Österreich fast berühmt werden sollte: Einige Monate nach unserem Treffen schockierte er am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust im Januar 2018 mit einem Tweet, der in den Medien heftige Reaktionen auslöste: »Wenn man länger lebt, als man nützlich ist und vor lauter Feminismus nie Stricken lernte. Meine Oma schämt sich für euch.« Der Tweet war ein Angriff auf die parteiunabhängige Bewegung ›Omas gegen Rechts‹ und deren Protest gegen den Akademikerball, ein von der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs organisiertes, alljährlich stattfindendes Fest, das sich zu einer beliebten Zusammenkunft rechtsextremer Einflussnehmer aus ganz Europa entwickelt hat. Natürlich ist es unanständig, eine Vereinigung von Großmüttern auf diese Art und Weise anzugehen. Aber nicht nur das machte den Tweet so kontrovers. Viele brachten Hintsteiners Formulierung mit dem ›lebensunwerten Leben‹ in Verbindung, einem Ausdruck, den Hitler in einem Erlass vom 9. Oktober 1939 benutzt hatte. Darin befahl er die systematische Ermordung derjenigen, die für zu schwach, behindert oder minderwertig befunden wurden, um weiter am Leben sein zu dürfen. Zusätzlich zu den sechs Millionen Juden, 200 000 Roma und 70 000 Homosexuellen, die sie ermordeten, brachten die Nazis im Rahmen ihrer Euthanasie-Programme 275 000 behinderte und ältere Menschen um. Der Pensionistenverband Österreichs fiel ein in den Chor derjenigen, die den Tweet scharf verurteilten, und kritisierte Hintsteiner für seine »abscheuliche Wortwahl«.
»Dann erzähl doch mal was über dich. Wie kommt's, dass du dich für die Identitäre Bewegung interessierst? Bist du schon mal politisch aktiv gewesen?« Smalltalk ist wohl nicht Hintsteiners Ding.
»Nein, nicht wirklich, nur mal was Ehrenamtliches für die FPÖ, Flyer verteilen und so«, sage ich und hole mein Telefon aus der Tasche, als müsste ich nach einer Nachricht schauen. »Aber du weißt ja, dass ich in Kontakt bin mit Martin.« Als ich erfuhr, dass die Identitären einen britischen Ableger gründen wollen, schickte ich meine Bewerbung an das Team in Großbritannien. Daraufhin meldete sich Martin Sellner, der österreichische Kopf der Bewegung, umgehend bei mir und schlug ein Treffen in Wien vor.
Aber Sellner kann heute nicht; er präsentiert sein neues Buch Identitär! Geschichte eines Aufbruchs auf der Frankfurter Buchmesse. Auf der Messe sind mehr als 7000 Aussteller aus über 100 Ländern, aber es ist sein Verlag, der kleine Rechtsaußen-Verlag Antaios, der die ganze mediale Aufmerksamkeit bekommt. Also treffe ich mich statt mit Sellner mit Hintsteiner und erfahre erst später, dass es, während wir in Wien Kaffee trinken, auf der Buchmesse Rangeleien gibt zwischen Identitären und Protestierenden, was zu Festnahmen und Gerüchten über »Sieg Heil!«-Rufe führt.
Ich bestelle einen Cappuccino mit Sojamilch und bereue meine Wahl sofort. Hintsteiner wirft mir einen überraschten Blick zu, ist aber nur halb so erstaunt wie der Kellner. »Es tut mir leid, mein Fräulein, wir sind ein altes Wiener Kaffeehaus. Wir haben keine Sojamilch.« Hintsteiner lacht.
»Wie lange, sagst du, wohnst du jetzt schon in London?« Meinem verlegenen Lächeln schenkt er keine weitere Beachtung. »Weißt du, es ist nämlich interessant, finde ich«, fährt er fort und zwirbelt seinen Löffel zwischen den Fingern. »Es kommen immer mehr Leute zu uns, die eigentlich gar nicht so interessiert sind an der Politik.« Auf seinem Gesicht flackert Stolz auf. »Wir sind mittlerweile die erste Anlaufstelle für junge Leute, die gehen nicht mehr zur FPÖ, wenn sie was verändern wollen, die kommen direkt zu uns.« Hintsteiner selbst hat sich den Identitären angeschlossen, nachdem er beim Ring Freiheitlicher Jugend, der Vorfeldorganisation der FPÖ, aktiv war.
»Ein paar Dinge solltest du wissen über uns: Wir sind nicht wie die alten Nazis, wir sind Ethnopluralisten.«
Am Tisch gegenüber sitzt ein schwules Pärchen. Das Gespräch der beiden bricht abrupt ab. Voller Scham, mit einem der Anführer einer offen homophoben Bewegung gesehen zu werden, senke ich die Stimme und wiederhole: »Ethnopluralisten …«
»Genau.« Edwin bemüht sich nicht, leise zu sprechen. »Für uns heißt Identität sowohl Kultur als auch Volkszugehörigkeit. Wenn man verhindern will, dass die europäische Zivilisation ethnisch und kulturell ersetzt wird, gibt es nur einen einzigen Weg: Die Einwanderer draußen halten«, erklärt er. Gemäß dem eigenen Leitbild ist es Ziel der Identitären Bewegung, homogene Gesellschaften zu schaffen, also Gesellschaften, in denen sich unterschiedliche Rassen und Kulturen nicht vermischen. Der erste Schritt für die Identitären wäre die Schließung jeglicher Grenzen. Das aber wäre für sie nicht genug. Da sie Migrantinnen und Migranten als Bedrohung wahrnehmen – auch die, die längst da sind –, wollen sie Einwanderer in einem zweiten Schritt in ihre jeweiligen Heimatländer zurückschicken. Das betrifft selbst die, die in zweiter und dritter Generation im Land leben und die Staatsbürgerschaft haben.
Die Identitäre Bewegung entstand aus dem Bloc Identitaire, einer 2002 von Sympathisanten des Antizionismus und des Nationalbolschewismus in Nizza gegründeten französisch-nationalistischen Gruppierung. Zehn Jahre später bildete sich innerhalb dieser Gruppierung der junge Flügel Génération Identitaire und dehnte sich sehr schnell auf Österreich, Deutschland, Italien und andere europäische Länder aus. Heute ist ›Generation Identity‹ das europäische Pendant zur US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung und fungiert als Mittler zwischen europäischen und amerikanischen Rechten. Martin Sellner, der früher selbst ein Neonazi war, ist in Europa und den USA zur bekanntesten Figur der Identitären geworden. In einem Versuch, sich als Marke neu aufzustellen, distanzierte Sellner sich von seinem früheren Mentor Gottfried Küssel, einem notorischen Holocaustleugner. Heute spricht Sellner von seinem Wunsch, Europas kulturelle und ethnische Identität bewahren zu wollen, wobei er aber nicht »Rassentrennung« oder »Apartheid« sagt, sondern Begriffe wie »Ethnopluralismus« verwendet. Er trägt auch keine Springerstiefel und Hakenkreuz-Tattoos, sondern Ray Ban und T-Shirt.
Hintsteiner schaut mich forschend an, so, als erwarte er ein Zeichen der Zustimmung. »Weißt du, wir gehören momentan zu den wenigen, die dem Großen Austausch Widerstand entgegensetzen.« Um seinem bohrenden Blick auszuweichen, sehe ich zu Boden. Beim Aufschauen sehe ich, wie die beiden Männer am Nachbartisch einen vielsagenden Blick tauschen. Wie die meisten Ideen der Identitären Bewegung ist auch ihre Vorstellung vom ›Großen Austausch‹ intellektuell inspiriert von der französischen Nouvelle Droite. Zu einem der beliebtesten Ideologen der Neuen Rechten gehört Guillaume Faye, ein französischer Schriftsteller und Journalist. In einer Rede, die er im rechtsextremen National Policy Institute in den USA gehalten hat, behauptete Faye, die Länder des Westens litten unter einer »Geisteskrankheit«, die er als »Ethno-Masochismus« bezeichnete. Laut seiner Diagnose ist der schrittweise Austausch der Weißen – der so genannte »weiße Genozid« – die Folge dreier Phänomene: Einwanderung, Abtreibung und Homosexualität. Der »weiße Genozid« sei entsprechend das Ergebnis eines Zusammenspiels mehrerer Faktoren: einerseits der Pro-Abtreibungs- und Pro-LGBT-Gesetzgebung, die die Geburtenraten der originären Europäer gesenkt hätte, andererseits einer Einwanderung befürwortenden Politik, die es bestimmten Minderheiten erlaubt habe, sich einer »strategischen Massenvermehrung« zu befleißigen. Eine ›schrittweise Übernahme‹, wie Martin Sellner es beschreiben würde.
Demografische Untersuchungen stützen diese Behauptungen nicht. Ein weit verbreiteter logischer Fehlschluss in den Argumenten der Neuen Rechten ist: Wenn A vor B kam, ist A Ursache von B (der »Post hoc ergo propter hoc«-Fehlschluss). Richtig ist: In Nordamerika und in Europa sind die Geburtenraten seit den 1950er Jahren stark gesunken. Genauso richtig ist es, dass viele westliche Länder ihre ›Schwulenparagraphen‹ aus den Gesetzbüchern gestrichen und die Anti-Abtreibungsgesetzgebung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelockert haben. Aber die Gründe für die fallenden Geburtenzahlen während der letzten 50 Jahre liegen woanders. Studien haben ergeben, dass dafür vor allem der höhere Lebensstandard verantwortlich ist, wobei zu den ausschlaggebenden Faktoren die höhere Bildung von Frauen, die freie Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln sowie die verbesserte Gesundheit und der Wohlstand von Kindern zählen.
Die Idee eines ›Großen Austauschs‹ hat Eingang gefunden in viele neue Ausprägungen antilinker oder antisemitischer Verschwörungstheorien, die meist alle von älteren Vorstellungen genährt werden, beispielsweise vom ›Hooton-Plan‹: 1943 veröffentlichte der US-Professor Earnest Albert Hooton einen Aufsatz, in dem er sich dafür aussprach, den Deutschen ihre »kriegerische Veranlagung« durch Kreuzung mit anderen Völkern »wegzuzüchten«. Viele rechtsextremistische Gruppierungen in Deutschland haben in den letzten Jahren die Flüchtlingskrise und die von der Regierung verfolgte Politik der offenen Türen als Beweis dafür herbeizitiert, dass der Hooton-Plan tatsächlich umgesetzt wird. Der Glaube an den ›Großen Austausch‹ lieferte die Motivation für den antimuslimischen Terroranschlag in Neuseeland ebenso wie den anti-semitischen Angriff auf die Poway-Synagoge in Kalifornien im Frühling 2019. Auch rechtspopulistische Politiker haben mittlerweile das Vokabular rund um die Verschwörungstheorie in ihr Lexikon aufgenommen. Nur wenige Wochen nachdem 50 Muslime in Christchurch ermordet wurden und Stunden nachdem die Poway-Synagoge angegriffen wurde, versprach Österreichs damaliger FPÖ-Vizekanzler H. C. Strache in einem Interview mit der Kronenzeitung, den ›Kampf gegen den Bevökerungsaustausch‹ konsequent weiterzuführen.
»Hast du Freunde, die schon bei den Identitären sind?« Ich schüttele den Kopf. »Interessant!«, platzt es aus ihm heraus. Leute, die nicht über private Kontakte zur Bewegung stoßen, bleiben tendenziell am längsten dabei, erklärt er mir. »Aber es ist in den letzten Jahren durchaus häufiger vorgekommen, dass Leute ganz aus Eigeninitiative heraus bei uns landen«, erzählt er mir, »was hauptsächlich an den sozialen Medien liegt.«
Hintsteiners Handy piept. Er entschuldigt sich und beantwortet eine SMS eines Journalisten von der belgischen Tageszeitung Le Soir. »Mit den ganzen Interviews war es in letzter Zeit fast ein bisschen stressig«, gibt er zu. Auch das Ausland hat ein zunehmendes Interesse an dem Rechtsruck in Österreich. Nervös sei er mittlerweile nicht mehr, erzählt er mir, dafür habe er schon zu viele Interviews gegeben. Und die Mainstreammedien verbreiteten ja sowieso nur Fake News, sagt er, »aber wir brauchen sie, weil sie kostenlos Werbung für uns machen«.
Die sozialen Medien aber sind deutlich wichtiger. »Weswegen wir jetzt ja auch mit Patriot Peer rauskommen.« Mit dieser App, so versprechen die Identitären, »bringen wir die schweigende Mehrheit miteinander in Kontakt« und »machen aus unserem Widerstand ein Spiel«. Alles wird gamifiziert: Man kann Punkte sammeln, indem man sich mit anderen Patrioten vernetzt, und das verbessert dann wiederum das eigene Rating. Hintsteiner sagt, sie wollten raus aus den rein akademischen Kreisen: »Wir machen nicht mehr nur an den Unis Werbung, sondern fahren auch Rekrutierungskampagnen an anderen öffentlichen Orten, an denen junge Leute unterwegs sind, in Schulen, Schwimmbädern und so weiter.«
Um die Reichweite und die Wirkung auf Jugendliche zu maximieren, begleiten sie alle ihre Offline-Aktivitäten auch von clever gemachten Online-Aktionen. Im Sommer 2017 charterten die Identitären ein 40 Meter langes Schiff, genannt C-Star, um NGOs im Mittelmeer an der Flüchtlingsrettung zu hindern. Dank hyperaktiver Social-Media-Feeds gelangte diese ›Mission‹ unter dem Hashtag #DefendEurope zu großer Bekanntheit: Tagtäglich wurden die Aktivitäten auf der C-Star auf Facebook und Twitter live gestreamt, und auf Instagram posteten die Identitären Fotos von ihren gebräunten Körpern in fancy Badeoutfits.
Die Unterstützung, die sie in den sozialen Medien erhalten, kommt aus der ganzen Welt, US-Videoblogger und Influencer aus der Alt-Right-Szene spielen allerdings eine große Rolle, damit ihre Hashtags wirklich trenden. Was sich auch in der finanziellen Unterstützung widerspiegelt. Edwin erzählt: »Für Patriot Peer haben wir Geldgeber aus allen möglichen Ländern. Aber vor allem die Unterstützung aus den USA ist groß.« Was er nicht weiß: Ich habe die vergangenen Wochen damit verbracht, mir die Finanzierungsnetzwerke der Identitären Bewegung genauer anzuschauen. Im Institute for Strategic Dialogue haben wir herausgefunden, dass der Großteil der 200 000 Euro, die an Spenden für die #DefendEurope-Aktion eingesammelt wurden, aus US-Quellen stammte – und das trotz des ja doch recht klaren Fokus auf die europäische Außengrenze.
»Warum expandiert ihr dann nicht nach Nordamerika?«, frage ich. Die USA hätten ja schon die Alt-Right, erklärt Hintsteiner, »weswegen wir über unsere dortige Strategie sehr sorgfältig nachdenken müssen«. In Kanada gab es bereits den Versuch einer Ausgründung, aber allzu gut funktioniert hat das nicht. »Das war ein bisschen ein Reinfall«, gibt Edwin mir gegenüber zu. Kein Wunder, bin ich versucht zu sagen: Es ist ja auch aberwitzig, einem Land, das stolz darauf ist, ein kultureller Schmelztiegel zu sein, die Idee einer homogenen Gesellschaft verkaufen zu wollen, und da, wo sich kaum jemand nicht als Einwanderer begreift, gegen Einwanderung zu sein. »In Kanada müssen wir uns imagetechnisch noch mal neu aufstellen«, so Hintsteiners Schlussfolgerung. Aber nicht an diesem Wochenende. Momentan ist Österreich dran.
»Hast du heute Abend schon was vor? Wenn du noch ein paar andere Identitäre kennenlernen möchtest: Wir wollen zur Wahlparty der FPÖ gehen. Kommst du mit?« Ich zögere. Dann sagt er: »Wir haben schon Cola und Club Mate kaltgestellt.« Und ich verschlucke mich an meinem Kaffee. Den Berliner Hipster-Drink Club Mate hätte ich nicht unbedingt bei Rechtsradikalen vermutet. »Tut mir leid, aber ich kann heute Abend nicht – Familienfest.«
Die FPÖ bekommt an diesem Abend 26 Prozent der Stimmen, ein schockierender Erfolg für eine Partei, die Verbindungen zu neonazistischen Bruderschaften pflegt.
Ein paar Tage später. Als ich mich bei Skype einlogge, ist Thomas schon online. Er hat sich aus Schottland zugeschaltet. Der neue Leiter von ›Generation Identity Scotland‹ lebt schon seit sieben Jahren in Großbritannien und verkauft hier Software. Seinen österreichischen Akzent hat er sich allerdings bewahrt. Er hat eine freundliche Stimme und spricht ruhig und unaufgeregt.
Thomas war gerade auf Besuch zuhause bei seiner Familie, als er vor einem halben Jahr spontan beschloss, bei einem der regelmäßigen Treffen der Identitären in einem Wiener Café vorbeizuschauen. Er hatte keine Ahnung, was ihn erwarten würde. »Ich war sehr überrascht«, erzählt er mir. »Ich hab erwartet, dass die so eine lange Sitzbank reserviert haben, oder einen Tisch. Aber das war das ganze Lokal.« Während der vergangenen Wochen hat Thomas die Entstehung eines britisch-irischen Ablegers der Gruppe vorangetrieben und die offizielle Gründung vorbereitet.
»Wow. So schnell haben die dir so viel Verantwortung gegeben?«
»Ja, irgendwie schon – das war, nachdem ich die Videos von Martin Sellner auf Englisch untertitelt und damit für die britische Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe.«