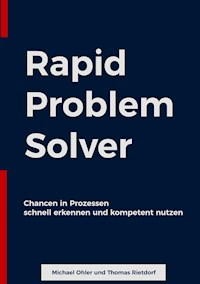
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Strukturierte und schnelle Problemlösung ist eine Kernkompetenz im heutigen Unternehmensalltag, die es direkt vor Ort aufzubauen gilt. Dieses Buch vermittelt dafür die nötige Systematik und das Handwerkszeug. Es richtet sich an Praktiker/innen, an Führungskräfte im unteren und mittleren Management sowie an Studierende der Qualitäts- und Wirtschaftswissenschaften. In Ergänzung zu den etablierten Methoden der Problemlösung, wie zum Beispiel Six Sigma, fokussiert dieses Buch auf fünf häufige Arten von Problemklassen: Reifegrad-, Abstimmungs-, Zeit- und Qualitätsprobleme sowie Probleme der Messbarkeit. Für diese bietet es eine leicht erlernbare und systematische Herangehensweise, die in bestehende Verbesserungsprogramme integrierbar ist. Für den Neuaufbau eines solchen Programmes bieten die hier dargestellten Methoden einen pragmatischen Ansatz, der sich später zu einem Six Sigma Programm erweitern lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Was Du vorab wissen solltest
Was uns zu diesem Buch inspiriert hat
Unsere Wahl der Sprachform
Probleme lösen macht glücklich
Rapid Problem Solving mit System
Rapid Problem Solving in Deinem Unternehmen
Besonderheiten der schnellen Problemlösung
Für wen dieses Buch geschrieben ist
Bevor Du loslegst
Schaffe die Voraussetzungen für die schnelle Lösung von Problemen
Probleme sind Potenziale, die darauf warten gehoben zu werden
Kläre Deine eigene Einstellung zu dem Problem
Findet Eure Grundregeln für die Zusammenarbeit im Team
Problemlösung ist auch eine Frage des „Stils“
Berücksichtige die „drei Geheimnisse“ erfolgreicher Problemlösung
Vertraue dem Fahrplan des Rapid Problem Solvings
Dein Fahrplan der Problemlösung
Ein Blick aus dem Helikopter
Fünf Arten von Problemen, die Du schnell lösen kannst
Rapid Problem Solving heißt: arbeite schnell!
Kläre Problem, Auftrag und Umfeld
Bereite die Problemlösung vor
Verstehe die Potenziale bei Reifegradproblemen
Verstehe die Potenziale bei Abstimmungsproblemen
Verstehe die Potenziale eines neuen Messsystems
Verstehe die Potenziale eines Zeitproblems
Verstehe die Potenziale eines Qualitätsproblems
Verbessern: baue eine wirksame Lösung auf und teste sie
Validiere die Lösung und gib ihr den richtigen Schliff
Gib den Schwung weiter
Beziehe Dein Umfeld in die Problemlösung ein
Warum es entscheidend ist, Menschen einzubeziehen
Verkaufe Dein Problem – bevor Du an die Problemlösung gehst
Lass Dich beim Rapid Problem Solving coachen
Manage aktiv das Portfolio der Stakeholder
Begeistere Deine Stakeholder mit einem „magischen Cocktail“
Nutze einen Elevator-Pitch für Deine täglichen Begegnungen
Nutze eine breite Palette von Kommunikationswerkzeugen
Erstelle einen Kommunikationsplan und halte ihn aktuell
Erzeuge möglichst viel Schwung für Deine Problemlösung
Stelle die Wichtigkeit der Problemlösung sichtbar unter Beweis
Bringe Entscheidungen schnell auf den Weg
Dokumentiere Deine Problemlösung wirkungsvoll
Kreative Problemlösung für Menschen und mit Menschen
Entwickele Empathie für die Menschen, deren Problem Du löst
Lerne, richtig zu fragen
Stelle Dir ein kleines, starkes Team zusammen
Rollen und Zuständigkeiten bei der Problemlösung
Deine Rolle als Teamleiter während der Problemlösung
Lerne Rapid Problem Solving Teams zu führen
Besprechungen geben dem Team Schwung und Richtung
Planung und Organisation sind die Grundlage des Erfolgs
Nutze Aktionspläne, um die Umsetzung zu beschleunigen
Nutze die Räumlichkeiten, um Kreativität, Teamarbeit und Geschwindigkeit zu fördern
Nutze divergentes und konvergentes Denken
Überwinde Hürden bei der Ursachenforschung
Betreibe Ursachenforschung mittels „Standard-Ursachen“
Binde Dein Team in die Datenanalyse ein
Erfasse das Expertinnenwissen zu möglichen Ursachen
Arbeite den Idealprozess heraus
Entwirf klare Szenarien der Lösung
Bringe Lösungsoptionen schnell „auf den Punkt“
Prozesse verstehen und verbessern
Warum die Arbeit am Prozess so wichtig ist
Erstelle eine Prozess-Übersicht
Erfasse den Reifegrad eines Prozesses
Erstelle ein detailliertes Prozess-Ablaufdiagramm
Verstehe den „Rhythmus” des Prozesses
Ermittele den Flaschenhals des Prozesses
Mache Zuständigkeitsbereiche im Prozessablauf sichtbar
Mache die „Transport“ und „Bewegung“ sichtbar
Mache die Wertschöpfung im Prozess sichtbar
Miss die Variation eines Prozesses
Miss die Prozessfähigkeit
Arbeite die Prozess-Zykluseffizienz heraus
Analysiere Risiken in einem Prozess
Schaffe hilfreiche Arbeitsstandards
Sorge durch Prozessdisziplin für nachhaltige Verbesserung
Sorge mit „5S“ für Ordnung
Sorge für eine gleichmäßige Arbeitsauslastung im Prozess
Mache die Bestände in einem Prozess sichtbar
Erfinde Lösungen, die Fehler unmöglich machen
Richte die gesamte Prozesskette nach dem Flaschenhals aus
Erzeuge eine Selbststeuerung des Arbeitsvorrats im Prozess
Reduziere die Variation im Prozess mit einfachen Mitteln
Mache Dir Daten zunutze
Warum Du die Grundlagen im Umgang mit Daten beherrschen musst
Erstelle die älteste aller Datenbanken: eine Strichliste
Der feine Unterschied: Du brauchst Daten, nicht (nur) Zahlen
Verstehe verschiedene Datentypen
Mache die Granularität von Daten sichtbar
Erstelle „aufgeräumte“ Datenstrukturen
Säubere Deine Daten, bevor Du sie analysierst
Fasse Daten mittels Pivot-Tabellen zusammen
Führe verschiedene Tabellen zusammen
Mache Dich mit einem Tabellenkalkulationsprogramm vertraut
Denke in „Fischgräten“, wenn Du Daten analysierst
Bereite Deine Datenerhebung mit einem Brainstorming vor
Nutze Mittelwert, Median und Modus
Bestimme die Streuung von kontinuierlichen Daten
Stelle die Häufigkeitsverteilung von kontinuierlichen Daten dar
Identifiziere auffällige Häufigkeitsverteilungen von kontinuierlichen Daten
Stelle die Häufigkeitsverteilung von diskreten Daten dar
Stelle zeitliche Verläufe dar
Lerne Regelkarten zu lesen und zu verwenden
Visualisiere Zusammenhänge zwischen Merkmalen
Verwende Wort-Wolken, um Häufigkeiten einmal anders darzustellen
Nutze Netz-Diagramme, um Systeme anhand von Leistungskennzahlen zu vergleichen
Stelle dreidimensionale Daten wirkungsvoll dar
Nutze Daten für eine SMART Zielformulierung
Erzeuge ein scharfes Verständnis des Problems
Das Verständnis eines Problems ist der Schlüssel zu seiner Lösung
Dämme dringende Probleme zunächst ein, bevor Du sie löst
Nutze sieben W-Fragen, um ein Problem zu beschreiben
Kläre, ob Dein Problem überhaupt schnell gelöst werden kann
Erkenne die Art des Problems, das es zu lösen gilt
Erkenne die zugrunde liegende Aufgabe
Erfasse den Anforderungskatalog des zu lösenden Problems
Erfasse den „Schmerzpunkt“ von Betroffenen
Zerlege große Probleme in kleinere
Sorge dafür, dass Deine Lösung funktioniert und nachhaltig ist
Erstelle schnelle Prototypen Deiner Lösungsideen
Bewerte Lösungsmöglichkeiten nach Wirksamkeit und Umsetzbarkeit
Bewerte Lösungen anhand von Zielgrößen
Erhöhe den Prozessreifegrad um eine Stufe
Finde die beste Lösung mit A/B- oder A/B/C-Pilotläufen
Entwickele ein wirkungsvolles Messsystem
Prüfe die Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit der Lösungen
Stelle die Nutzerfreundlichkeit der Lösung für „extreme Nutzer“ sicher
Betrachte Deine Lösung aus sechs verschiedenen Richtungen
Entwickle „Stresstest-Szenarien“ für Nutzungsbedingungen Deiner Lösung
Führe eine Risikobewertung Deiner Lösung durch
Führe eine wirkungsvolle Prozesssteuerung ein
Stelle eine Überwachung der Wirksamkeit Deiner Lösung sicher
Erstelle einen wirkungsvollen Bericht Deiner Problemlösung
Übergib die Verantwortung für die Lösung
Grundlagen und Hintergründe
Wo kommen die Methoden her?
Das Minimalprinzip
Was ist ein „Quick Win“?
Was ist Kaizen?
Die fünf Prinzipien von Lean
Was sind „wertschöpfende“ Arbeitsschritte?
Die acht Formen der Verschwendung
Der kreative Denkprozess
Der PDCA-Zyklus
Der DMAIC-Fahrplan
A3-Denken der Problemlösung
Die 8D-Methode der Problemlösung
Das Vorgehen bei Design Thinking
Wenn Du mehr wissen möchtest
Glossar
Anhang 1: Abbildungsverzeichnis
Anhang 2: Tabellenverzeichnis
Die Autoren
Dieses Buch ist all denen gewidmet,
die in ihrer täglichen Arbeit oder Freizeit Probleme lösen
und so dazu beitragen, dass diese Welt eine bessere wird.
Wir erwarten keine hohen Erlöse durch den Verkauf dieses Buches. Die Einnahmen werden wir Zwecken anerkannter Gemeinnützigkeit zukommen lassen.
Was Du vorab wissen solltest
Was uns zu diesem Buch inspiriert hat
Strukturierte und schnelle Problemlösung ist eine Kernkompetenz im heutigen Unternehmensalltag. Die Idee, unsere Erfahrungen dazu in einem Buch zusammenzufassen, entstand im September 2020 bei einem Mittagessen mit Mareike. Ihr mag selbst nicht bewusst sein, wozu unser Gespräch damals geführt hat. Thomas, Michael (beide mit dem gleichen Vornamen wie die zwei Autoren) und Franziska haben Teile des Manuskripts gelesen und uns wichtige Rückmeldungen gegeben.
Die Konzepte und Ideen in diesem Buch stammen vor allem aus jahrelanger Zusammenarbeit mit Menschen, die sich darum kümmern, dass wir mit Medikamenten, Impfstoffen und Lebensmitteln versorgt werden, eine funktionierende Telefon-/Internetverbindung und ein Bankkonto haben; die Flugzeuge be- und entladen oder dafür sorgen, dass diese sicher starten, fliegen und landen; die unsere Produkte des täglichen Lebens herstellen, uns am Telefon Rede und Antwort stehen und unsere Beschwerden ernst nehmen.
Meist sehen wir all diese Menschen nicht und denken auch nicht daran, dass das Paket, das uns die Postbotin morgens übergibt, nachts sortiert, verladen und transportiert wurde. Auch wenn wir sie nicht sehen oder nicht einmal an sie denken: diese Menschen denken an uns, während sie am Produktions- oder Förderband, im Kontrollturm oder am Dampfsterilisator stehen. Denn wir sind ihre Kunden.
Es ist Privileg und eine Ehre, direkt mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen. Dieses Buch ist vor allem für all die geschrieben, die „direkt im Prozess“ stehen. Wir möchten ihnen Herangehensweisen und Werkzeuge an die Hand geben, sodass sie ihr Umfeld selbst gestalten und verbessern können.
Unsere Wahl der Sprachform
Im Rahmen dieses Buches erlauben wir uns, Leserinnen und Leser zu duzen – selbst wenn wir manche von Euch bei einem persönlichen Treffen siezen würden. Die hier wiedergegebenen Erfahrungen sind vor allem dazu gedacht, dass Ihr bei Euren Verbesserungsprojekten immer wieder innehaltet, in alle Richtungen blickt und mit Euch selbst und Eurem Team Rücksprache haltet:
„Wartet mal, wollen wir vielleicht nicht noch…“
Dieses Buch soll ein Hilfsmittel bei diesen Rücksprachen sein. Ihr duzt Euch selbst und oft auch untereinander – und dieses Buch tut das auch. In machen Büchern wird zudem „der Leser“ angesprochen – und „die Leserin“ ist selbstverständlich ebenso gemeint. Wir erweitern diese Sprachform und schreiben immer wieder auch von „der Chefin“ – und schließen dann „den Chef“ mit ein. Wenn uns eine 50-50-Aufteilung nicht durchgehend gelungen ist, dann hoffen wir, dass Du, liebe Leserin, uns das nachsiehst. Für den einen mag diese Wahl zunächst überraschend erscheinen, die andere mag darüber schmunzeln. Wir selbst haben uns schnell daran gewöhnt und hoffen, dass es Euch ebenso geht.
Probleme lösen macht glücklich
Tagtäglich musst Du Probleme lösen. Das mag zunächst nach Sisyphus-Arbeit klingen: kaum ist der Spiegel an einer Wegkreuzung im Lager angebracht, muss die Checkliste für die Prüfung der eingehenden Ware überarbeitet oder die Produktinformation auf der Webseite aktualisiert werden. Unter den richtigen Randbedingungen handelt es sich hier jedoch keineswegs um Sisyphus-Arbeit. Vielmehr tun sich große Chancen für Dich auf:
Du kannst Deine eigene Umgebung gestalten.
Auch Unternehmen müssen täglich Probleme lösen. Lieferant A bleibt in Sachen Liefertreue oder Qualität hinter den anderen zurück; Kunde B möchte die Reklamationen schneller bearbeitet sehen; der Ausschuss beim Stanzen ist unerklärlicherweise gestiegen: „Ständige Verbesserung“ klingt nach der bitteren Pille, die Mitarbeiterinnen und Führungskräfte schlucken müssen, um ihrer Rollen gerecht zu werden. Aber auch hier gibt es eine andere Blickrichtung:
Jedes Glas ist halb voll – und der Rest ist Potenzial.
Als Vorgesetzte könntest Du Probleme einfach „verwalten“. Führen heißt jedoch vor allem, Wandel und Verbesserung zu bewirken und zu ermöglichen. Ständige Problemlösung ist kein notweniges Übel, sondern vielmehr der wichtigste Schlüssel zu nachhaltigen Arbeitsplätzen und zufriedenen Mitarbeitern. Als Führungskraft bist Du deshalb Optimistin: jedes Glas ist halbvoll - und der Rest ist Potenzial…
Es fehlt nicht an Literatur zum Thema „systematischer Verbesserung“. Du findest viele gute Bücher und Kurse zu Lean, Six Sigma, Engpasstheorie und anderen Ansätzen. Mit der richtigen Vorgehensweise lassen sich große Probleme lösen und umwälzende Veränderungen bewirken. Experten dieser Methoden sind gefragt und geschätzt.
Dieses Buch verfolgt jedoch eine andere Zielrichtung: Es geht uns um die vielen kleinen und mittelgroßen Probleme, für die Experten oft keine Zeit haben. Es geht um Themen, die Du selbst angehen musst – weil es sonst niemand täte. Bei dieser Arbeit haben wir eine wichtige Entdeckung gemacht:
Alle Menschen sind kreativ und können Probleme lösen.
Unabhängig von Hierarchie- und Bildungsstand können Menschen Chancen erkennen und nutzen, etwas bewegen und Neues erlernen. Sie haben vor allem Freude daran, ihr Können gestalterisch anzuwenden. Viele erleben wahre Glücksmomente, wenn sie ihren eigenen Einflussbereich vergrößern und Dinge verändern können, die sie vorher als unabänderlich hinnehmen mussten. Entscheidend dafür ist jedoch, dass sie diese Fähigkeiten und Neigungen nicht mit Betreten des Werksgeländes abstreifen.
In unserer sich schnell wandelnden Welt ist Problemlösungskompetenz deshalb nicht mehr nur im Hauptquartier eines Unternehmens oder bei Expertinnen und Führungskräften wichtig. Sie wird vor allem direkt vor Ort gebraucht: an der Maschine, auf dem Gabelstapler, oder am Telefonhörer.
Problemlösungskompetenz muss demokratisiert werden.
Unternehmen, die Problemlösungskompetenzen direkt dort aufbauen, wo Probleme gelöst werden können und müssen und so menschliche Kreativität unmittelbar nutzbar machen, schaffen nicht zuletzt neue Freiräume und Aufgaben für Führungskräfte. Ist vielleicht Dein Tagesablauf von „Feuerlöschen“ gekennzeichnet oder bist Du damit beschäftigt, die Befolgung von Regeln an- und deren Missachtung abzumahnen? Wenn es Dir und Deinem Unternehmen gelingt, Hierarchiestufen und Unternehmensbereiche miteinander zu verzahnen und Abläufe und Entscheidungen in Fluss zu bringen, dann verändert sich nicht nur Dein Arbeitsalltag. Es entstehen auch völlig neue strategische Möglichkeiten für das gesamte Unternehmen.
Problemlösungskompetenz direkt vor Ort eröffnet neue strategische Möglichkeiten.
Ohne Fleiß und Schweiß wird sich dieser Preis jedoch nicht einstellen. Eine Analogie sei erlaubt. Von dem japanischen Schwertkämpfer Miyamoto Musashi (1584-1645) ist das Buch „Die Kunst des Samurai-Schwertweges“ überliefert. Niemand würde sich einzig aufgrund der Lektüre dieses Buches einem tatsächlichen Kampf auch nur mit Holzschwertern stellen. Selbst ein einwöchiger Kurs in der Schwertkunst Kendo würde zwar Techniken vermitteln, die durchaus Erstaunen auslösen können. Der „Weg des Schwertes“ ist jedoch ein lebenslanger Weg des Lernens.
So ähnlich verhält es sich auch mit der Kunst, in Geschäftsprozessen Chancen zu erkennen und Probleme zu lösen. Die mit diesem Buch verbundene Hoffnung ist es, Dir dabei hilfreich und auf Deinem Weg ein treuer Begleiter zu sein.
Rapid Problem Solving mit System
In jeder Organisation gibt es eine Vielzahl von Problemen, deren Lösung den Geschäftserfolg steigert. Jede Organisation hat zudem ihre eigenen Verfahren, um damit umzugehen. So kann die Verbesserungskultur in Deinem Unternehmen geprägt sein von einer pragmatischen Grundhaltung: „Einfach Machen!“. Vielleicht wendet Ihr auch PDCA-Zyklen an (Plan-Do-Check-Act) oder Ihr habt Euch einer ganzheitlichen „Philosophie“ verschrieben wie Lean, Six Sigma oder Agile. Die Problemlösungskompetenz einer Organisation entwickelt sich im Laufe der Zeit und kann auch in Teilbereichen einen jeweils anderen Entwicklungsgrad aufweisen: die Produktion kann anders vorgehen als die Finanz- oder die Personalabteilung.
Dieses Buch vermittelt Dir eine Systematik für das schnelle Lösen von Problemen. Deshalb solltest Du Dir über die Klagen bewusst sein, die Du vermutlich auch schon gehört hast, dass nämlich gerade systematisch angegangene Verbesserungsprojekte „zu lange“ dauern. Diese Klagen sind oft berechtigt: Nach sechs Monaten Greenbelt-Projekt besteht die Lösung schließlich darin, dass die Dimensionen eines Zulieferteils neu spezifiziert werden. Das zu erkennen ist wichtig. Aber muss das so lange dauern? In einem anderen, ebenso langen Projekt wird schließlich ein Prozessablauf zum ersten Mal schriftlich festgehalten und die Befolgung verbindlich eingefordert. Hätte man das nicht „gleich sofort“ tun können? Oder nach monatelangem Ringen werden Probleme zwischen Logistik und Produktion durch ein neues wöchentliches Treffen gelöst. Kann man sich auf so etwas nicht schneller einigen?
Manchmal kommen sich bei der Problemlösung auch Methode und Auftrag ins Gehege: Das Projekt soll zwar nach Six Sigma bearbeitet werden, aber der Projektauftrag nimmt schon die Lösung vorweg: „löse das Problem X, indem Du die Lösung Y einführst“. Um dennoch der Six Sigma Methode zu folgen, entwickeln die Arbeiten in der Folge eine Eigendynamik, die weder gewünscht noch erforderlich ist.
In diesem Zusammenhang basiert der Ansatz dieses Buches auf einer überraschenden Erkenntnis:
Du kannst fünf Problemklassen schnell lösen. Oft erstaunlich schnell.
Interessanterweise treten im Unternehmensalltag vor allem gerade diese fünf Problemklassen besonders häufig auf:
Reifegradprobleme
Abstimmungsprobleme
Probleme der Messbarkeit
Zeitprobleme und
Qualitätsprobleme.
Wenn diese Probleme zudem noch eine leicht nachprüfbare Struktur aufweisen, dann ist eine schnelle Lösung in der Regel möglich. Das mag zunächst erstaunlich klingen, aber so ist es. Es verlangt Dir allerdings auch von Anfang an Kreativität und Vorstellungsvermögen ab: Deine Auftraggeberin weiß in der Regel nicht, wie ein Problem aussehen muss, sodass es sich schnell lösen lässt. Liebend gern würde sie vielleicht auch nur einen Teilaspekt schnell gelöst sehen, weiß aber nicht, wie sie diesen Aspekt herausarbeitet. Bei der schellen Problemlösung kommt es auf eine angepasste Vorgehensweise an:
In den ersten drei Phasen (Klärung, Vorbereitung, Verständnis) stellst Du fest, ob das gegebene Problem für eine schnelle Problemlösung geeignet ist. Wenn das der Fall ist, dann „ziehst Du Dir den Schuh an“ und löst das Problem. Wenn sich das Problem als ungeeignet für eine schnelle Lösung herausstellt, dann kannst Du es innerhalb kurzer Zeit zumindest gut aufbereiten und es an einen Experten weitergeben: es ist dann nicht mehr „Deine Baustelle“. Denn Deine Hauptaufgabe besteht im Tagesgeschäft und Du bearbeitest nur Probleme, die Du auch schnell lösen kannst. Was länger dauert, erfordert oft auch andere Ansätze als die, die Du hier erlernst. Wichtig ist: Selbst, wenn Du das Problem nicht löst, lässt Du den Ball nicht einfach fallen. Durch Deine Vorarbeit sorgst Du vielmehr dafür, dass ein Experte sofort loslegen kann. So ist allen geholfen.
Dein Vorgehen von der Klärung bis zur Weitergabe des Schwungs findet vor allem nicht „im luftleeren Raum“ statt. Du brauchst Richtschnüre. Für die meisten Menschen wird so das Lösen von Problemen zu einer so spannenden Aufgabe:
Richte Deine Verbesserungsarbeit aus an Menschen, Prozessen und Daten.
Ohne diese drei Richtschnüre kannst Du viele Probleme gar nicht lösen – weder schnell noch langsam. Um Probleme schnell lösen zu können, musst Du für diese drei Bereiche eine gewisse Expertise entwickeln – die Dir dieses Buch mitgibt.
Rapid Problem Solving in Deinem Unternehmen
Kreativität und Problemlösung gehen Hand in Hand: Menschen – und andere Lebewesen – sind in der Lage, Lösungen für neue Herausforderungen zu finden. Sie lernen von vergangener Problemlösung und können das Gelernte an andere weitergeben. Diese drei Fähigkeiten der Problemlösung stellen sowohl für das Individuum als auch für die Gemeinschaft entscheidende Vorteile dar.
Unternehmen kultivieren Problemlösungsfähigkeiten, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Indem sie sich auf Vorgehensweisen, Werkzeuge und Standards einigen, können Einzelne und Teams systematisch und zielgerichtet an neuen Fragestellungen arbeiten und dabei sowohl auf ihre eigenen als auch auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen. Sie kommen so nicht nur schneller ans Ziel, sondern erarbeiten auch bessere Lösungen.
Arbeit soll flüssig von der Hand gehen und Freude machen. In einer erfüllten Arbeitswoche schaffst Du Dinge, auf die Du stolz sein kannst, und Kundinnen geben Dir positive Rückmeldungen. Falls Probleme auftreten, dann sollen die möglichst schnell aus der Welt geschaffen werden. Mit „macht einfach mal“ allein ist es aber in der Regel nicht getan. Auf Dauer können Probleme auch nicht „unter den Teppich gekehrt“ werden – und nicht nur im Privatleben bleiben manche Probleme bestehen, weil sich niemand die Zeit nimmt, das Thema von Grund auf und systematisch anzugehen.
Wir haben folgende Erfahrungen gemacht:
Probleme, die für eine schnelle Problemlösung geeignet sind, sind in der Regel leicht erkennbar
Um schnell zu sein, musst Du Probleme zunächst klären, dann bearbeiten und die Lösung vor allem an die Menschen weitergeben, die sie in ihrem Arbeitsalltag verwenden sollen
Für die schnelle Bearbeitung eines Problems durchläufst Du am besten den „4V-Zyklus“: Vorbereiten, Verstehen, Verbessern, Validieren.
Während Deiner Problemlösung behältst Du drei Richtschnüre im Blick: Menschen, Prozesse und Daten.
Du brauchst auch eine gut bestückte „Werkzeugkiste“, um flexibel zu sein. Die Kunst der schnellen Problemlösung besteht darin, diese Werkzeuge zielgerichtet einzusetzen.
Es ist hilfreich, wenn Dein Unternehmen über eine fest etablierte Verbesserungskultur verfügt. Falls das nicht gegeben ist, dann kannst Du, dann könnt Ihr, durchaus mit schneller Problemlösung beginnen: Ihr zerlegt Herausforderungen in „mundgerechte Häppchen“ und geht diese eines nach dem anderen an. Nach und nach könnt Ihr die Methoden des Rapid Problem Solvings durch weitere ergänzen und schließlich in einem ganzheitlichen, z.B. auf Lean Management oder Six Sigma basierenden Ansatz aufgehen lassen.
Falls Deine Organisation heute schon Problemlösung systematisch angeht, dann kann das hier dargestellte Vorgehen eine interessante Ergänzung darstellen für diejenigen Probleme, nicht einfach als „Just do it“ erledigt werden können, aber doch zu klein sind, um auf „offiziellen“ Projektlisten geführt zu werden. Ihr könnt dann aus diesen Themen einen „Backlog-Speicher“ erstellen, sie nach agilen Prinzipien bearbeiten und so das Spektrum der Problemlösungskompetenz in Eurer Organisation erweitern.
Je mehr Erfahrung Du in Sachen Problemlösung sammelst, desto mehr kannst Du im Laufe der Zeit bewirken. Du musst Dich mit den Dingen nicht mehr abfinden und kannst stattdessen selbst gestalten. So trägst Du zum Erfolg Eurer Abteilung und Eures Unternehmens bei – vor allem dann, wenn es um schnelle Problemlösung geht. Denn hochspezialisierte Problemlösungsexpertinnen können gar nicht all die vielen Probleme angehen, die im Tagesgeschäft auftreten. Dank Deiner Arbeit können diese Leute sich tatsächlich auf die großen Themen konzentrieren. Wenn sich allerdings ein Problem als eine „zu harte Nuss“ entpuppt, dann solltest Du Dir daran nicht „die Zähne ausbeißen“, sondern es gut aufbereitet weitergeben.
Wahrscheinlich kennst Du die 80-20 Regel. Sie hilft Dir und Deinen Kolleginnen, eine „Vision“ zu erkennen, wie Euer Bereich in Zukunft aussehen kann, wenn Ihr Eure eigenen Probleme schnell löst und die unlösbaren an Experten weitergebt.
Abb. 1: Kaskade der Problemlösung im Tagesgeschäft.
Was wäre, wenn von 1000 Problemen 800 sofort und direkt vor Ort gelöst würden? Es gäbe dann nur noch 200 Probleme, deren Lösung Ihr geplant angehen müsstet. Und was wäre, wenn davon wiederum 160 innerhalb weniger Tage gelöst werden könnten? Diese 960 von 1000 Problemen fallen in den Bereich des Rapid Problem Solvings.
Von den verbleibenden 40 Problemen können wiederum 80%, also 32, von Experten für systematische Verbesserung gelöst werden, von Leuten, die genau dafür ausgebildet wurden und die wissen, wie man solche Dinge angeht.
Was ist das Ergebnis? Ihr könntet Euren Bereich zu großen Teilen selbst gestalten und „fit halten“. Ihr könntet auch gezielt Hilfe einfordern, und zwar genau dann, wenn das auch nötig ist. So bleiben schließlich nur noch 8 von 1000 Problemen übrig, um die Euer Management sich kümmern müsste.
Solch ein Umfeld und die Fähigkeit zu dieser Art von Problemlösung über die gesamte Organisation hinweg aufzubauen, stellt einen großen Wettbewerbsvorteil – aber auch einen nicht unerheblichen kulturellen Wandel dar.
Anstatt 800 Problemen „unter dem Teppich“ und 200 Probleme „in der Warteschleife“ werden 992 Probleme gelöst. Die Welt sieht ganz anders aus!
Besonderheiten der schnellen Problemlösung
Du fragst Dich vielleicht: Wie soll das funktionieren, Probleme schnell zu lösen? Das ist eine berechtigte Frage – und ein bisschen Geduld musst Du mitbringen, um Dich in die Vorgehensweisen einzuarbeiten. Wir möchten aber schon an dieser Stelle eine wichtige und überraschende Erkenntnis mit Dir teilen:
Die Verstehen-Phase des Rapid Problem Solvings richtet sich nach der Natur des Problems. In allen anderen Phasen gehst Du immer gleich vor.
Diese Erkenntnis ist sehr nützlich, wenn Du sie gezielt einsetzt. Die Methodik des Rapid Problem Solvings ist auch genau darauf ausgerichtet. Es handelt sich hier übrigens nicht um eine neue Erkenntnis. Sie wird vielmehr bei der „erfinderischen Problemlösung“ TRIZ explizit eingesetzt. Auch dort liefert das Problem selbst den Leitfaden für die Lösung eines Problems.
Wenn Du mit der Methode vertraut bist, dann hast Du vielleicht auch selbst schon erlebt, dass manche Probleme sich nur mit Mühe „über den DMAIC-Kamm scheren“ lassen (s.S. →). Bei Problemen, deren Lösung bekannt ist, wäre das unnötig. Genauso sollten Probleme, die sich schnell lösen lassen, mit einer angepassten Vorgehensweise angegangen werden.
Dafür musst Du allerdings lernen, Probleme „passend“ aufzubereiten. Ein Beispiel dazu: Du hast einen Prozess vor Dir, in dem „rein gar nichts funktioniert“. Stakeholder sprechen dann oft von einem „Chaos-Laden“. Solche Prozesse führen in der Regel nicht nur zu einem sondern zu allerhand Problemen. Wenn Deine Aufgabe darin nun besteht, „mal gründlich aufzuräumen“, dann könntest Du versucht sein, all diese vielen Probleme zu erfassen, zu priorisieren und dann eines nach dem anderen zu bearbeiten. Oft verhedderst Du Dich dabei aber in einem Gewirr von Stakeholder-Erwartungen und verlierst viel Zeit. Unser Ansatz ist, solch ein Problem als ein Reifegradproblem aufzufassen: der Prozess ist noch „unreif“. Dein Ansatz besteht dann darin, den Reifegrad um genau eine Stufe zu heben. So löst Du viele der Probleme auf einen Schlag.
Bei dieser und bei den anderen Arten von Problemen, die sich schnell lösen lassen, kommt es auf folgende Aspekte an:
Wende konsequent das Minimalprinzip an (s.S.
→
)
Binde Stakeholder in die Problemlösung ein
Zeige Auftraggeberin und Prozesseigner auf, wie sie ihre Rollen wahrnehmen
Entwickele Empathie und Einfühlungsvermögen für die Nutzer der Lösung des Problems
Beachte auch, dass Lösungen in einem Kreativprozess „erfunden“ werden
Zerlege große in kleinere Probleme und löse diese Schritt für Schritt.
Wir sind übrigens überzeugt, dass nicht nur schnelle Projekte erfolgreicher werden, wenn Du diese Aspekte berücksichtigst. Umso wichtiger ist es, dass Du sie verinnerlichst.
Dieses Buch ist auch als Leitfaden geschrieben. Du siehst das allein schon an dem langen Inhaltsverzeichnis: Wenn Du mitten in Deiner Problemlösung bist, dann sollst Du schnell das richtige Kapitel finden können. So haben sich auch einige Dopplungen von Inhalten ergeben. Um diese so gering wie möglich zu halten, verweisen wir Dich explizit auf andere Kapitel.
Für wen dieses Buch geschrieben ist
Du steckst mitten im Tagesgeschäft.
Das Tagesgeschäft ist Deine Aufgabe und vielleicht auch Deine Passion: alles soll „laufen wie am Schnürchen“. Nur gibt es eben immer wieder Probleme, die Du aus der Welt schaffen möchtest. Für eine gewisse Zeit übernimmst Du deshalb die Leitung eines Verbesserungsprojekts. Dieses Buch gibt Dir dafür den Leitfaden. Du musst das Buch nicht von vorne bis hinten durchlesen. Die Kapitel sind so kurz, dass Du Dinge auch schnell nachschlagen kannst. Immer wieder wirst Du auf Aussagen stoßen, die Du in anderen Kapiteln schon gelesen hast. So musst Du dort nicht extra nachblättern.
Du bist eine Führungskraft.
Du verantwortest den reibungslosen Ablauf Deines Zuständigkeitsbereichs. Vielleicht musst Du ständig „Feuer löschen“. In gewisser Hinsicht fühlt sich das vielleicht sogar gut an – denn Du bist „unersetzlich“. Du weißt aber auch, dass das so nicht richtig ist. In Deinem Zuständigkeitsbereich sollen die Dinge „im Fluss“ sein und Probleme müssen schnell aus der Welt geschafft werden. Deshalb möchtest Du Dich mit den Möglichkeiten des Rapid Problem Solvings vertraut machen. Es geht Dir darum, Deine Rolle zu verstehen, wie Du in Deinem Bereich Probleme schnell lösen kannst und wie Du Deine Mitarbeiterinnen möglichst gut dafür einsetzt. Auch willst Du Dich selbst und Dein Team in Sachen Problemlösungskompetenz ständig weiterentwickeln.
Möglicherweise gibt es in Deinem Unternehmen Leute, die zuverlässig und vorhersagbar größere Probleme durch Lean, Six Sigma oder andere Ansätze lösen können. Vielleicht bist Du sogar selbst in diesen Methoden geschult. Wenn es aber darum geht, „mal schnell“ die ständigen Staus im Rechnungsversand zu entwirren, wenn Du aufzuspüren musst, bei welchem Prozessschritt die Kratzer am Produkt entstehen, oder Du eine Einigung zu einem bisher „ad hoc“ ablaufenden Prozess erzielen möchtest, dann sind diese Experten oft nicht schnell genug verfügbar. Erstaunlich häufig werden sie auch gar nicht gebraucht. Denn die meisten Verbesserungen sind kein „Hexenwerk“: Das könnt Ihr selbst!
Du bist Teil des Managements. .
Wir sind ehrlich: Große Teile dieses Buch sind nicht für Dich geschrieben. Es ist für Deine Leute geschrieben und vermittelt ihnen das „Gewusst Wie“. Deine Aufgabe besteht darin, ihnen die „schnelle Problemlösung“ zu ermöglichen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sie erfolgreich sein kann. Du musst diese Arbeiten also aktiv wollen und unterstützen. Deine Rolle dabei ist entscheidend. Konkret kannst Du folgendes tun:
Entwickele einen Blick für den „Gesundheitszustand“ von Prozessen. Lerne Verschwendung, Unordnung und Mangel an Ergonomie zu erkennen, denn gerade in Zeiten von Stress entstehen hier viele Probleme
Akzeptiere, dass Probleme eingegrenzt werden müssen, um schnell gelöst zu werden. Mache Dich deshalb mit den fünf Arten von Problemen und der jeweiligen Herangehensweise vertraut.
Akzeptiere auch, dass Problemlösungsteams potenzialorientiert arbeiten. Es geht in erster Linie darum, schnell genau ein Potenzial zu heben – und dann dem Minimumprinzip folgend die Problemlösung abzuschließen. Ständige Verbesserung und Veränderung stehen im Vordergrund. Du musst akzeptieren, dass Probleme nicht „ein für alle Mal“ aus der Welt geschafft werden.
In der Feuerzangenbowle heißt es: „Medizin muss bitter sein, sonst wirkt sie nicht“. Wenn Deine Leute schnell Probleme lösen sollen, dann musst Du ihnen die nötige Zeit geben, sodass sie daran arbeiten können. Sei vor allem sichtbar, wenn Probleme gelöst werden.
Sorge dafür, dass es eine „Pipeline“ gibt von Problemen, die auf ihre Lösung warten. Wenn es keine weiteren Ideen mehr gibt oder diese nicht „wertvoll“ genug sind, dann solltest Du Dich zuständig fühlen: auch in Deinem Bereich.
Um es noch einmal anhand eines Beispiels klar zu sagen: Du kannst ein schnelles Problemlösungsteam nicht dafür verantwortlich machen, die Bearbeitungszeit von Kundenreklamationen um die Hälfte zu reduzieren. Das ist deshalb nicht möglich, weil Du nicht weißt, ob die Potenziale, die sich schnell adressieren lassen, dafür ausreichen. Du kannst aber sehr wohl erwarten, dass das Team Potenziale aufzeigt, eines davon auswählt und adressiert. Danach liegt es an Dir, ob noch weitere Potenziale angegangen werden sollen oder ob nun – dem Minimumprinzip folgend – andere Probleme im Vordergrund stehen.
Bevor Du loslegst
Schaffe die Voraussetzungen für die schnelle Lösung von Problemen
Um Chancen zu erkennen und zu nutzen, brauchst Du Prozessexpertise. Ohne geht es oft nicht. Eine erfahrene Automechanikerin mag sagen: „machen Sie mal den Motor an“ – und schon hört sie, dass mit dem Vergaser etwas nicht stimmt. Genauso gibt es auch Fertigungsexperten, die nach einem Rundgang wissen, wo anzusetzen ist, um die Kapazität eines Werks zu steigern. Solche Expertise musst Du selbst mitbringen oder in Deinem Verbesserungsteam verfügbar haben, um Chancen zu erkennen und zu nutzen. Doch mit dieser Expertise allein ist es oft nicht getan.
Immer wieder liegen die besten Lösungen nämlich außerhalb des eigenen Erfahrungshorizonts und manchmal sogar außerhalb der eigenen Industrie. So kann der Check-in bei einer Fluglinie eine Inspirationsquellen für den entsprechenden Prozess bei einer Hotelkette darstellen. Das Flughafenhotel ist dabei womöglich nur genauso wenige Schritte entfernt wie ein Nachbarbetrieb Deines Unternehmens.
Abb. 2: Lösung spezifischer Probleme mittels Standardlösungen
Trotz allen Fachwissens bleibt das Offensichtliche dennoch immer wieder unerkannt: Es will gelernt sein, Chancen und Möglichkeiten zu erkennen. Entscheidend dabei ist, Muster in einem gegebenen Problem zu erkennen, es in ein Standardproblem zu überführen, Standardlösungen zu finden und diese auf das ursprüngliche Problem zu übertragen. Für diese allgemeine Problemlösungsexpertise möchte dieses Buch eine Grundlage schaffen.
Glücklicherweise lassen sich die zugrunde liegenden Methoden erlernen. Sie sind zudem industrieübergreifend einsetzbar. Wenn Du diese Methoden beherrschst, dann kannst Du sie bereichsunabhängig einsetzen, solange Du die spezielle Prozessexpertise in Deinem Team verfügbar hast. Zudem stehen für viele Standardprobleme umfangreiche Methodensätze zur Erarbeitung von Standardlösungen bereit. Die verbleibende Kunst besteht dann darin, diese Standardlösungen auf den jeweiligen Kontext anzupassen.
Zum Lösen von Problemen brauchst Du in Deinem Team allgemeine Problemlösungskompetenz und fachliche Expertise um den Bereich oder Prozess, in dem das Problem auftritt.
Selbst die besten Leute können Probleme aber auch nicht schnell lösen, wenn ihnen die Mittel und die Zeit dafür fehlen. Die Dringlichkeiten des Tagesgeschäfts erfordern oft, dass Dein Team auch für andere Aufgaben verfügbar bleiben muss.
Abb. 3: Optimaler Arbeitspunkt: tägliche Arbeitsdauer versus Gesamtprojektdauer.
Die Projektdauer steigt jedoch überproportional an, je weniger Zeit pro Tag auf die Verbesserungsarbeit verwendet werden kann. Idealerweise wird eine Problemlösung gut vorbereitet und dann innerhalb von 1-3 Tagen Vollzeiteinsatz bearbeitet. Sorge dafür, dass der Arbeitspunkt Deines Projekts diesen Effekt nutzt. Entweder liegt danach eine Lösung vor oder aber ein gut aufbereitetes Problem kann gezielt an Experten übergeben werden.
Probleme sind Potenziale, die darauf warten gehoben zu werden
In den Ohren mancher Leute ist das Wort „Problem“ negativ behaftet. Wer hört schon gerne von „Problemen“? Bekannt ist auch das geflügelte Wort: „Komme mir nicht mit Problemen. Ich brauche Lösungen!“ Wenn sich Deine Umgebung an den Begriffen „Problem“ oder „Rapid Problem Solving“ stört, dann kannst Du stattdessen von „Potenzialen“ oder von „Chancen“ sprechen. Ob das Glas halb voll, halb leer oder doppelt so groß wie notwendig ist, es läuft immer auf dasselbe hinaus, denn Problem und Potenzial sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir verbinden deshalb mit dem Wort „Problem“ nichts Negatives – und stehen zu dem Titel unseres Buches. Dazu zwei Zitate:
Erfinderische Menschen erkennen Probleme, wo andere sich mit dem Alltag abgefunden haben.
Probleme als solche wahrzunehmen, ist also zunächst ein wichtiger kreativer Akt der Erkenntnis! Frage Dich einmal: Was in Deinem (Arbeits)alltag hast Du bisher als unausweichlich hingenommen?
Sobald wir ein Problem formulieren können, sind wir auch in der Lage, es zu lösen.
Unternehmen, die heute Milliarden umsetzen, sind irgendwann einmal auf der Grundlage von Alltagserkenntnissen gegründet worden. Am Anfang steht oft die Unzufriedenheit mit dem Status Quo und ein Gefühl der Dringlichkeit: „Es darf doch einfach nicht wahr sein, dass…“. Offensichtlich gilt folgende Einsicht:
Probleme stellen Chancen dar, die darauf warten, erkannt und genutzt zu werden.
Dieses Buch möchte Dir helfen, Probleme zu erkennen und so zu formulieren, dass Chancen daraus werden, die Du schnell angehen kannst. So erzeugst Du Wahlmöglichkeiten, welche Probleme Du zuerst angegangen möchtest.
Kläre Deine eigene Einstellung zu dem Problem
Wenn Du Dich mit Chancen, Potenzialen und Problemlösung beschäftigst oder mit Menschen zusammenarbeitest, die sich selbst dieser Mission verschrieben haben, dann wirst Du bestätigen:
80 Prozent sind eine Frage der eigenen Haltung und Einstellung. 20 Prozent sind eine Frage der Technik, Methode und Herangehensweise.
Bevor Du ein Problem angehst, solltest Du Dich deshalb nach Deiner eigenen Haltung und Einstellung fragen: „Brennst“ Du dafür, genau dieses Problem zu lösen?
So wie jeder auch mal putzen, spülen und den Rasen mähen muss, so musst Du sicher auch manchmal ein unerfreuliches Problem lösen. Nehmen wir an, die Grunddaten in der Logistik wären voller Fehler, das Dokumentenmanagement „ein reines Chaos“ oder der Wareneingang „funktioniert einfach nicht“. Irgendwer muss sich darum kümmern - und jetzt Du. Manchmal stehst Du vor einer Aufgabe, die Dich „nicht vom Sockel reißt“ – aber kannst oder darfst Du nicht kneifen.
Deine Einstellung ist trotzdem entscheidend. Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als Dich selbst zu motivieren. In der Regel ist das nicht besonders schwer, denn kleine Probleme ziehen oft einen wahren Rattenschwanz von Folgeproblemen nach sich. Und es sind gerade die vielen kleinen, zermürbenden Probleme, die Menschen ihre an sich schöne Arbeit vermiesen können. Wenn Du nicht sicher bist, warum Du Dich um ein gegebenes Problem auch kümmern willst, dann kannst Du folgendes tun:
Erfasse den Problemumfang (s.S.
→
) brennst Du vielleicht für die übergeordnete Aufgabe?
Sprich mit den Menschen, die das Problem haben: empfindest Du Empathie für sie?
Was ist Dein Nutzen, wenn Du das Problem löst und wenn Du diese Arbeit richtig gut erledigst?
Du kannst viele gute Gründe haben, warum Du ein Problem lösen möchtest. Mach Dir diese Gründe bewusst, denn das wird Dir helfen, auch andere für die Problemlösung zu gewinnen.
Ursachen und Wirkungen von Problemen gehen häufig auch über den Bereich hinaus, in dem Du sie zunächst vermutest: Plötzlich musst Du auf Menschen aus anderen Bereichen zugehen und willst ihnen nicht „auf die Füße treten“; Du musst nötige Mittel vor einem Gremium beantragen und später an gleicher Stelle Deine Ergebnisse vorstellen. Rapid Problem Solving ist nicht „bequem“. Deshalb unser Tipp:
Gehe bewusst den Rand Deiner Komfortzone. Denn so wird sie jedes Mal größer.
Abb. 4: Die Komfortzone als Balance zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten.
Dieser Sachverhalt ist in Abb. 4 frei nach Mihály Csíkszentmihályi dargestellt („Flow im Beruf - Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz“): Probleme lösen heißt „Abenteuer erleben“ und den Rand der Komfortzone zu betreten. Je mehr Erfahrungen Du gesammelt hast, desto leichter fällt es Dir, Dich neuen und größeren Herausforderungen zu stellen. So kannst Du Deine Komfortzone im Laufe der Zeit immer weiter ausdehnen und wachsen.
Findet Eure Grundregeln für die Zusammenarbeit im Team
Viele Probleme kannst Du völlig allein lösen. Du brauchst kein Team. Du setzt Dich einfach hin und machst es. Wenn das möglich ist, dann solltest Du das auch tun. Für schwierige Themen brauchst Du allerdings ein Team: vielleicht brauchst Du Kompetenzen, die Du und auch sonst niemand mitbringt; oder Du brauchst einfach nur mehr Hände, die mit anfassen. Lösungen müssen vor allem auch für die Menschen im Prozess passend sein und ihre Bedürfnisse abbilden – allein schon deshalb musst Du sie mit einbinden. Auch in vor- und nachgelagerten Prozessen arbeiten Menschen mit ihren eigenen Erwartungen. Auch wenn sie nicht Teil Deines Teams sind – aber irgendwer muss auch mit ihnen sprechen und sicherstellen, dass sie bei den Veränderungen mitgehen, die Ihr vorschlagt und umsetzt. Für viele Probleme brauchst Du also ein Team.
Es gibt wichtige Grundregeln, um im Team Probleme zu lösen – und jedes Team braucht seine eigenen, um möglichst gut zu funktionieren. Hier ist eine Liste, mit der Du starten kannst, um gemeinsam mit Deinem Team Eure Grundregel zu erarbeiten:
Jede Idee ist willkommen.
Erledigt ist besser als perfekt.
Es gibt keine dummen Fragen.
Wir handeln unternehmerisch.
Gute Arbeit ist und bleibt unersetzlich.
Gut ist nur, was auch auf Dauer gut ist.
Veränderung ist der Freund des Menschen.
Wir haben Respekt vor bestehenden Prozessen.
Sei in der Sache ehrgeizig – aber persönlich bescheiden.
Kläre die Rollenverteilung in dem Problemlösungsteam.
Der Mensch ist das Maß aller Dinge.
Als Problemlösungsteam legt Ihr auch nicht einfach los: Ihr müsst Euch zunächst finden, aufeinander einstellen, vielleicht knirscht es auch mal – dann passt Ihr die Regeln Eures Zusammenarbeitens an – und so funktioniert Ihr letztlich als Team.
Der amerikanische Psychologe, Organisationsberater und Hochschullehrer Bruce Tuckman (1938-2016) hat dafür ein Phasenmodell der Teamentwicklung erstellt, das wir auch Dir ans Herz legen möchten:
Phase
Worum es geht
Forming
(zusammen kommen)
Du bringst das Team zusammen. Ihr teilt den Wunsch nach Veränderung und freut Euch auf die gemeinsame Arbeit.
Storming
(Konflikte konstruktiv lösen)
Du nutzt kleine Konflikte („Ich will auch mal was sagen!“, „Dafür hab‘ ich keine Zeit“, …), um Eure Zusammenarbeit als Team zu überdenken.
Norming
(Regeln der Zusammenarbeit festlegen)
Ihr findet neue Regeln (wann Ihr Euch trefft, wer was tut, wie ihr zusammen arbeitet, …), um möglichst gute Arbeit leisten zu können
Performing
(volle Leistung erbringen)
Ihr nutzt Euer nun gut funktionierendes Team, um das Problem möglichst gut und schnell zu lösen und um breite Akzeptanz Eurer Lösung zu erzeugen.
Adjourning
(für die Zukunft lernen)
Ihr gebt den Schwung weiter und lernt für Eure weitere Zusammenarbeit in diesem oder in anderen Teams.
Tabelle 1: Fünf Phasen der Teamentwicklung
Nutze dieses Modell, um Dein Team möglichst gut zu führen. Sei nicht überrascht, wenn nicht gleich zu Beginn die volle Leistung abrufbar ist, denn dafür müsst Ihr wichtige vorgelagerte Phasen durchlaufen.
Problemlösung ist auch eine Frage des „Stils“
Die Lösung von Problemen liegt in der Regel nicht auf der Hand – deshalb setzt Du auch die Methoden dieses Buches ein. Für die Lösung von Probleme ist also Kreativität gefragt und interessanterweise gehen Menschen auf ihre eigene Art an die Sache ran: Problemlösung ist eine Frage des „Stils“.
Leider wird Kreativität viel zu oft gleichgesetzt mit der Fähigkeit „out of the box“ zu denken, also das Problem von außen zu betrachten. Das ist tatsächlich eine mögliche Herangehensweise. Wer aber sagt, dass man die Lösung nicht finden könnte, wenn man genauestens in die „Box“ hineinschaut? Dieser Gedanke ist keineswegs trivial und im Dezember 2007 haben Coyne, Clifford und Dye einen Artikel in dem renommierten Magazin Harvard Business Review dazu geschrieben: „Breakthrough Thinking from inside the Box“.
Seit den 1979er Jahren hat der renommierte Experte für kognitive Psychologie, Dr. Michael Kirton, sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen kreativ sind – also nicht, wie kreativ jemand ist, sondern auf welche Weise. Dabei hat er festgestellt, dass wir alle unseren eigenen kreativen Stil haben, der entweder mehr „adaptiv“ oder mehr „innovativ“ sein kann.
Abb. 5: Häufigkeitsverteilung des menschlichen Stils der Problemlösung.
Es gibt wenige Menschen mit einem stark ausgeprägten adaptiven Stil der Problemlösung. Ein Paradebeispiel ist Thomas Edison (1847-1931). Er hat einmal – in pointierter Bescheidenheit – von sich selbst gesagt, er habe nichts erfunden, sondern einfach nur dort weitergemacht, wo andere aufgegeben haben. Es ging ihm darum, bestehende Dinge und Ideen aufzugreifen und zu verbessern. Edison war nicht der Einzige, der an der Idee einer Glühbirne gearbeitet hat. Eine Unzahl von systematisch aufgesetzten Experimenten hat ihn schließlich zum Erfolg gebracht.
Andere Menschen haben einen stark ausgeprägten innovativen Stil der Problemlösung. Ein Paradebeispiel ist Nikola Tesla (1856-1943). Wenn andere über Gleichstrom sprachen, dann fragte Tesla: warum nicht Wechselstrom? Für ihn waren außerhalb ungleich mehr Möglichkeiten als innerhalb eines bestehenden Systems: lass andere bestehende Dinge besser machen – ich mache bessere Dinge. Kein Wunder, dass Edison und Tesla nicht zusammenarbeiten konnten.
Wie die obige Abbildung zeigt, liegt der kreative Stil der meisten Menschen irgendwo in der Mitte. Die Frage ist nun: wen brauchst Du in Deinem Problemlösungsteam? Edison? Tesla? Oder die Leute in der Mitte? Da Du nicht weißt, wo die Lösung liegt, im System?, außerhalb des Systems?, brauchst Du Vielfalt in Deinem Team: Leute mit einem adaptiven Stil, andere mit einem innovativen Stil und Leute „aus der Mitte“.
Der erste Schritt besteht zweifellos darin, dass Du Dir über Deinen eigenen Stil bewusst wirst: geht es Dir eher um wenige gut durchdachte Ideen – oder produzierst Du lieber viele Ideen und sortierst die schlechten später aus? Versuchst Du ein bestehendes System genau zu verstehen, bevor Du es veränderst – oder suchst Du eher nach einem neuen und besseren System? Und wie wichtig ist es Dir, dass im Team Harmonie herrscht und eine geordnete Vorgehensweise verwendet wird – oder blühst Du erst richtig auf, wenn „die Fetzen fliegen“? Du musst Dir Deines eigenen Stils bewusst sein, um den von anderen Menschen erkennen und wertschätzen zu können. So könnt Ihr als kreativ vielseitiges Team Eure Vielfalt nicht nur aushalten sondern zu einer wertvollen Stärke machen.
Berücksichtige die „drei Geheimnisse“ erfolgreicher Problemlösung
Zum schnellen Lösen von Problemen musst Du wichtige Kompetenzen mitbringen und entwickeln. Es geht um drei wesentliche Bereiche und in allen dreien kannst Du ein Leben lang lernen:
1) Entwickele Kompetenzbereiche für die Problemlösung: Daten, Prozesse, Menschen.
Unsere Welt ist zunehmend charakterisiert von Daten. Du kommst nicht umhin, Dir im Umgang mit Daten ein gewisses Handwerkszeug anzueignen. Wie Du sehen wirst, brauchst Du nur eine Handvoll Werkzeuge, um loslegen zu können. Diese Werkzeuge solltest Du jedoch einzusetzen wissen, denn allein dadurch kannst Du oft schon einen erheblichen Mehrwert schaffen und Dir vielleicht sogar ein gewisses Alleinstellungsmerkmal erarbeiten.
Moderne Unternehmen und Lieferketten sind vor allem gekennzeichnet von Prozessen. Oft sind diese historisch gewachsen und kompliziert geworden:
Immer wieder wirst Du in einem Büro stehen und Dich fühlen wie in einem Bienenstock.
Um Dich herum summt es emsig: Wer ruft wen wofür an? Wohin gehen all die Emails?
Warum geht dieser Mitarbeiter zum Drucker? Was passiert in jener Besprechung?
Du kannst viel Nutzen stiften, wenn Du hinter Tätigkeiten Prozesse erkennen und diese transparent machen kannst.
Und dann sind vor allem überall Menschen. Je nach Deiner eigenen Persönlichkeit magst Du das am spannendsten, nervigsten, einfachsten oder schwierigsten finden. Menschen gehören nicht nur einfach mit dazu. Sie sind das Herzstück der Problemlösungsarbeit. Es handelt sich hier um das zweite Geheimnis:
2) Probleme lösen heißt, Menschen bei ihrer Arbeit letztlich glücklicher zu machen.
So überraschend das klingen mag: als Rapid Problem Solver bist Du in der „Happiness-Industrie“. Menschen wollen etwas Bleibendes schaffen. Sie möchten gestalten. Wenn sie schon einmal einen Großteil ihrer Zeit bei der Arbeit verbringen, dann möchten sie, dass diese Arbeit vor allem interessant und flüssig ist – und nicht etwa eintönig, nervig und langweilig. Als Problemlöser wirst Du es immer wieder erleben: Menschen sind kreativ, wenn sie ihr Umfeld gestalten können und dankbar, wenn sie es dürfen.
Was Menschen angeht sind Problemlöser deshalb Optimisten: Wir sind überzeugt davon, dass Menschen Dinge verbessern wollen und können. Nicht zuletzt dadurch, dass wir diese Überzeugung ausstrahlen und mit anderen teilen, stellt sich Erfolg ein.
Jeder ist frustriert, mit einem platten Reifen Fahrrad fahren zu müssen. Was für ein Glücksgefühl, wenn der Reifen wieder geflickt ist! Diesen Effekt kannst Du auch bei Deiner Problemlösung erzielen.
Dafür musst Du Menschen verstehen, mit ihnen umgehen und Dich auf sie einlassen können. Du musst aber auch die Prozesse verstehen, in denen diese Menschen arbeiten. Und häufig musst Du dafür auch Daten verstehen, denn viele Probleme kannst Du anders gar nicht verstehen und erfassen. Deshalb kommst Du nicht umhin, Dir für die Arbeit mit Prozessen, Daten und Menschen das nötige Handwerkszeug anzueignen. Wenn Du das als spannende Herausforderung betrachtest, dann bist Du hier genau richtig. Wichtig ist schließlich auch das dritte Geheimnis:
3) Zerlege ein großes in mehrere kleine Probleme. Löse diese Schritt für Schritt.
Du musst lernen „groß zu denken und klein zu handeln“. Wenn Du einen bestimmten Bereich „einmal so richtig aufräumen“ möchtest, dann ist das nicht mit einer Hauruck-Aktion getan. Du bist erfolgreicher, wenn Du die große Problemlösung in viele kleine Etappensiege teilst und so ständige Veränderung und Verbesserung erzeugst. Wenn Du diese drei Geheimnisse beherzigst, dann wirst Du schnell und erfolgreich sein beim Lösen von Problemen. Dieses Buch möchte Dir dafür das nötige „Gewusst Wie“ mit auf den Weg geben.
Vertraue dem Fahrplan des Rapid Problem Solvings
Du magst Dir wünschen, die Lösung zu kennen, wenn man Dir ein Problem überträgt. Das wird aber nicht immer der Fall sein. Vielleicht verunsichert Dich das zunächst, natürlich kannst Du nicht sagen, ob sich das Problem tatsächlich schnell lösen lässt, wenn Du seine Lösung nicht kennst. Das solltest Du auch mit der Auftraggeberin so besprechen, denn:
Die Lösung kannst Du erkennen, wenn Du das Problem und seine Ursache verstanden hast.
Du wirst vermutlich immer wieder mit Aussagen konfrontiert werden wie: „Es ist doch ohnehin allen klar, was hier das Problem ist. Wir müssen deshalb…“ Wenn aber schon das Problem wichtig genug ist, dass man Dich zurate zieht, dann solltest Du zunächst das Problem selbst und seine Ursache klären.





























