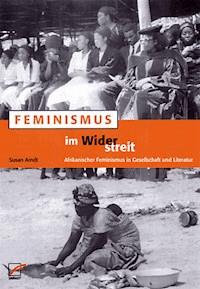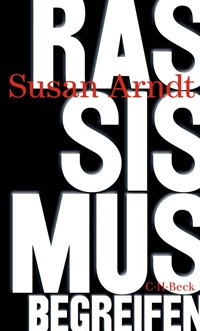
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rassismus ist eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Er wirkt bis in kleinste Zusammenhänge globaler und lokaler Strukturen hinein – und zwar als Ergebnis seiner viel zu langen Geschichte. In ihrem aufrüttelnden Buch analysiert und problematisiert Susan Arndt diese Machtstrukturen von ihren Anfängen bis in unsere Gegenwart und zeigt, wie wir über Rassismus reden können, ohne ihn zu reproduzieren. Anti-Rassismus erfordert aktives Handeln und entsprechende Kompetenzen. Dafür braucht es Wissen und Argumente. Dieses Buch liefert sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Susan Arndt
RASSISMUS BEGREIFEN
Vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen
C.H.Beck
ZUM BUCH
Tagtäglich erleben Menschen in Deutschland und dem Rest der Welt Rassismus in Form von Alltagsdiskriminierungen, werden Opfer von politischem und strukturell-institutionellem Rassismus sowie von rassistischen Gewalttaten. Als der Polizist Derek Chauvin dem Schwarzen US-Amerikaner George Floyd die Luft zum Atmen nahm, brandete eine antirassistische Protestwelle um die Welt, die auch Deutschland bewegte. Wie virulent Rassismus auch hierzulande ist, zeigen etwa Debatten über Umbenennungen von Straßen oder auch den Umgang mit rassistischer Sprache, Kolonialgeschichte und rassistischen Morden. Susan Arndt führt in Geschichte und Gegenwart des Rassismus ein und zeigt, wie er sich bekämpfen lässt.
ÜBER DIE AUTORIN
Susan Arndt ist Professorin für Englische Literaturwissenschaft und Anglophone Literaturen an der Universität Bayreuth. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Rassismus, Sexismus und Intersektionalität. Bei C.H.Beck sind von ihr erschienen: Die 101 wichtigsten Fragen: Rassismus (42021) sowie Sexismus. Geschichte einer Unterdrückung (2020).
INHALT
Einleitende Bemerkungen: Black Lives Matter in Zeiten der COVID-19-Krise
I. RASSISMUS: GRUNDLAGEN, KONZEPTIONELLE VERIRRUNGEN UND STRÖMUNGEN
1. Othering und Privilegien im Kontext sozialer Ungleichheit
2. Rassismus als Erfindung und Othering mittels ‹Rassen›
3. Rassismus. Überlegungen zur Begriffsbestimmung
4. Der Racial Turn oder soziale Positionen im Rassismus
4.1. Weißsein als soziale Position infolge rassistischer Macht und Privilegierung
4.2. Soziale Positionen infolge rassistischer Diskriminierung: Schwarz, People of Color, Indigene, Jüdisch und Passing
5. Warum die Begriffe ‹Ausländer-› oder ‹Fremdenfeindlichkeit› sowie ‹positiver Rassismus› unzutreffend sind
6. Gibt es nicht: ‹Umgekehrter Rassismus› und ‹Außereuropäischer Rassismus›
7. Rassismus unter rassistisch Diskriminierten: ‹Teile und herrsche› und Colorismus
8. Verinnerlichter Rassismus
9. Strömungen des Rassismus
9.1. Antijudaismus, Antisemitismus und Antizionismus
9.2. Rassismus gegenüber Schwarzen
9.3. Orientalistischer Rassismus
9.4. Ziganistischer Rassismus
9.5. Rassismus gegenüber Indigenen Menschen
10. ‹Rassismus ohne Rassen› als Irrtum
II. GESCHICHTE DES RASSISMUS ALS GESCHICHTE DER ERFINDUNG VON ‹RASSEN›
1. Griechische Konstruktionen vom Selbst und Anderen
1.1. Das Erwachen des Griechischseins
1.2. Das nichtgriechische Andere
1.3. Argumentationsmuster der Differenz
1.4. Theorie zur Sklaverei von Aristoteles
1.5. Noahs Fluch über Ham – eine antike Erfindung mit rassistischer Strahlkraft
2. Die Erweckung des Weißseins
2.1. Wie die christliche Farbsymbolik ‹Hautfarbe› erzählt und Räume kartiert: Die Geburt der Schwarz-Weiß-Antithese
2.2. ‹Hautfarbe› und Religion in Eschenbachs Parzival
2.3. 1492 als Zäsur verschränkter Rassismen
1492 und das Ende des multireligiösen al-Andalus
1492 und Anfänge von Kolonialismus und Maafa
Kolumbus’ genozidale Gewalt im Kontext zeitgenössischer Dispute und Gesetze
Eroberung, nicht ‹Entdeckung› und andere Begriffsirrläufer
Maafa: Mit neuen Begriffen über die europäische Versklavung von Afrikaner*innen sprechen
3. Maafa und das kolonial geprägte Weißsein
3.1. Maafa als singuläres Modell der Versklavung
3.2. Ein kurzer historischer Abriss der europäischen Versklavung von Afrikaner*innen im 15. bis 18. Jahrhundert
1441 und andere Anfänge
Grundlagen der Plantagenökonomie bis 1680
Das lange 18. Jahrhundert der Maafa
3.3. ‹Jenseits vollwertiger Menschlichkeit›: Rechtlosigkeit und deren Legitimation
Christliches Gebot: Versklavende, nicht Versklavte
Natur-versus-Kultur-Binarismus: Dämonisierung und Exotisierung
Frühneuzeitliche Auslegungen der ‹Weiß-Schwarz-Antithese›
Frühneuzeitliche Erklärungsmuster für ‹Hautfarben›
4. ‹Rassen›theorien in der Aufklärung
4.1. Rassismus in Philosophie und Naturwissenschaft
Säkularisierung von ‹Rasse›: Monogenese und Licht als Vernunft
Vernaturwissenschaftlichung: Über Klimatheorien und ‹Hautfarben› hinaus
4.2. Versklavte, die Sklaverei als Befreiung erleben? Daniel Defoes Welt von Robinson Crusoe
4.3. Erste Gedanken zum Begriff ‹Rasse› in Deutschland: Kant vs. Amo
4.4. Anfang vom Ende: Abolitionismus und die Revolution in Haiti
Abolitionismus: von einer Schwarzen zu einer weiß dominierten Bewegung
Globaler Abolitionismus: Vom Londoner Gerichtshof nach Haiti
4.5. Jim-Crow-Gesetzgebung
4.6. Hegel: Trotz allem, die europäische Versklavung von Afrikaner*innen ist gerecht
4.7. Von ‹Volk›, ‹Kultur› und ‹Völkerschauen›
5. Rassismus zwischen Imperialismus und Nationalismus
5.1. Imperialismus als globale Weltwirtschaft und rassistisches Gewaltregime
Globaler Imperialismus als europäische Einigung
Deutschlands Kolonialismus als globale Macht
5.2. Imperialismus legitimieren
‹Zivilisation› als «Bürde des weißen Mannes» im neuen Gewand der Moderne
Kolonialfantasien in der Literatur: Rudyard Kipling, Joseph Conrad und Edgar Rice Burroughs
Rassismus als Kampf der ‹weißen Rassen› gegen alle Anderen: Rassentheorien von Arthur de Gobineau über Houston Stewart Chamberlain bis Eugen Fischer
‹Höhere Rassen› müssten sich der niederen erwehren: Arthur de Gobineau
Von Charles Darwin über den Sozialdarwinismus zur beginnenden Eugenik
5.3. Weißsein im ‹Kampf der Klassen›
Sozialdarwinismus und die Rede vom ‹white trash›
Klassenkampf und weiße Handlungsmacht
Weißsein als soziale Aufstiegsmöglichkeit
5.4. Nationen und innere Feinde des Deutschen Reiches: Jüdische Menschen und Rom*nja
5.5. Arier als ‹reine Krone› des Weißseins. Chamberlains Vorstellungen von Zukunft
5.6. Fischer und die Eugenik als ideologische Brücke zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus
5.7. Rassismus in der Weimarer Republik
5.8. Britische Apartheid in Südafrika
6. Nationalsozialismus
6.1. Nationalsozialistische Gesetzgebungen
6.2. Die nationalsozialistische Novelle der ‹Rassen›theorien
6.3. «Lebensraum im Osten»
6.4. Die technologische und bürokratische Infrastruktur des eliminatorischen Rassismus: Shoah und Porajmos
6.5. Rassismus gegenüber Schwarzen und Orientalistischer Rassismus
6.6. Der japanische Weg innerhalb der europäischen ‹Rassen›theorien
6.7. Rassismus in den Reihen der Alliierten
6.8. Nationalsozialismus zwischen Singularität und Kontinuität
6.9. Die UNESCO-Erklärung von 1950
6.10. Juristischer Umgang mit dem NS
6.11. Kolonialismus und NS als Januskopf der Gründung Israels
7. Rassismus inmitten von globaler (Post-)Dekolonisierung und Kaltem Krieg
7.1. Der Umgang mit ‹Rasse› im geteilten Deutschland
7.2. Dekoloniale Bewegungen
7.3. Burische Apartheid in Südafrika
7.4. Diasporas
Diaspora meint ‹Angekommen›
US-amerikanische Bürger*innenrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre
Europäische Diasporas
Vereinigtes Königreich
Deutschland
III. ZEITGENÖSSISCHE MANIFESTATIONEN DES RASSISMUS SEIT 1990: DEUTSCHLAND IM GLOBALEN KONTEXT
1. Politik: Erinnerung, Entschuldigung, Entschädigung
1.1. Deutschland und NS: Shoah und Porajmos
1.2. Die Mbembe-Debatte
1.3. Kolonialismusaufarbeitung in Europa
1.4. Entschuldigung und Entschädigungszahlungen
1.5. Entwicklungshilfe und der Unterlegenheitsmythos
2. Rassismus und gesellschaftliche Debatten
2.1. ‹Leitkultur› und ‹Multikulturelle Gesellschaft›
2.2. ‹Flüchtlingskrise›, ‹Illegale› und der Windrush-Skandal
3. Rassistische Parteien
4. Rassistische physische Gewalt als serielles Verbrechen
5. Institutioneller Rassismus: Polizei und Racial Profiling
6. Immer wieder Alltag(srassismus)
6.1. Repräsentation zwischen Ignorieren und rassistisch-falschem Othering
Weiße Hyperpräsenz als sichtbare Absenz von BIPoC
Rassistische Repräsentationsmuster und entsprechende Stereotype
Rassistische MisRepräsentationen in Film und Werbung
6.2. Mikroaggressionen
6.3. Stereotype Threat
7. «Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.» Wörter und rassistisches Wissen
7.1. Widerspruch: Rassistische Wörter (verteidigen)
7.2. Rassistische Wörter(bücher)
8. ‹Rasse› und ‹Hautfarbe›: Alter Rassismuswein in neuen Worthülsen
9. Aktuelle Gesetzgebung
Ein Fazit: Zum Schluss kommen, wenn auch kein Ende in Sicht ist
Liste rassistischer und sexistischer Begriffe
Danksagung
Literaturverzeichnis
Filme/YouTube/Theater
Anmerkungen
Einleitende Bemerkungen: Black Lives Matter in Zeiten der COVID-19-Krise
I. RASSISMUS: GRUNDLAGEN, KONZEPTIONELLE VERIRRUNGEN UND STRÖMUNGEN
2. Rassismus als Erfindung und Othering mittels ‹Rassen›
3. Rassismus. Überlegungen zur Begriffsbestimmung
4. Der Racial Turn oder soziale Positionen im Rassismus
6. Gibt es nicht: ‹Umgekehrter Rassismus› und ‹Außereuropäischer Rassismus›
7. Rassismus unter rassistisch Diskriminierten: ‹Teile und herrsche› und Colorismus
8. Verinnerlichter Rassismus
9. Strömungen des Rassismus
10. ‹Rassismus ohne Rassen› als Irrtum
II. GESCHICHTE DES RASSISMUS ALS GESCHICHTE DER ERFINDUNG VON ‹RASSEN›
1. Griechische Konstruktionen vom Selbst und Anderen
2. Die Erweckung des Weißseins
3. Maafa und das kolonial geprägte Weißsein
4. ‹Rassen›theorien in der Aufklärung
5. Rassismus zwischen Imperialismus und Nationalismus
6. Nationalsozialismus
7. Rassismus inmitten von globaler (Post-)Dekolonisierung und Kaltem Krieg
III. ZEITGENÖSSISCHE MANIFESTATIONEN DES RASSISMUS SEIT 1990: DEUTSCHLAND IM GLOBALEN KONTEXT
1. Politik: Erinnerung, Entschuldigung, Entschädigung
2. Rassismus und gesellschaftliche Debatten
3. Rassistische Parteien
4. Rassistische physische Gewalt als serielles Verbrechen
5. Institutioneller Rassismus: Polizei und Racial Profiling
6. Immer wieder Alltag(srassismus)
7. «Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.» Wörter und rassistisches Wissen
8. ‹Rasse› und ‹Hautfarbe›: Alter Rassismuswein in neuen Worthülsen
9. Aktuelle Gesetzgebung
Personenregister
Für Peggy Piesche, die immer sagt: «Pick your battles», und das, obwohl sie die genialste aktivistisch-intellektuelle Kämpferin ist, die mir je begegnete – und keinen Kampf für eine gerechtere Welt ohne Diskriminierung je auslassen würde.
Einleitende Bemerkungen: Black Lives Matter in Zeiten der COVID-19-Krise
Als der weiße Polizist Derek Chauvin am 25. Mai 2020 dem Schwarzen US-Amerikaner George Floyd die Luft abdrückte, hielt das die Welt in Atem. Nicht etwa, weil weiße Polizeigewalt gegenüber Schwarzen selten wäre: Zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 30. Juli 2020 starben allein in den USA rund 6000 Menschen durch Polizeigewalt, darunter über 1430 Schwarze, was 34 pro eine Million Einwohner entspricht, im Vergleich etwa zu 14 pro eine Million bei Weißen.[1] Eric Garner (2014), Michael Brown (2014) Michelle Cusseaux (2015), Breonna Taylor (2020) und George Floyd (2020) sind fünf von viel zu vielen. Die USA befinden sich noch immer inmitten eines Kampfes, von dem bereits Martin Luther Kings Jr. berühmte Rede I have a dream, gehalten am 28. August 1963 in Washington, D.C., spricht: der fehlenden Gleichheit von Schwarzen, wie sie sich etwa in der rassistischen Behandlung durch die Polizei äußert oder im Gesundheitswesen. Der Mord an George Floyd geschah aber nicht nur vor laufender Kamera. Er ereignete sich zudem inmitten der COVID-19-Krise, die soziale Ungleichheit wie unter einem Brennglas deutlich werden lässt. Denn auch wenn SARS-CoV-2-Viren nicht nach Alter, Herkunft, Pass, Geschlecht und der Position im Rassismus fragen, machen die Antworten auf die Pandemie genau das – Menschen in prekärer Beschäftigungssituation und mit geringem Einkommen können sich weder einen Shutdown noch Social Distancing finanziell leisten. Zugleich haben viele von ihnen keine Krankenversicherung, wodurch ihnen der Zugang zu medizinischen Behandlungen oder dem globalen Impfwettbewerb erschwert wird. Folglich sind es (neben Menschen mit Vorerkrankungen und älteren Menschen) vor allem einkommensschwache Personen, die schwere Verläufe erleben oder an COVID-19 sterben – und das wiederum sind, in den USA und darüber hinaus, wie der globale Vergleich zeigt, vornehmlich BIPoC (Akronym für Black, Indigenous and People of Color). Im Kontext dieser Erfahrungen wurde der gewaltsame Tod Floyds zum sprichwörtlichen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und eine Welle der Empörung auslöste. Im Rahmen der 2013 gegründeten Bewegung Black Lives Matter (BLM) ging sie um die Welt und sorgt auch in Deutschland bis heute für seismografische Ausschläge.
Tausende gingen hierzulande auf die Straße, und erstmalig wich die übliche Rede von Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit etwas nachhaltiger dem ‹Mut›, Rassismus beim Namen zu nennen. Und obwohl nur drei Monate zuvor in Hanau rassistischer Terror gewütet hatte und es in auch in Deutschland Fälle von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen gibt, wunderten sich viele, was die Ermordung Floyds mit Deutschland zu tun habe – und warum es denn extra betont werden müsse, dass Schwarze Leben zählen. Würden denn nicht alle Leben zählen? Sowieso? Richtig, in dezidiert rassistisch organisierten Systemen wie etwa bei der europäischen Versklavung von Afrikaner*innen oder dem Nationalsozialismus (NS) war das nicht der Fall. Auch in der Jim-Crow-Ära oder der südafrikanischen Apartheid-Diktatur wurden Leben unterschiedlich bewertet und betrauert. Aber abgesehen davon? Die Antwort ist ebenso offensichtlich wie unerträglich: Rassismus ist ein globales Phänomen, das in alle Bereiche des Zusammenlebens eindringt. Und immer da, wo Rassismus waltet, tut er das mit dem (wenn auch nicht immer entsprechend de jure oder anderweitig verbalisierten) Ziel, Menschen aus dem (gleichberechtigten) Menschsein auszugrenzen. Je ‹weniger Mensch› aber, desto weniger menschenrechtswert. Nur wer dieses Credo des Rassismus verinnerlicht hat, kann über neun Minuten und 29 Sekunden lang einem Menschen das Atmen verwehren, der mehr als 20 Mal verzweifelt sagt: «I can’t breathe.» Diese letzten Worte Floyds sind schnell zur Metapher dafür geworden, dass Rassismus BIPoC von jeher systemisch daran hindert, sich in ihrem eigenen Leben sicher zu fühlen. BIPoC, also Schwarze, Indigene und People of Color (will sagen: alle, die vom Rassismus als außerhalb des Weißseins positioniert und deswegen diskriminiert werden) müssen sich tagtäglich Problemen stellen, die ihnen der Rassismus in ihr Leben implantiert. Das gilt in den USA ebenso wie in Deutschland.
Auch in Deutschland redet Rassismus mehr als ein Wörtchen dabei mit, wie Menschen leben. Der NS oder die NSU-Mordserie sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Doch wird nur diese betrachtet, bleibt das eigentliche Problem unbeleuchtet, und es lässt sich (guten Gewissens) erklären, dass mensch selbst so weder handeln noch denken würde. Mensch gibt sich einfach offen und liberal, reflektiert und solidarisch, kurzum: antirassistisch gut(willig) – und gut ist’s. Aber weil nur die Spitze des Eisbergs betrachtet und die eigentliche Größe des Problems entsprechend unterschätzt wird, bleibt der Rassismus intakt, und Gesellschaften samt vieler Menschen zerbrechen an ihm.
Zugleich bewirkt die Reduzierung von Rassismus auf diese gewaltvollen Spitzen, dass viele Weiße in Panik geraten, wenn etwas «rassistisch» genannt wird. Weil Rassismus so ungeheuerlich ist und so Ungeheuerliches getan hat, scheuen sich viele, vor allem weiße Personen, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Das macht Rassismus zum R-Wort (einem unverzeihlichen und oft unausgesprochenen Wort). Diese weiße Lebenswelt nennt die Antirassismustrainerin Tupoka Ogette «Happyland»: Hier wissen alle, «dass Rassismus etwas Schlechtes ist» – und schweigen gerade deswegen darüber. «Happyland ist eine Welt, in der Rassismus das Vergehen der anderen ist» – jener, die «mit Vorsatz» handeln. Folglich machen sich viele Weiße «vielmehr Sorgen darüber, rassistisch genannt zu werden, als sich tatsächlich mit Rassismus und dessen Wirkungsweisen zu beschäftigen».[2] Vielen fällt es leichter, Rassismus wegzuerklären, als ihn anzuschauen. Beschweigen und Verleugnen sind aber längst nicht die einzigen Bestandteile des Grenzschutzzauns von «Happyland». Dieser baut auch auf Frustration, Empörung oder Wut und darauf, Scham- und Schuldgefühle auf andere zu projizieren. Stichwort: Blaming the victim. Die Empörung richtet sich dabei nicht gegen den Gegenstand des Vorwurfs, sondern den Vorwurf selbst bzw. jene Person, die ihn erhebt – und wehrt diesen dabei ohne inhaltliche Bezugnahme ab. Nehmen wir nur die seit Sommer 2020 erneut entfachten Debatten um das M-Wort. Viele denken, wer es als rassistisch ansehe, dass es in Namen von Lebensmitteln oder Apotheken und Straßen vorkomme, sei uninformiert, hypersensibel und in jedem Fall zu politisch korrekt. Andere wollen über dieses Problem oder auch Rassismus im Allgemeinen sprechen, wissen aber teilweise nicht, wie. Ebendieser Wunsch, begreifen zu wollen, öffnet den Grenzzaun und damit den Weg zu Kompetenzen, mittels derer Rassismus bekämpft werden kann.
Dazu möchte das Buch einen Beitrag leisten. Zu dessen Credo gehört es, über Rassismus zu reden und zu schreiben, ohne ihn zu reproduzieren. Dafür muss erstens ein sprachlicher Fokus auf Akteur*innen und Vorgänge im Rassismus gerichtet werden. Das bedeutet etwa, dass ich eher in Aktiv- als in Passivsätzen schreibe: «Weiße diskriminieren Schwarze» statt «Schwarze werden diskriminiert». Auch in anderen Formulierungen bemühe ich mich, den Prozess selbst zu benennen. So spreche ich etwa von der europäischen Versklavung von Afrikaner*innen statt vom Transatlantischen Sklavenhandel: Während der Begriff «Handel» Legitimität suggeriert, drückt europäische Versklavung aus, dass es eines illegitimen Handelns bedurfte, wobei auch die Handelnden (Europa) benannt werden.
Zu meiner Strategie, Rassismus zu thematisieren, ohne ihn zu reproduzieren, gehört auch, dass ich rassistische Wörter nicht ausschreibe, sondern abkürze oder (bei der Ersterwähnung) typografisch absenke, um mit ihrem nachkolonial-rassistischen Überdauern zu brechen und Denkgewohnheiten zu irritieren. Es geht darum, Reflexionsprozesse anzustoßen und deutlich zu machen, dass diese Begriffe den Glauben an ‹Rassen› und eine entsprechende Bejahung des Rassismus im Wort führen. Ich kann Begriffe so aus einer analytischen Perspektive heraus benennen (z.B.: Kant benutzt immer das N-Wort) und zugleich die Macht rassistischer Wörter über die Gegenwart dadurch bändigen, dass ich rassistisches Vokabular nach dem oder den ersten Buchstaben abkürze. Das mache ich in diesem Buch nahezu durchgängig und konsequent (in wenigen Fällen schreibe ich die Wörter bei der Erstnennung aus, damit der Kontext klar ist); und dies tue ich entgegen verbreiteter wissenschaftlicher Praxis auch in direkten und indirekten Zitaten sowie dem Verzeichnis von im Text und in den Fußnoten angeführten Titeln und Werken. Damit setze ich der Gewalt, die diesen Wörtern in jedem einzelnen Gebrauchskontext innewohnt, Grenzen.[3]
Mittels solcher Strategien kann auf kritische, reflektierende und fragmentierende Weise über Rassismus gesprochen und wie hier geschrieben werden. Im ersten Kapitel werden Strategien und Auswirkungen von Diskriminierung im Allgemeinen und von Rassismus im Besonderen diskutiert, um daraus eine Definition abzuleiten. Das schließt ein, Rassismus von anderen Diskriminierungsformen und Begriffen abzugrenzen und seine verschiedenen Strömungen und Facetten vergleichend zu betrachten. Das zweite Kapitel durchmisst anschließend die globale Geschichte des Rassismus in Siebenmeilenstiefeln, wobei ein Augenmerk auf deutschen Prozessen liegt. Die jeweiligen Rassentheorien werden aus entsprechenden politischen Kontexten heraus betrachtet und philosophische und naturwissenschaftliche Texte, die Rassismus hervorgebracht und tradiert haben, im Kontext rassistischer Praxen analysiert. Das geschieht in gegebener Verschränkung von verschiedenen Rassismen (etwa Antisemitismus oder Rassismus gegenüber Schwarzen) sowie Ebenen des Rassismus (von Alltagsrassismus bis zu institutionellem Rassismus). Dabei ist es unerlässlich, die Spuren bis ins Mittelalter und in die Antike zurückzuverfolgen – wurde hier doch die Grundlage des modernen Rassismus geschaffen. Dieser Tiefenblick aus der Geschichte heraus lässt verstehen, dass Rassismus weder in der Aufklärung noch im NS aus dem Nichts entstand – und als jahrtausendealte Grammatik sozialer Ungleichheit auch nicht einfach so verschwinden wird. Aufbauend auf diesem historischen Abriss, folgt im dritten Kapitel eine Bestandsaufnahme von Rassismus in der Gegenwart – der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Politik, strukturell-institutionellem Rassismus und Alltagsrassismus sowie gesellschaftlichen Debatten. Deutschland steht dabei ebenso im Zentrum wie im Vergleich. Ein abschließendes Fazit reflektiert, was getan werden kann, um Rassismus die Stirn zu bieten.
I. RASSISMUS: GRUNDLAGEN, KONZEPTIONELLE VERIRRUNGEN UND STRÖMUNGEN
1. Othering und Privilegien im Kontext sozialer Ungleichheit
Zur Geschichte der Menschheit gehört es, dass sich Gesellschaften immer wieder geopolitisch voneinander abgrenzen – mit allen dazugehörigen Konflikten und Kriegen, Eroberungen und Okkupationen, Ent- und Besiedelungen sowie Erzählungen, dass die Anderen anders seien: kulturell, religiös oder körperlich, in gegebenen Verschränkungen.
Nicht etwa, dass Abgrenzungsbestrebungen eine genetisch festgelegte und damit angeborene Eigenschaft des Menschen wären. Vielmehr geht es dabei um Herrschaft, die sich aus Machtkonstellationen erhebt. Solche Muster wurden und werden nicht nur zur Abgrenzung nach außen, sondern auch zur gesellschaftlichen Organisation nach ‹innen› benutzt. Alle gesellschaftlichen Ordnungen, von denen wir genauere Zeugnisse besitzen, haben sich so organisiert: Die einen haben/dürfen mehr als andere. Das ist nicht alternativlos. Aber eine wirklich gelebte Alternative dazu gibt es bislang kaum. Im Herzen dieser Abgrenzungen nach innen wie nach außen steht eine auch ökonomisch rentable politische Kulturtechnik, die in der Wissenschaft als Othering bezeichnet wird. Im Wortkern steckt das englische Wort other. Das ist als Andere zu übersetzen. Zu diesem Anderen gehört das Verständnis von sich selbst als Norm oder Normalität. Und genau darum geht es beim Othering.
Das Suffix ‹-ing› verweist darauf, dass das Andere nicht immer schon sowieso da ist. Nein, es wird gemacht, erfunden, hergestellt. Warum? Beim Othering geht es nicht einfach nur darum, das Eigene vom Anderen abzugrenzen. Es geht vor allem darum, klare Grenzen zu ziehen, um eine bestimmte Gruppe von Menschen als Norm(alität) zu setzen, aus der andere ausgeschlossen werden. Wer macht dies? Nicht die Anderen offensichtlich. Nein, das Othering ist etwas, das Menschen erfinden, um sich selbst als Norm(alität) zu setzen – und daraus Herrschaft und entsprechende Privilegien abzuleiten. Das aber muss mensch erst mal können. Hier kommt Macht ins Spiel. Denn nicht jede*r kann sagen: «Ich bin die Norm. Du bist anders.» Othering geschieht im Kontext von wirkmächtigen Systemen wie Sexismus oder Rassismus. Wenn etwa Oscar Wilde, der Ende des 19. Jhs. im Vereinigten Königreich wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, im Gerichtssaal ausgerufen hätte, wer heterosexuell sei, sei nicht normal, hätte er das Gefängnis wohl nie mehr verlassen können.
Diese Selbstprivilegierung bewirkt wiederum die Diskriminierung der Anderen. Die Einen dürfen mehr als Andere, die Einen besitzen mehr als Andere, die Einen kontrollieren das Leben der Anderen, die Einen haben Zugang zu Ressourcen und Rechten – während ebendieser Zugang den Anderen verwehrt bleibt. Mit anderen Worten, das Ziel von Othering ist primär die Privilegierung der Einen; die Diskriminierung der Anderen ist Voraussetzung und Folge zugleich. Diskriminierung ist nicht allgegenwärtig, weil sie Menschen herabsetzen will. Sie ist es, weil sie einem bestimmten Personenkreis etwas zu bieten vermag, nämlich Macht und Herrschaft und auf diese Weise offerierte Privilegien (samt dem Instrumentarium, diese strukturell und institutionell abzusichern und moralisch und durch geteiltes Wissen zu legitimieren). Würden Diskriminierungen nur als negativ empfunden werden, könnten sich die betreffenden Strukturen, Institutionen und Diskurse nicht behaupten. Weil Diskriminierungen aber jenen Kreis von Personen, die Macht haben und diese in Herrschaftsstrukturen einspeisen, mit Privilegien ausstatten, haben sie Bestand.
Nicht nur Diskriminierte, sondern auch Diskriminierende sind also auf jeweils spezifische Weise mit Rassismus und dessen unterschiedlichen Manifestationen verbunden. Alle sind von den zugehörigen Wissensdiskursen gleichermaßen geprägt, sind in die gleichen Strukturen eingebunden und müssen sich denselben Institutionen stellen. Dennoch ist es charakteristisch für Privilegien, dass sie meist nicht einmal bemerkt werden. Das hat viel damit zu tun, dass sie auch ohne aktives Handeln zur Verfügung stehen. Weil das zugehörige System (samt der Privilegien, die es verteilt und verteidigt) weithin als normal und richtig angesehen wird, bietet es eine Struktur, Privilegien nicht als solche wahrzunehmen. Sie können nicht einmal leicht ausgeschlagen werden. Das ist ein roter Teppich, um sich von individueller Schuld und Verantwortung loszulösen. Es ist selbstverständlich sehr viel komfortabler, in der Annahme zu leben, dass die Welt so geschaffen sei, dass es mir – weil ich etwa ein weißer deutscher Mann sei – besser gehen müsse als anderen, und dass ich dazu berechtigt sei, Privilegien zu genießen, und mich daher auch nicht schlecht fühlen müsse. Es geht bei Diskriminierung also nicht nur darum, den einen Rechte und Privilegien zu sichern. Privilegierte sollen sich damit auch wohlfühlen und guten Gewissens glauben können, dass es seine Richtigkeit habe, wenn diese Anderen verwehrt bleiben – selbst wenn dies mit Gewalt einhergeht.
Hierbei greifen Konstruktionsprozesse, entsprechende Wissens- und Moralvorstellungen und Gesetzgebungen samt deren struktureller und institutioneller Umsetzung vermittels Macht und Herrschaft einander wechselseitig unter die Arme, wobei sie Handlungen prägen. Das vollzieht und vollzog sich analog und doch verschieden in unterschiedlichen lokalen Kontexten (entlang einer Binnendifferenzierung von etwa Geschlecht, Klasse, Religion oder Alter) und globalen Begegnungsgefügen. Letztere sind kulturell, religiös und rassistisch koloriert, wobei auch ökonomische, geografische, religiöse und linguistische Faktoren eine Rolle spielen.
Ebendieses Miteinander von Norm versus Othering und Privilegien versus Diskriminierung und deren Einbindung und Umsetzung in Strukturen, Institutionen, Gesetze, Moral und Wissen ist das Grundprinzip sozialer Ungleichheit, das gesellschaftliche Ordnungen im Inneren hierarchisch organisiert und hierarchisierende Abgrenzungen nach außen ebenso antreibt wie abrundet. Rassismus bewegt sich in ebendiesem Muster.
2. Rassismus als Erfindung und Othering mittels ‹Rassen›
Verwendungen des Wortes ‹Rasse›, die seit dem frühen 13. Jh. belegt sind, drücken die Idee aus, dass Natur und Abstammung Wesenszüge von menschlichen Verbünden (z.B. familiär) festlegen,[3] wobei eine Nähe zu den lateinischen Wörtern für (genealogische) Wurzel, radix, oder (genealogisches) Geschlecht, generatio, oder Natur/Wesen/Art, ratio, vermutet werden kann. So etablierte sich raça/raz(z)a als Vokabel für genealogisch verwandte Gruppen, wie etwa Dynastien – aber auch Familien im Allgemeinen.[4] Eine Binnennuancierung nach Klasse blieb dabei aber (im tradierten Sinne von eine ‹Rasse› haben) entscheidend.
Der früheste Beleg dafür findet sich 1438 bei Alfonso Martínez de Toledo, der eine bäuerliche und ritterliche Herkunft über den Begriff raza kontrastiert:[5] Mensch werde in eine Herkunft (und, verbunden damit, eine Art Tätigkeitsprofil) hineingeboren und bleibe dort auch, ohne eine andere zu begehren. Diese vererbungscodierte Klassenidentität spielt etwa im Streit zwischen dem französischen Geburts- und Amtsadel im 16. Jh. eine Rolle. Dem Geburtsadel drückte ‹Rasse› dabei im Sinne des arabischen ra’s aus, eine Ahnengenealogie vorweisen zu können, aus der eine ‹Reinheit des Blutes› spreche. In diesem Sinne ist etwa auch eine frühe deutsche Verwendung des Begriffes aus dem Jahr 1581 belegt: «eure Razza stirbt […] nicht aus», die das Deutsche Fremdwörterbuch 1977 «Riederer» zuschreibt, ohne zu spezifizieren, um wen es sich dabei genau handelt.[6]
In ebendiesem Sinne verwendeten die Statuten von Toledo zur limpieza de sangre (1449) ‹Rasse›, um Jüd*innen, Muslim*innen sowie Herätiker und H. (auch als Konvertierte) von den Altchrist*innen abzusetzen. So gesehen, sind Toledos Statuten von der Reinheit des Blutes die frühesten Zeugnisse des Gebrauchs von ‹Rasse› im Sinne des sich formierenden Rassismus. Seit Ende des 15. Jhs. finden sich weitere Belege für die christliche Vorstellung, sich als ‹weiße Rasse› im Kampf um Herrschaft als überlegene Norm aufzustellen. Folglich sind ‹Rassen› «Resultat, nicht Voraussetzung rassistischer Argumentation».[7]
Jedes Sehen des menschlichen Körpers beinhaltet eine soziale Dimension, schreibt Mary Douglas 1970. Das heißt, ohne das Verlangen, soziale Hierarchien und Grenzen herzustellen, bestünde auch nicht das Interesse, körperliche Grenzen zu erfinden.[8] Jede vermeintlich natürliche Sicht auf körperliche Unterschiede habe immer eine soziale Dimension. Denn ohne ein Interesse daran, soziale Unterschiede herzustellen, gäbe es auch kein Interesse an starren Grenzziehungen zwischen Körpern. Deswegen folgt es keineswegs reiner Willkür, welche Kriterien angelegt werden, um körperliche Unterschiede zu zementieren. Vielmehr zielt die zugehörige Logik auf ein Bewertungsverfahren ab, das dem jeweiligen gesellschaftlichen Machtkontext und dessen ökonomischen und politischen Interessen – sowie den gegebenen Möglichkeiten – angepasst ist.
Der eigentliche Zweck von ‹Rasse› war es, die europäische Kolonisierung der Welt zu legitimieren und Europa als allen Anderen überlegen zu konstruieren. Entsprechend wurden Körper so kartiert, dass sie diesem Zweck dienten. Aus einer Vielzahl möglicher und zumeist visuell sichtbarer körperlicher Merkmale wurden, schreibt Albert Memmi, aus einem weißen Machtzentrum heraus und in dessen Herrschaftsinteresse einzelne herausgenommen und zu Bündeln geschnürt, die vermeintlich naturgegebene Antithesen repräsentieren und entsprechend relevante Unterscheidungsmerkmale offerieren sollten.[9]
Schon ab der frühesten Verwendung im 15. Jh. taucht die Idee von Blut als Schauplatz von ‹Rasse› auf, jedoch eher als Metapher für Abstammung, nicht im eigentlich körperlich nachweisbaren Sinn. Dafür wurde zunächst das Konstrukt ‹Hautfarbe› bemüht: Unter Aufrufung der christlichen Farbsymbolik kam ein Abstraktionsprozess zum Tragen, der christliche Europäer*innen als ‹weiß› und damit (göttlich) überlegen deklarierte, wobei Afrika als schwarze stagnierende (Tier-)Natur die unterste Stufe zugewiesen wurde. Auch innerhalb Europas gab es Differenzierungen etwa entlang von Raum/Nation, Sprache/Kultur, unterschiedlichen christlichen Konfessionen sowie Geschlecht. Jedoch wurde von diesen innereuropäischen Grenzziehungen, allen realpolitischen Konflikten zum Trotz, abstrahiert, um eine gemeinsame weiße (christliche) Norm(alität) ins Zentrum der Welt zu stellen.
So als ‹weiß› codiert, drangen Rassentheorien später immer tiefer in den Körper hinein. Als sich etwa die klimatheoretischen Skalierungen von ‹Hautfarben› nicht mehr halten ließen, weil Kolonialismus hieß, dass Weiße in den Tropen und Schwarze in nördlichen Breitengraden lebten, wurden zusätzlich zu den Formen von Lippen und Nasen zunehmend auch Schädel, Skelette oder Geschlechtsorgane kartiert. Als die Zahl der so kartierten ‹Rassen› an der Wende zum 20. Jh. etwa 100 erreichte und das Modell dennoch kaum weniger überzeugte, wurde postuliert, dass ‹Rassen› über das Blut genetisch nachweisbar wären. Und seit das widerlegt ist, gibt es einen Backlash – den Rückschlag, wieder verstärkt auf ‹Hautfarben› zurückzugreifen. Ergänzend dazu wird die Strategie verstärkt, Körperlichkeiten (etwa auf Bartkosmetik oder Kleidung) auszulagern.
Den so konstruierten körperlichen Unterschieden (und den diesbezüglichen Kriterien) wurden, so Memmi weiter, bestimmte soziale, kulturelle und religiöse Eigenschaften und Verhaltensmuster zugeschrieben – und verallgemeinernd und verabsolutierend gewertet und hierarchisiert. Dabei spielten sich Theolog*innen, Philosoph*innen und Naturwissenschaftler*innen in einem paneuropäisch weißen Projekt wechselseitig in die Hände. Um das ‹Rasse›-Othering von weiß versus Schwarz/gelb/rot zu fundieren, wurde der Natur-Kultur-Binarismus mobilisiert, der sich als Vernunft-versus-Emotion-Paradigma ausformte. Für diese Konstruktion baute die sogenannte «Chain of being» aus antiken, mittelalterlichen und humanistischen Philosophien heraus eine ideologische Pyramide: Menschen stünden sowohl über den Mineralien, Pflanzen, Tieren als auch unter dem Göttlichen. Ebendieses Muster wurde dann aus den Rassentheorien heraus zur Binnendifferenzierung von Menschen benutzt: je näher dem Göttlichen, umso überlegener, weil Verkörperung von Kultur; je näher den Tieren, desto unterlegener, weil Teil von Natur. Und so wie die anthropozentrische Logik den Menschen (als Repräsentanz von Kultur) die Natur als Ressource ansehen lässt, die von Menschen gebändigt oder gezähmt werden müsse (was sich in Unterwerfung, Ausbeutung, Herrschaft übersetzt), gilt das auch für soziale Ordnungen und deren menschliche Interaktionen: Jene, die mehr Kultur seien, dürfen, ja, müssten jene unterwerfen, will sagen ‹zivilisieren›, die Natur verkörpern. Denn je mehr Natur, desto mehr der Kultur unterlegen und deswegen weniger Mensch – und je weniger Mensch, desto weniger Anspruch darauf, menschenwürdig behandelt zu werden.
Im Kern läuft dieser «Manichäismus»[10] auf die Formel «Kultur versus Natur», also Weiß versus Schwarz, Gut versus Böse, Errettung versus Verdammnis, ‹Zivilisation› versus Wildheit/B., Überlegenheit versus Unterlegenheit, Intelligenz/Rationalität versus Emotion und Subjekt versus Objekt [11] und damit auf eine Legitimierung sozialer Ungleichheit hinaus. Es sei von Natur aus definiert, dass die Einen zum Herrschen und Besitzen, die Anderen zum Dienen und Besessen-Werden geboren seien. Geografische Differenzen entsprächen dabei körperlich kartierbaren religiösen, kulturellen und mentalen Unterschieden. Je mehr Kultur und Mensch, desto mehr Verstand, Fortschritt und ‹Zivilisation› – und daher Berechtigung und Berufung, über jene zu herrschen, die all dies vermeintlich nicht verkörpern. Aus dieser Logik heraus galt Kolonialismus als ebenso zwangslogisch wie moralisch gerechtfertigt. Weil Weiße die Einzigen seien, die ‹Zivilisation› verkörperten, sei es eine weiße Bürde, konkret die des «weißen Mannes»,[12] die Welt zu ‹zivilisieren›. Von hier war es nur ein kurzer Schritt, sich diese vermeintliche ‹Zivilisationsarbeit› durch Ressourcen und/oder un(ter)bezahlte Arbeitskräfte vergüten zu lassen – und entsprechende Gewalt zu legitimieren.
Dieses Prinzip hat Rassismus in den nachfolgenden Jahrhunderten nie verlassen, nur bestärkt. Das Ziel war und blieb, weiße Ansprüche auf Herrschaft, Macht und Privilegien zu legitimieren und zu verfestigen – und umgekehrt die entsprechend Anderen davon auszuschließen. Rassismus wuchs zu einer jahrtausendealten Macht- und Herrschaftsstruktur heran, die immer noch nach der Zukunft greift. Noch heute bauen europäische und nordamerikanische Industriestaaten ihre Bruttoinlandsprodukte auf Rohstoffen und viel zu billigen Arbeitskräften aus dem Globalen Süden auf, während die ‹westliche›[13] Massentierhaltung dort lokale Fleischmärkte überrollt und ‹westliche› Waffengeschäfte Menschen in der MENA-Region (Middle East and North Africa) töten. Nur die Rassismuslogik macht es plausibel, dass der Globale Norden einen privilegierten Zugriff auf Rechte, Ressourcen, ökonomische, rechtliche, soziale, gesundheitliche Privilegien und damit Lebensqualität hat(te) – obwohl dies auf Kosten der Anderen geht. Auch innerstaatliche Muster von ungleicher Verteilung von Wohlstand bis Repräsentation, Sicherheit bis Zugehörigkeit sind in ‹westlichen Staaten› rassistisch codiert.
3. Rassismus. Überlegungen zur Begriffsbestimmung
Die Meinungsfreiheit lässt ausreichend Raum dafür, etwas als rassistisch oder eben auch nichtrassistisch zu bezeichnen. Am Ende aber ist Rassismus keine Meinung, sondern eine Macht- und Herrschaftsstruktur, die vermittels Privilegierung und Diskriminierung Leben bewertet, beeinflusst, beeinträchtigt und beendet. Letzteres ist laut Grundgesetz (1949: Art 1, Abs 1; Art. 3, Abs. 3), StGB (1871: § 130 & § 186ff.) sowie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verboten. Letztlich aber darf die Frage, was Rassismus ist, weder Meinungen noch Gerichten allein überlassen bleiben. So wie die Erde den Menschen ohne wissenschaftlich fundiertes Wissen eine Scheibe geblieben wäre, ist es letztlich ebenso möglich wie notwendig, Befunde darüber, ob etwas rassistisch ist oder nicht, wissend herzuleiten und wissenschaftlich zu unterfüttern. Aus meiner Herleitung ergibt sich, Rassismus auf die knappe Formel «white supremacy», Vorherrschaft (und Privilegierung) von Weißsein, zu bringen. Diese hat gesellschaftliche, wirtschaftliche, juristische, kulturelle und politische Strukturen und Institutionen implementiert, welche Moralvorstellungen, Wissen und Handlungen ebenso prägten, wie sie von diesen getragen wurden. Deswegen sind struktureller/institutioneller und Alltagsrassismus zwei Seiten des gleichen Systems. Rassismus hat System, weil er so allumfänglich ist und aus der Wiederholung heraus lebt. So aufgestellt, ist Rassismus auch jenseits von Vorsatz oder individuellen Intentionen wirkmächtig. Entsprechende gesellschaftliche Diskurse «wiegen schwerer als eigene Erfahrungen und sind allzu häufig immun gegen Einwände. Brüche und Widersprüche zwischen Bildern und Erfahrungen werden geglättet.»[1] Dämonisierung (und entsprechende Beleidigungen) sowie Exotisierung (und entsprechende Komplimente) sind dabei zwei Seiten der gleichen Medaille. Auch Paternalismus und zu Paradoxien führende Scheinheiligkeiten gehören zum Gesamtbild, das Rassismus ermöglicht, die Welt dem Weißsein passfähig zu machen.
Entsprechend wirkt Rassismus als physische Gewalt durch Massaker, Genozide, Pogrome und Terroranschläge sowie über strukturell-institutionelle Gewalt: etwa in Form von diskriminierenden Gesetzgebungen (u.a. der Verweigerung von Rechten, Besteuerungen, Eugenik, Vertreibungen und Betätigungsverboten) und, über direkte Gesetze hinaus, durch Diskriminierung bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche, im beruflichen Werdegang sowie durch Ungleichbehandlung bei polizeilichen Maßnahmen. Diese Gewalt, diese Strukturen und Institutionen prägen Moralvorstellungen und Wissen und umgekehrt. Daraus ergibt sich epistemische Gewalt. Rassistisches Wissen prägt Kunst, Musik oder Literatur ebenso wie Theologie, Natur-, Sozial- oder Kulturwissenschaft. Dies wiederum rahmt Alltagsdiskriminierung im Spektrum von (stereotypisierenden bis beleidigenden) Mikroaggressionen und Ausgrenzungsrhetoriken, die sich im Zirkelschluss auch als Praktiken, Gewalt, Strukturen, Institutionen äußern.
4. Der Racial Turn oder soziale Positionen im Rassismus
Jedes Sprechen über Rassismus ist immer vom Minenfeld seiner Geschichte und Gegenwart umzingelt – und von der Frage, wie dies benannt und zugleich aufgebrochen werden kann, damit ich über Rassismus sprechen kann, ohne ihn und seine Giftwirkung zu reproduzieren. Das geht schon dabei los, wie ich den Begriff ‹Rasse› verwende.
«Rassen gibt es nicht», schreibt Collette Guillaumin, «und doch töten sie.»[1] ‹Rassen› gibt es nicht, Rassismus schon. Deswegen muss über die Macht des biologistischen Konstruktes ‹Rasse› gesprochen werden und darüber, dass dieses dem Rassismus das Instrumentarium bietet, das Menschen entlang körperlicher Raster in Muster von Diskriminierung und Privilegierung einsortiert. Vor diesem Hintergrund hält es der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Shankar Raman für unabdingbar, sich dem Begriff ‹Rasse› als wichtigster Kategorie des Rassismus offensiv zu stellen und den notwendigen Kampf um die Bedeutung von ‹Rasse› zu führen, um sich diesen Begriff aus antirassistischer Sicht anzueignen. Er schlägt eine doppelte Denkbewegung vor. Von ‹Rasse› als biologistischem Konstrukt (und daher in Anführungszeichen geschrieben) führt sie weg, und zwar hin zu Rasse (kursiv geschrieben) als soziale Position. Er bezeichnet diese Denkbewegung als ‹Racial Turn›.[2]
In ebendiesem Sinne schreibe ich in diesem Buch ‹Rasse› in einfachen Anführungszeichen, wenn es sich um das biologistische Konstrukt handelt; und Rasse in Kursivschrift, um auf die soziale Position hinzuweisen, die Rassismus erzeugt(e). Ebenso wenig wie das biologistische Konzept ‹Rasse› nicht jenseits seiner Geschichte von Wertungen und Gewalt existieren kann, kann mensch nicht über die ‹Rasse› einverleibte Geschichte von Wertungen, Gewalt und entsprechend erzeugter sozialer Ungleichheit sprechen, ohne nicht auch Rasse als soziale Position zu adressieren. ‹Rasse› wohnt von Beginn an der Idee von Rassismus inne (den es schon vor der offiziellen Benennung von ‹Rassen› gab). Deswegen kann Rassismus umgekehrt nicht besprochen werden, ohne Rasse an- und auszusprechen. Und so wie es einen Unterschied macht, ob ‹Rasse› biologistisch oder als Rasse sozialkritisch geschrieben wird, ist auch rassistisch nicht dasselbe wie ‹rassisch›. Aus Letzterem spricht die Idee von ‹Menschenrassen›. Dagegen ist ‹rassistisch› der in diesem Kontext notwendige Analysebegriff, welcher die so erzeugten und damit verbundenen Effekte, Wirkweisen oder Zuschreibungen zu benennen und anzugreifen vermag.
Seit Beginn dieses Buches spreche ich von BIPoC und weißen Personen und stehe damit mitten in der (Farb-)Codierung des Rassismus. Einerseits. Denn andererseits habe ich sie mit antirassistischen Vokabeln überschrieben: Nicht etwa von einer Schwarzen oder weißen ‹Rasse› ist hier die Rede, sondern von durch Rassismus positionierten Menschen. Diese Verwendungen stehen also nicht für biologistische Kategorien, sondern für soziale Positionen.
So wie Frauen nicht als Frauen geboren, sondern dazu gemacht werden – um Simone de Beauvoir frei zu zitieren[3] –, werden auch Männer vom Patriarchat dazu geformt, wie Männer zu ticken. Analog dazu werden Menschen beispielsweise in Schwarze oder weiße Positionen hineinsozialisiert – ob sie das nun (so) möchten oder nicht. Hier geht es um soziale Positionen, die durch Macht- und Herrschaftskonstellationen erzeugt werden. Diese existieren unabhängig davon, ob sie wahrgenommen oder reflektiert werden. Daraus wiederum ergeben sich Perspektiven, Standpunkte und Erfahrungen, aus denen Identitäten erwachsen, die kollektiv geprägt und individuell gelebt werden. Zur Identität gehört dabei auch eine Wahrnehmung der sozialen Position. In Identität steckt daher auch, sich als individuelles Ich aus dieser sozialen Position heraus zu sich selbst und dem eigenen Platz in sozialen Gefügen zu verhalten – sowie zu entsprechend analog geprägten Kollektiven/Communities.
Entsprechende soziale Positionen im Rassismus benötigen eine Benennung, denn wie sonst könnte darüber gesprochen werden, dass Weiße andere Menschen rassistisch diskriminieren. Insgesamt ist eine symmetrische Benennung wichtig: Nicht Afrodeutsche und Deutsche, sondern Afrodeutsche und weiße Deutsche oder, entsprechend, christlich sozialisierte Weiße und jüdisch positionierte BIPoC.
4.1. Weißsein als soziale Position infolge rassistischer Macht und Privilegierung
In einem rassismuskritischen Verständnis ist Weißsein kein biologistischer oder somatisierender Begriff. Es geht weder um Pigmentierungen oder Komplexionen noch um natürlich gegebene Sichtbarkeit. Es geht nicht um ‹Hautfarbe› als biologistisches Konstrukt, sondern um die ideologische Konstruktion von ‹Hautfarben›, aus der sich eine soziale Position im Rassismus ergibt, die Macht und Privilegien beinhaltet.
Rassismus etablierte das Sehen von ‹Hautfarben›. Natürlich tritt menschliche Haut in unterschiedlichen Farbtönen auf. Aber so wie kein Mensch (äußerlich) einem anderen entspricht, so gibt es auch keine zwei Menschen mit exakt gleicher ‹Hautfarbe›. Noch mehr als die Farbe des Haares ist die Farbe der Haut individuell tagtäglichen Schwankungen unterworfen, in Abhängigkeit von inneren Erregungszuständen, Erkrankungen, Sonneneinwirkung etc. Und weil etwa die Haut beispielsweise von Weißen alle möglichen Nuancierungen zwischen Rosa, Olive und diversen Beige- und Brauntönen zeigen kann, bedarf es doch einer hohen Abstraktionskunst, Menschen als Weiße zu beschreiben und sie von etwa G., Schwarzen oder Roten abzusetzen. Welcher Mensch ist schon so bleich wie das Papier, das Sie gerade in den Händen halten, oder so schwarz wie die Buchstaben, die Ihnen jetzt vor Augen stehen? Niemand ist blütenweiß oder so schwarz, wie die rassistischen Minstrel Shows Schwarze zeichneten. In manchen Fällen mag ein Braun oder sehr blass schon sichtbar sein, aber insgesamt gibt es sehr viele Beigetöne dazwischen.
Zwar ist die Pigmentierung der Haut ein genetisch übertragbares Merkmal, das sich durchaus in Abhängigkeit von klimatischen Differenzen entwickelt haben mag. Auch lassen sich Dunkelbraun und Rosa kontrastreich voneinander abgrenzen. Doch es gibt keine Möglichkeit, klar definierbare Grenzen zu ziehen. Natürlich könnten etwa 100 Menschen auf einer Bühne so aufgestellt werden, dass ihr Teint immer heller bzw. dunkler wird. Jedoch ist es ein Ding der Unmöglichkeit, eine klar benennbare Trennlinie zu ziehen und einen Farbteint zu benennen, der einen Menschen gerade noch bzw. nicht mehr weiß oder Schwarz sein lässt – wäre da nicht das vom Rassismus erlernte Wissen. Tatsächlich wirft ein solch fragwürdiges Unterfangen, eine Trennlinie zu konstruieren, die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Projektes ‹Hautfarbe› auf. Letztlich gibt es ebenso viele ‹Hautfarben›, wie es etwa Nasen- oder Ohrformen gibt – vermutlich unendlich viele, jedenfalls so viele, wie es Menschen gibt.
Dass ‹Hautfarben› dennoch sortiert werden, liegt daran, dass Rassismus Menschen beigebracht hat, ‹Rassen› zu sehen, und ‹Hautfarbe› dabei – in Verbindung mit anderen körperlichen Konstitutionen sowie kulturellen und religiösen Merkmalen – eine wichtige Rolle zugewiesen hat. Anders ausgedrückt: ‹Hautfarben› sind nicht von Natur aus sichtbar. Dies sind sie allein, weil Rassismus dieses Sehen erfunden, etabliert und instrumentalisiert hat. Seshardri-Crooks spricht diesbezüglich von einem «Blickregime»: «Wir glauben an die Faktualität der Differenz, um sie sehen zu können.»[4] Diese Faktualität gab es bereits, bevor sich der Begriff ‹Rasse› etablierte – und sie hält sich ebenso beharrlich wie damit einhergehende Erzählungen.
Im Widerspruch dazu führt die rassismuskritische Sprache weg von ‹weißer Rasse› oder Weiße als biologistischer Kategorie und hin zu weiß/Weiße/Weißsein als soziale Kategorie. Die Kursivsetzung benennt den Konstruktcharakter und die sich daraus ergebende Machtposition: Als Erfinderin, Norm, Motor sowie Akteurin und Nutznießerin von Rassismus ist Weißsein eine der mächtigsten «soziokulturellen Währungseinheiten»[5] und damit Druckmaschine für eine Währung, die weltweit hoch im Kurs steht: Privilegien. Im Verbund mit einem deutschen Pass hat, global und strukturell betrachtet, kaum eine Position mehr Privilegien inne als weiße, heterosexuelle cis-Männlichkeit in einem ‹westlichen› Land. Denn diese Diskriminierungs- versus Privilegierungsprozesse laufen mehrdimensional. So kann es etwa auch inmitten rassistischer Herrschaft auf der Achse von Geschlecht zu Konstellationen kommen, in denen etwa ein Schwarzer Mann Macht und Privilegien gegenüber einer weißen Frau oder LGBTIQ*-Person[6] bekommt. Allerdings betrifft dies die unterschiedlichen Personengruppen in Abhängigkeit von ihren Zugehörigkeiten zu Konstruktionen entlang von z.B. Generationen, Religionen, Nationen, Sexualitäten, Identitäten oder ihren Positionen im Rassismus auf verschiedene Weise. Im Kontakt mit anderen Machtachsen etwa von Klasse oder ability[7] kann eine Schwarze Person Privilegien haben, die einer weißen unzugänglich sind. Das hebt die rassistische Weiß-Schwarz-Machtachse nicht auf, krümmt sie aber.
Doch so ominpräsent und mächtig Weißsein auch ist: Ihre Hoheit lassen sich gern verleugnen. Eine Untersuchung der deutschen Psychologin Ursula Wachendorfer aus den späten 1990er Jahren fand heraus, dass weiße Deutsche, aufgefordert, sich identitär zu beschreiben, Dinge wie Beruf, Alter, Geschlecht, religiöse Orientierung und Familienstand nennen. Alle diese Aspekte werden von den Befragten sicherlich aus dem Grund angeführt, weil sie diese für sich selbst als wichtig ansehen und auch möchten, dass andere dies tun. Weißsein hingegen ist in der Regel als Selbstkonzept nicht bewusst vorhanden.[8]
Viele verstehen eine solche «Ich bin doch gar nicht weiß»-Haltung als antirassistisch, im Sinne von: «Ich will mich nicht in die Tradition jener stellen, die Weiße als überlegen deklarier(t)en. Deswegen will ich mich nicht als weiß verorten.» Andere profitieren einfach vom Privileg, sich weder mit Rassismus noch der eigenen Rolle darin auseinandersetzen zu müssen. Am Ende aber ist dies ein «Ausweichmanöver»[9] oder «Gleichmachereimythos»[10], der die Tradition des Rassismus fortschreibt. Denn BIPoC werden diskriminiert – und zwar nicht durch einen Passivsatz, sondern von Institutionen, Strukturen und Diskursen, die Weiße bau(t)en, repräsentieren, privilegieren. Weißsein als «unsichtbar herrschende Normalität»[11] zu leben ist eines dieser Privilegien, das auf Kosten der Anderen geht. Denn jedes «Ach, ich habe ja gar nicht gesehen, dass du Schwarz bist!» oder «Ach, wir sind doch alle gleich» zeigt: Weißsein zu vernebeln bedeutet immer auch, BIPoC und Rassismuserfahrungen unsichtbar zu machen, während sie doch markiert, bewertet und diskriminiert werden – und zwar aus Weißsein als «unmarkiertem Markierer» heraus.[12] Denn am Ende heißt es eben doch: «Der türkische Mann heiratete eine 40-jährige Frau.» Dass die Frau weiß ist, wissen wir, weil es nicht gesagt wird – ganz nach dem Motto, das ich frei nach Morrison zitiere: Wir wissen, dass Deutsch weiß meint, und wir wissen es, weil es niemand sagt.[13] Schon ist die Diskriminierung wieder geleistet.
Hinzu kommt: Dass Weißsein ebenso selbstverständlich wie unsichtbar wird, kulminiert in der Auffassung vieler Weißer, dass sie Rassismus nichts anginge. In dieser Schieflage rutscht Rassismus in die Auffassung, dass Rassismus allein etwas mit rassistisch diskriminierten Menschen zu tun habe – oder gar, dass er nur sie etwas anginge. Im gleichen Rhetorikschwall sind dann BIPoC viel zu emotional und betroffen, um Rassismus zu thematisieren. So ist dann etwa von Black Lives Matter als «Rassenunruhen» die Rede – als wäre ‹Rasse› gleichbedeutend mit Schwarz, wobei aus Unruhe nicht die Schwarze Widerstandsperspektive spricht, sondern die weiße Sicht der Dinge: Bitte nicht stören.
Seit wann aber geht Diskriminierung nur jene etwas an, die diskriminiert werden – und nicht auch jene, die diskriminieren und daraus Privilegien ziehen, ob sie das nun (wahrhaben) wollen oder nicht? Mal abgesehen davon, dass Akteur*innen und Profitierende immer auch in Diskriminierung eingebunden und weder neutral noch objektiv sind. Weiße sind oftmals sehr emotional, wenn es um Rassismus geht. Viele reagieren empfindlich darauf, über ihr Weißsein positioniert oder bewertet zu werden, oder sehen es als gelungene Abkürzung, sich über das Beschweigen von Weißsein aus der Verantwortung zu stehlen. «Happyland» in Flammen ist eine Vision, die viele Weiße beängstigt. Privilegien: Ja. Darüber reflektieren: Nein. So etwa lautet die Parole der «white fragility», der weißen Verwundbarkeit, der auch das Selbstverständnis innewohnt, aus einer Machtposition heraus zu sprechen, statt infrage gestellt zu werden und Blicke zu definieren, statt im Blickfeld zu stehen.[14] Und das ist nur eines von vielen weißen Privilegien, die Weiße auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt ebenso wie im alltäglichen Miteinander genießen.
Über Weißsein als soziale Position muss also gesprochen werden: über die Macht und Privilegien ebenso wie über die Verleugnungsstrategien, die damit einhergehen. Dies zu begreifen und umzusetzen ist ein erster, unverzichtbarer Schritt. Dabei geht es nicht um Schuldzuschreibungen oder darum, einzelne Weiße an den Pranger zu stellen. Es geht darum anzuerkennen, dass Rassismus – analog zu Männlichkeit als Motor von Geschlechterkonzeptionen – aus der Tiefe der Geschichte heraus ein System hervorgebracht hat, das Menschen – in globalen, regionalen wie lokalen Kontexten – aus Strukturen und Diskursen heraus ebenso sozialisiert und prägt. Nur wenn dies analytisch durchdrungen wird, kann Rassismuskritik den nächsten Schritt gehen: weißen Handlungen, die aus rassistischen Paradigmen heraus geprägt werden, entgegenzuwirken. Das reicht von einer Verkomplizierung von weißen Erzählungen über BIPoC bis dahin, diskriminierende Handlungen zu unterlassen und weiße Privilegien zu teilen. Dafür gibt es bislang keine Strukturen oder geebneten Wege. Folglich muss sich die Auseinandersetzung mit Weißsein auch Auseinandersetzungen mit dieser Ortlosigkeit und den daraus folgenden Irritationen und Verunsicherungen stellen – und der Tatsache, dass dem Weißsein bislang keine Widerstandsgeschichte innewohnt (was durch die Kursivschreibung zum Ausdruck gebracht wird).
4.2. Soziale Positionen infolge rassistischer Diskriminierung: Schwarz, People of Color, Indigene, Jüdisch und Passing
Gleichzeitig muss Gehör finden, wie sich rassistisch diskriminierte Personen selbst nennen. Insofern diese nicht die Option haben, Rassismus nicht zu bemerken, gehört es zur Geschichte des Rassismus und des Widerstands dagegen, sich die rassistischen Zuschreibungen anzueignen und sie widerständig zu unterwandern und neu aufzustellen. Das ist kein willkürliches Unterfangen von Einzelstimmen, sondern Ergebnis jahrhundertelanger Aushandlungsprozesse im Kontext von Widerstand.
In den 1930er Jahren formierte sich beispielsweise die ebenso politische wie kulturelle Widerstandsbewegung der Négritude. Sie wollte sich gegen Rassismus stellen – und unternahm den Versuch, sich das N-Wort anzueignen. Während Aimé Césaire dies aus dem Motiv heraus tat, die Geschichte der Schwarzen als eine Geschichte von Rassismus, Kolonialismus und Widerstand zu erzählen und damit Letzteren zu betonen, dachte Leopold Sédar Senghor das Wort (noch) aus dem Verständnis heraus, dass es ‹Rassen› gäbe – samt dem darin enthaltenen Natur-Kultur-Binarismus. Nur wendete er sie und die ihr innewohnende Hierarchie. So schrieb er dem bekannten «Ich denke, also bin ich» des Philosophen René Descartes ein neues Diktum zu: «Ich fühle, also bin ich», was diese Neusetzung von Kultur und Natur sowohl versinnbildlicht als auch an das intellektuelle Europa in seiner Geschichte anbindet.
Auch in den 1950er und 60er Jahren haben Schwarze Widerstandsintellektuelle und -aktivist*innen wie Frantz Fanon oder Martin Luther King Jr. dieses Wort popularisiert. Der Glaube an die Existenz von ‹Rassen›, mindestens aber Rassen war noch ebenso stark wie jener daran, das N-Wort aus seiner rassistischen Kontamination reißen zu können. Dieses Projekt ist gescheitert. Auch wenn das N-Wort vereinzelt immer noch in Schwarzen Kontexten künstlerisch-provokant Gebrauch findet: Das N-Wort ist rassistisch, und der Widerstand gegen Rassismus hat andere Wörter hervorgebracht.
Black oder Schwarze etwa. Ja, hier steckt immer noch die gleiche Farbe wie im N-Wort drin, aber es sind keine Fremdbezeichnungen, sondern Selbstbezeichnungen, die sich diesen widersetzen und entsprechend, vor allem im Deutschen, auch in adjektivischer Bedeutung, großgeschrieben werden. Geprägt wurde Black/Schwarze durch die US-Bürger*innenrechtsbewegung, die frühe Kolonialismus- und Rassismuskritik etwa Fanons oder Stuart Halls sowie die Black Studies um Paul Gilroy. Gilroy verortete Schwarzsein einerseits entlang von «roots» – also als Wurzeln einer Art historisch forcierter gemeinsamer Urherkunft – und andererseits entlang von «routes» als Wege im Sinne von Routen der Versklavung sowie im Sinne von Erfahrungen, die sich aus Sklaverei im Besonderen und Rassismus im Allgemeinen ergeben. Gilroys Konzept des Black Atlantic rekurriert metaphorisch darauf, dass die europäische Versklavung von Afrikaner*innen, die Maafa, den Atlantik zu einem Zeugen für die millionenfache Verschleppung von Afrikaner*innen sowie deren Massengrab werden ließ.
Entsprechend meint Schwarz Menschen, die in afrikanischen Ländern oder der Diasporas leben – auch dann, wenn sie noch nie in ihrem Leben an einem einzigen Ort des großen Kontinentes waren oder der Bezug zu Afrika genauso ein Konstrukt bleibt wie Afrika selbst. Deswegen ist auch der Begriff ‹afrikanischer Herkunft› höchst umstritten: Denn oft ist diese Herkunft mehrere Generationen alt oder auch nur sehr indirekt gegeben. Dann folgt die Fokussierung auf diese doch wieder dem Muster, Schwarze als nicht vollwertige Deutsche oder US-Amerikaner*innen zu setzen. Daher wird der Begriff ‹Schwarz› verwendet, und er schlägt die Brücke zwischen Kolonialismus, Maafa und zeitgenössischen Manifestationen des Rassismus gegen Schwarze.
Dennoch ist Gilroy der Black Atlantic nicht allein eine Brücke zwischen Afrika und seinen Diasporas in den Amerikas, Europa sowie andernorts – sondern zu allen rassistisch diskriminierten Personen. Gilroys Begriff von Schwarz ist dabei ebenso inklusiv gemeint: Schwarz meint alle, die in kolonialen und rassistischen Diskursen und Strukturen vom Weißsein ausgeschlossen werden. In dieser Anlage zeigt sich Schwarz zugleich flexibel und offen in Richtung Australien oder Neuseeland oder den Philippinen, weil sie – obgleich die Maafa sie nicht direkt betraf – von ähnlichen Kolonialismus- und Rassismuserfahrungen geprägt wurden und werden.
Diese breite Fassung von Schwarz ist heftig diskutiert worden, vor allem weil sie nicht offen genug sei, um verschiedene Rassismuserfahrungen zu erfassen. Zum anderen wurden in den späten 1990er Jahren (nicht zuletzt angestoßen durch Gilroy selbst) Kritiken aus Schwarzen Bewegungen heraus laut, dass spezifisch Schwarze Interessen und Erfahrungen durch diesen breiten Gebrauch unsichtbar werden würden.
Entsprechend hat sich parallel zu diesen Diskussionen ab den späten 1970er Jahren ‹People of Color› (PoC) etabliert. Dabei gab es den Begriff für freigelassene Versklavte bereits Ende des 18. Jhs. in den USA, und auch Martin Luther King Jr. sprach bereits von citizens of color. Eine aktivistische Entwicklung erfolgte allerdings erst danach, durchaus aufbauend auf Fanon, sodass ab Ende der 1970er, deutlicher dann ab den 1980er Jahren der Begriff Verwendung fand. Auch hier steckt (Haut-)Farbe drin, sogar das C-Wort (dt.: F-Wort). Doch der Widerstandsbegriff reproduziert nicht die analogen rassistischen Wörter. Vielmehr greift er die konstruierte Farbcodierung auf, um den Rassismus zu benennen, den mit diesem Begriff bezeichnete Menschen erfahren – um ihn zugleich zu wenden und ihm dadurch heftig zu widersprechen. Nicht nur durch Großschreibungen, sondern indem der Farbe das Menschsein vorangestellt wird: People, Mensch, Menschen – und zwar ebenfalls großgeschrieben. Dass ‹People of Color› People also Mensch/en im Namen führt, ist eine Intervention in die rassistische Strategie, ihnen das Menschsein abzusprechen, im Sinne von: Wir sind Menschen im Sinne von Black Lives Matter.
Der Gebrauch von PoC ist ambivalent. Einerseits drückte PoC lange aus, dass Rassismus systemisch über verschiedene Gruppen hinweg wirkt – mit gegebenen Unterschieden, aber eben auch Überlappungen etwa von Antisemitismus, Rassismus gegenüber Schwarzen, Orientalistischem Rassismus, Rassismus gegenüber Indigenen Menschen oder Ziganistischem Rassismus. Andererseits wurde diesbezüglich kritisiert, dass dabei die Spezifik von Rassismuserfahrungen untergeht. Deswegen hat sich mittlerweile eher der Gebrauch etabliert, dass PoC Menschen meint, die durch Orientalistischen Rassismus sowie Ziganistischen Rassismus diskriminiert werden – und zwar in dezidierter Absetzung zu Rassismus gegenüber Schwarzen. In diesem Sinne ist von BPoC die Rede.
Eine neuere begriffliche Setzung seit etwa 2013 spricht von BIPoC. Das I steht für Indigenous/Indigene (Menschen), wobei durch die Großschreibung des I und die betonende Ergänzung Menschen die widerständige Geschichte der Aneignung des Begriffes indio/Indianer sowie Eingeborene ausgedrückt wird. Dabei meint Indigene, je nach lokaler Setzung, First Americans oder Locals (USA), First Nations (Kanada) oder Latinx (eine Wendung des sexistisch diskriminierenden Latino). Allerdings verbleibt die Kategorie Latinx unkritisch in einem unvollständigen sprachlichen Konstrukt verhaftet, welches beispielsweise (frankophone Gebiete in) Kanada und Teile der Karibik zumeist systematisch ausschließt. Gleichzeitig werden teilweise auch weiße Argentinier*innen oder Chilen*innen eingeschlossen, wodurch ihr Weißsein fragmentiert wird – das im konstruierten Lateinamerika selbst auf den Olymp gehoben wird. Mit dem Argument, dass es in Deutschland keine Indigenen gäbe, wird hierzulande oft nur BPoC verwendet. Das ist schon insofern zu kurz gedacht, als es ja Rassismus gegenüber Indigenen Menschen sehr wohl gibt.
Mit Blick auf BPoc/BIPoC wird ebenfalls heftig debattiert, ob alle jüdischen Menschen als PoC gelten oder nicht. Dabei ist es ein Knackpunkt zu fragen, ob und wie zwischen jüdischen Menschen, die auch andere Rassismen erleben (etwa Rassismus gegenüber Schwarzen oder Orientalistischen Rassismus) und jüdischen Menschen, die sich inmitten des sogenannten white-passing bewegen, unterschieden werden kann oder muss.
White-passing (im Sinne von als weiß durchgehen) meint, dass Schwarze, Indigene Menschen oder PoC als weiß passen (also gelesen werden) können: ‹Hautfarben› sind, wie ausgeführt, eine fließende Konstruktion – ebenso wie alle anderen Kriterien, die zur rassistischen Klassifikation dienen. Zwar ergeben sich aus dem white-passing Zugriffe auf weiße Privilegien, was aber nicht mit (denen vom) Weißsein identisch sind. Anders als weiße Menschen werden Menschen im white-passing zugleich rassistisch diskriminiert, und entsprechende Privilegien liegen nicht gesichert vor. Die rassistische Diskriminierung kann sich dabei subtil vollziehen. Eindringliche weiße Blicke etwa scannen eine Person, weil sie kategorisieren, dass diese Person keine weiße Person ist, dies aber nicht so einfach wie sonst an den einstudierten Kriterien festmachen können. Für die betreffende Person sind das keine zufälligen, nur neugierigen Blicke – sondern alltägliche Mikroaggressionen. Umgekehrt gehört es zum Erfahrungsspektrum des white-passings, dass Rassismuserfahrungen nicht ernst genommen werden (etwa auch von anderen rassistisch Diskriminierten).
Zum Gesamtbild des Passings gehört, dass es People of Color gibt, die so erzogen werden oder sich selbst so positionieren, als seien sie weiß – oftmals ohne dass sich das 100%ige Dazugehörig-Gefühl entsprechend einstellen könnte. Zum einen kann das etwa beinhalten, dass Menschen in einem weißen Haushalt aufwachsen und die weiße Herkunftsfamilie den BIPoC-Elternteil (oder Großelternteil) verschweigt. Zum anderen gehört es zum möglichen Erfahrungsspektrum von Personen, die im Passing des Rassismus leben, dass sie aus den eigenen rassistisch diskriminierten Familien oder Communities nicht vollauf als dazugehörig an- und wahrgenommen werden – nicht zuletzt aus dem Teile-und-herrsche-Prinzip des Colorismus heraus wird dann aus einem vermeintlichen Weniger an rassistischer Diskriminierung ein Mehr an Isolierung. Bei Menschen of Color mit Albinismus, deren Haut und Haar zwar hell sein mögen, die aber trotzdem als BIPoC gelesen und rassistisch und oft auch ableistisch diskriminiert werden, ist der Fall noch einmal anders gelagert.
Dieses white-passing ist etwa auch im Kontext der Positionierung jüdischer Menschen im Rassismus ein zentraler Diskussionspunkt. Im Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit wurden Jüd*innen weithin als schwarz oder, in diabolischen/orientalistischen Kategorien, etwa als r. rassialisiert. Nachdem ihnen jedoch im 19. Jh. die meisten europäischen Staaten volle Bürger*innenrechte gegeben hatten, wurden sie (in klaren Grenzen) Teil dieser weißen Nationenkörper (selber aber zumeist keineswegs in die Machtposition weiß gesetzt, sondern in einem diffusen ‹Weiß› verortet, das Rassismus ausgesetzt blieb). Diese Einbindung ins Weißsein und Weißsein wurde im NS wieder rückgängig gemacht, jedoch auch dort ambivalent. Arischsein galt als Krone der weißen Schöpfung, wobei der NSWeiße in viele ‹Unterrassen› aufspaltete. Dabei wurden jüdische Menschen teilweise widersprüchlich verortet, und es wurde debattiert, ob sie eine minderwertige ‹weiße Rasse› oder keine ‹weiße Rasse› seien.
Unter geänderten Vorzeichen wird diese Frage bis heute kontrovers diskutiert. So wird zwischen Schwarzen oder orientalistisch diskriminierten Jüd*innen einerseits und Jüd*innen, die sich im white-passing bewegen, andererseits unterschieden. Jedoch wäre es m.E. die falsche Schlussfolgerung, von weißen Jüd*innen zu sprechen. Denn jüdische Menschen sind nicht Teil der white supremacy. Deswegen ziehe ich für dieses Buch die Schlussfolgerung, alle Jüd*innen unter dem Begriff PoC zu subsumieren – wohl wissend, dass es im PoC- bzw. BIPoC-Konstrukt selbst zu intersektionellen Überlagerungen kommen kann. Und was den Begriff Jude selbst angeht: Ursprünglich leitet sich das deutsche Wort ‹Jude/Jüdin von hebr. יהודי/Jehudi, Bewohner*innen des Landes Jehuda, ab. Antijudaismus und Antisemitismus jedoch beschädigten diese Selbstbezeichnung. Auch wenn es teilweise als Selbstbezeichnung verwendet wird, bleibt es historisch belastet, wenn nichtjüdische Personen diesen Begriff verwenden. Deswegen kürze ich das Wort Ju. in direkten Zitaten ab (als Ju. und nicht nur als J., weil dies das Signum war, das der NS jüdischen Menschen aufzwang) und spreche andernfalls von jüdischen Menschen oder Jüd*innen.
Die begrifflichen Widerstandskonzepte PoC, BPoC, BIPoC, jüdische Menschen sind also ebenso integrativ wie fluide. Deswegen ist es ebenso möglich wie unerlässlich, in gegebenen Kontexten so genau wie möglich zu benennen, um welchen Rassismus und um welche rassistisch diskriminierten Kollektive es geht – also etwa Schwarze oder muslimische Personen. So kann die jeweils spezifische Diskriminierungs- oder Widerstandsgeschichte benannt werden. Zudem scheint es mir möglich, BIPoC um weitere Kategorien (etwa Je für Jews/Jewish, also BIJePoc) zu ergänzen. Da jedoch Widerstandsbezeichnungen aus aktivistischen Bewegungen und entsprechenden Forschungen und Diskussionen heraus etabliert werden, kann ich als weiße, christlich sozialisierte Autorin diese Begriffsvarianten hier nicht einfach umsetzen – sondern nur als Optionen in den Diskurs einbringen.
Dass sich in der deutschen Sprache viele dieser antirassistischen Vokabeln aus dem angloamerikanischen Widerstand etabliert haben, empfinden manche als Ärgernis. Ärgerlich ist es aber nur, weil aus diesen Anglizismen spricht, dass die Widerstandsbewegung in Deutschland inmitten des viel zu lauten Schweigens über Rassismus zu stark um Gehör kämpfen musste, um schon eine eigene Sprache entwickelt haben zu können – und sich eben deswegen auch an der Schwarzen Widerstandsbewegung in den USA oder im Vereinigten Königreich orientiert, orientieren muss. Eine sprachübergreifende Vokabel wiederum zeigt aber auch, dass nicht nur Rassismus ein ursprünglich paneuropäisches Projekt ist, das die Welt prägte, sondern dass auch die Antwort darauf eine globale sein kann, ja sein muss. Manche ärgert aber ebendies. Sie wollen vordergründig keine englische Vokabel verwenden, aber nur, um sich hintergründig hinter dem Deutschen «So etwas haben wir hier nicht» zu verstecken. So berechtigt es sein mag, englische Sprachübernahmen zu kritisieren, relativiert sich andererseits die Angst vor Anglizismen oder Denglisch angesichts der Tatsache, wie schnell im deutschsprachigen Raum im März 2020 Vokabeln wie Shutdown und Social Distancing zum Alltagswortschatz wurden – ganz zu schweigen von englischen Wörtern, die englische Muttersprachler*innen gar nicht verstehen würden, wie etwa Handy. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Zudem gibt es ja Schwarze Deutsche, Afrodeutsche, Türkisch*Deutsche, chinesische Deutsche etc. als deutschsprachige Angebote im Kampf um ein rassismusfreies Benennen – wann immer es relevant ist, Positionalitäten im Rassismus anzusprechen. Dabei wird bewusst auf Bindestriche wie etwa in ‹African-American› verzichtet, weil diese einer additiven und polaren Containerkonstruktion das Wort reden, statt bestehende Komplexitäten und Überlagerungen zu erfassen. Dafür stehen etwa African American, afrodeutsch oder Kompositionen mit Adjektiven oder Asterisken.
5. Warum die Begriffe ‹Ausländer-› oder ‹Fremdenfeindlichkeit› sowie ‹positiver Rassismus› unzutreffend sind
Vor dem Hintergrund der vorgestellten Rassismusdefinition weisen die Begriffe ‹Ausländer-› oder ‹Fremdenfeindlichkeit› in die falsche Richtung. Suggerieren sie doch, dass es eine vermeintliche anthropologische Grundkonstante gäbe, die bewirke, dass der Kultur der Anderen (Fremden) nahezu reflexhaft feindselig begegnet werde. Doch dies ist keineswegs eine unumstößliche Gegebenheit. Und im Kern geht es bei der herkömmlichen Rede von Fremden- oder Ausländerfeindlichkeit nicht um Ausländer*innen oder Fremde, sondern um Menschen, die als solche konstruiert werden. Weiße Brit*innen in Deutschland etwa sind ja gar nicht mitgemeint, türkische Deutsche aber schon, obgleich sie im Gegensatz zu Ersteren gar keine Ausländer*innen sind. Als Fremde erscheinen sie allein, wenn weiße Menschen eine mehr oder minder klare Vorstellung vom Eigenen haben und davon, dass etwa Deutschsein und Islam, Deutschsein und Schwarzsein oder Deutschsein und chinesische Herkünfte unvereinbar seien. Dabei zeigt sich, dass sich die Vokabeln ‹Ausländer/Ausländerin› und ‹Fremde› als rassistische Synonyme für BIPoC etabliert haben. Damit werden ‹Ausländer› und ‹Fremde› zu gefährlichen Kategorien, weil sie das Denken aufgreifen und fortschreiben, dass Menschen, die so bezeichnet werden, tatsächlich Ausländer*innen oder Fremde im Sinne von nicht zugehörig (oder berechtigt, Rechte und Privilegien wahrzunehmen) seien. Das aber ist Rassismus – und der geht eben auch über die zweite Worthälfte von Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit hinaus: Feindlichkeit.
Zwar könnte mensch meinen, dass die Begriffe ‹Ausländer-› und ‹Fremdenfeindlichkeit› zumindest exakt beschreiben, was etwa die NSU-Mordserie oder Parolen der Alternative für Deutschland (AfD) ausmacht. ‹Feindlichkeit› verharmlost dabei aber die systematisch verfolgten Ziele des extremen Rassismus. Zudem verschleiert dieser Begriff, wie sehr diese Gewalt mit strukturell-institutionellem Rassismus sowie mit Alltagsrassismus verbunden ist – gerade auch jenem, der jeden Vorwurf der Feindlichkeit von sich weisen würde: etwa wenn vermeintlich wohlwollend Komplimente über Haut, Haar, Rhythmusgefühl oder Sexualität gemacht werden oder auch wenn eine weiße Person vermeintlich hilft, jedoch eigentlich paternalistisch agiert (ich helfe dir mal, weil du das nicht können/wissen kannst – und was dir hilft, das weiß ich sogar besser als du). Auch hierin ist letztlich die Annahme am Werk, die die Kategorie ‹Rasse› zusammenhält: nämlich dass Menschen einerseits (somatisch) kartiert werden könnten und dass dies an geografische, kulturelle oder religiöse Herkünfte gebunden werden könne. So, als könnte dieses Bündel tatsächlich darüber Auskunft geben, ob eine Person bestimmte Dinge (nicht/besser) kann oder zu einer als Nation konstruierten Gesellschaft gehört (oder eben auch nicht).
Tatsächlich ist Rassismus viel mehr, als feindlich eingestellt oder auch nur ‹gegen› jemanden zu sein. Rassismus wirkt systemisch, und daher geht es bei Rassismus um die gesamte Palette von Handlungen, die sich daraus ergeben, dass sich eine weiße christlich konstruierte Norm(alität) von ‹seinem Anderen
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: