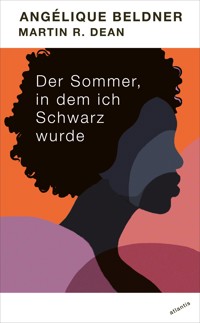19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es sind die stereotypen Darstellungen Schwarzer Menschen in Kinderbüchern. Die Menschen, die ihr ungeniert in die Haare fassten. Die gut gemeinten Ratschläge, sich anzupassen. Rassismus hat viele Gesichter. Angélique Beldner begegnete ihnen im Lauf ihres Lebens immer wieder: bei der Jobsuche, beim Arztbesuch, auf offener Strasse, in der Familie und bei Unbekannten. Als Angélique Beldner 1976 geboren wird, können sich viele Menschen nicht vorstellen, dass Rassismus auch in der Schweiz existiert. Für sie ist Rassismus das, was der Kolonialismus angerichtet hat oder was Schwarze Menschen in Südafrika während der Apartheid erleben. Doch er ist da, und Betroffene spüren ihn täglich in unterschiedlichsten Formen. Im Blick zurück auf ihre eigene Lebensgeschichte untersucht die Autorin, wie sich die Wahrnehmung von Rassismus in der Schweiz und der Umgang damit seit den 1970er-Jahren verändert hat. Von den «Überfremdungsinitiativen» über die Einführung der Rassismusstrafnorm bis Black Lives Matter folgen wir einem langsamen Erwachen der Schweizer Gesellschaft. Und einer Frau, die ihre Stimme findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Es sind die stereotypen Darstellungen Schwarzer Menschen in Kinderbüchern. Die Menschen, die ihr ungeniert in die Haare fassten. Die gut gemeinten Ratschläge, sich anzupassen. Rassismus hat viele Gesichter. Angélique Beldner begegnete ihnen im Lauf ihres Lebens immer wieder: bei der Jobsuche, beim Arztbesuch, auf offener Strasse, in der Familie und bei Unbekannten.
Als Angélique Beldner 1976 geboren wird, können sich viele Menschen nicht vorstellen, dass Rassismus auch in der Schweiz existiert. Für sie ist Rassismus das, was der Kolonialismus angerichtet hat oder was Schwarze Menschen in Südafrika während der Apartheid erleben. Doch er ist da, und Betroffene spüren ihn täglich in unterschiedlichsten Formen.
Im Blick zurück auf ihre eigene Lebensgeschichte untersucht die Autorin, wie sich die Wahrnehmung von Rassismus in der Schweiz und der Umgang damit seit den 1970er-Jahren verändert hat. Von den «Überfremdungsinitiativen» über die Einführung der Rassismusstrafnorm bis Black Lives Matter folgen wir einem langsamen Erwachen der Schweizer Gesellschaft. Und einer Frau, die ihre Stimme findet.
Foto AyṢe YavaṢ
Angélique Beldner, geboren 1976 in Bern, ist Newsjournalistin und Fernsehmoderatorin. Sie moderiert die wöchentliche SRF-Quizshow «1 gegen 100». Die ausgebildete Typografin und Schauspielerin hat ausserdem einen Master of Advanced Studies in Communication Management and Leadership. Zusammen mit Martin R. Dean publizierte sie 2021 das Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde». Angélique Beldner lebt in Bern.
ANGÉLIQUE BELDNER
RASSISMUS IM RÜCKSPIEGEL
Für Tieni & Thabo
Prolog
Hier schon mal eine grosse TRIGGERWARNUNG. Dieses Buch ist voll von reproduziertem Rassismus. Für meine Geschichte lässt sich das nicht vermeiden. Achte beim Lesen auf deine Gefühle und lege es besser für eine Weile weg, wenn du merkst, dass es dir nicht guttut. Ich versuche, so behutsam wie möglich zu sein und gewisse Wörter nicht auszuschreiben, wenn es auch anders geht. Doch um sich bewusst zu machen, was sein soll, müssen wir erkennen, was ist, und sehen, was war. Und dazu müssen wir es manchmal auch benennen.
Und so fängt dieses Buch an mit einem Auszug aus der Kasperligeschichte «De Schorsch Gaggo reist uf Afrika» von 1970:
«‹Ja potz Holzlöffel und Zipfelchappe – was gseht denn da der Chaschper, was? Jä so öppis Härzigs: es N-Meiteli! Das hätt dänn luschtegi Chruseli ufem Chopf. Das isch jetz äbe es richtigs schnuseli nuscheli N-Chindli. Chum, mir säged dem emal Grüezi. Sali Chruseli-N-li. Wie heissisch dänn du?›
‹Äisse Susu, wi äisse du?›
‹Das N-li schwätzt ja chinesisch. Das Kuddelmuddel verstaht ja kän Mänsch.›»1
Das ist die Zeit, in die ich hineingeboren wurde. Eine Zeit, in der man ein «schnusiges N-Meiteli aus Afrika» ganz süss fand, selbst wenn es «Kauderwelsch» sprach. Eine Zeit, in der man sich lustig machte über Menschen mit grossen Lippen, breiten Nasen und krausen Haaren. Eine Zeit, in der kleine Kinder vor Menschen, die so aussahen, manchmal Angst hatten. In der sie «Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?» spielten und im Kindergarten sangen:
«Zehn kleine N-lein schlachteten ein Schwein; einer stach sich selber tot, da blieben nur noch neun. Neun kleine N-lein, die gingen auf die Jagd; einer schoss den andern tot, da waren’s nur noch acht … »
Die Kinder lachten und hüpften zur Melodie im Kreis. Witzig fand ich das nicht. Mitgelacht habe ich trotzdem.
Ja, es war eine andere Zeit. Man machte sich über diese Dinge keine Gedanken. Alle erzählten diese Geschichten, alle spielten diese Spiele, alle sangen diese Lieder. Es war nicht böse gemeint. Es war gar nicht gemeint. Doch für einige Menschen war es schon damals schmerzvoll. Und das liegt daran, dass diesen Liedern, Spielen, Geschichten eine falsche Annahme zugrunde liegt: die Annahme, dass nicht alle Menschen gleichwertig sind. Sie spiegelt ein Gefälle wider, das sich über viele Jahrhunderte entwickelt hat.
Viele Menschen wollen nicht hinsehen, vielleicht können sie es auch nicht. Doch dank jener, die bereit sind, hinzusehen, verändern sich Dinge. Warum empfinden wir die Geschichte des Schwarzen Mädchens Susu bei Kasperli heute als äusserst fragwürdig, gar als rassistisch? Weshalb werden die heutigen Geschichten anders geschrieben? Und weshalb hat es so lange gedauert, bis sie anders geschrieben wurden? Was geschieht, dass sich Dinge verändern? Was geschieht, dass sie sich oft nur langsam ändern? Und warum ändern sich einige gar nicht?
Dieses Buch ist eine Suche nach Antworten auf diese Fragen. Ich begebe mich auf eine Zeitreise. Ich betrachte den Rassismus im Rückspiegel meiner rund fünfzig Lebensjahre in einem Land, das von Rassismus betroffen ist, dies aber lange nicht merkte. Ein Rückblick aus meiner Perspektive, subjektiv und unvollständig, aber ehrlich. Das ist mein Anspruch. Es sind meine Gedanken, meine Überlegungen, meine Erinnerungen. Manchmal durch die Brille betrachtet, die ich zur jeweiligen Zeit trug – mit Kinderaugen, mit den Augen einer jungen Frau, später mit den Augen einer Journalistin. Manchmal mit einem Schleier vor den Augen, manchmal erhellt und aufgewacht. Beschriebene Ereignisse sind aus dramaturgischen Gründen nicht zwingend chronologisch erzählt. Einige Ereignisse wurden leicht abgeändert, damit keine Rückschlüsse auf konkrete Personen gezogen werden können.
Bei Rassismus spricht man heute neben anti-Schwarzem Rassismus vor allem auch von antimuslimischem Rassismus, antiasiatischem Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus (Rassismus gegen Jenische, Sinti / Sintize / Manouches, Roma / Romnja und Fahrende) und Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit). Die verschiedenen Formen werden in diesem Buch teilweise gestreift, mehrheitlich geht es aber um anti-Schwarzen Rassismus. Denn dies ist – neben der Fremdenfeindlichkeit, die lange mit Rassismus gleichgesetzt wurde – die einzige Form, über die ich aus persönlichen Erfahrungen berichten kann. Dass ich den Rassismus, den ich erlebt habe, fast mein ganzes Leben lang kaum thematisiert habe, hat unterschiedliche Gründe. Ich denke, dass man sie im Laufe dieses Buchs zu verstehen beginnen wird. Zwei davon möchte ich hier aber bereits vorwegnehmen. Der eine hängt damit zusammen, dass ich mir meiner Privilegien immer bewusst war. Die meisten People of Color machen Erfahrungen mit Rassismus. Doch andere weit mehr und schlimmere als ich. Jüngere sind mehr von Rassismus betroffen, Menschen, die nicht in der Schweiz geboren wurden, ebenfalls. People of Color mit dunklerer «Hautfarbe» werden mehr diskriminiert als solche mit einem helleren Hautton, muslimische hier in der Schweiz wohl mehr als christliche, anderssprachige in der Deutschschweiz mehr als deutschsprachige, Männer erleben Rassismus teilweise anders und insgesamt etwas mehr als Frauen. Lange glaubte ich, es sei unangebracht, mich zu meinen Rassismuserfahrungen zu äussern. Ausserdem wollte ich nie, dass man denken könnte, ich sei wegen ihnen unglücklich gewesen. «Ich dachte, du seist ein glückliches Kind gewesen», kommentierte meine Mutter eine meiner Negativerfahrungen. Ja, das war ich. Und genau deshalb fällt es mir auch so schwer, mich mit meiner Schwarzen Geschichte in der Retrospektive auseinanderzusetzen. Denn ich weiss, dass man sie lesen kann, als hätte ich nur Schmerz erfahren. Das Gegenteil ist der Fall. Ich war ein glückliches, gesundes, umsorgtes Kind in einer wohlbehüteten und liebevollen Umgebung. Und ich wurde auch meistens gut behandelt. Die wenigsten beschimpften mich rassistisch oder grenzten mich bewusst aus. Aber um Rassismus verstehen zu können, muss man seine Mechanismen begreifen. Ich kann Rassismus erfahren und trotzdem ein glückliches Kind sein. Das heisst nicht, dass ich nicht darunter leide.
Rassismus nimmt Menschen Möglichkeiten. Rassismus kann krank machen. Rassismus kann töten. Rassismus ist Macht. Und Rassismus ist Ohnmacht. Wie können wir ihn bekämpfen? Indem wir ihn zeigen, doch dafür müssen wir ihn erst sehen. Indem wir ihn benennen, doch dafür müssen wir ihn erst verstehen. Und indem wir uns eingestehen, dass wir zwar vielleicht unschuldig sind, es aber nicht bleiben, wenn wir weiterhin wegsehen. Ein grosser Teil der Problematik liegt in den Strukturen, die wir über Jahrhunderte entwickelt haben. Dafür können wir nichts. Doch wir können etwas dafür, wenn wir an diesen Strukturen nichts ändern.
Das Buch ist nach «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde» bereits das zweite, in dem ich mich mit meiner eigenen Rassismusgeschichte befasse. Ich habe lange damit gehadert. Denn um Rassismus zu verstehen, sollten keine individuellen Erfahrungsberichte nötig sein. Rassismus ist nichts Individuelles. Er ist etwas Strukturelles. Sich damit auseinanderzusetzen, ist anstrengend, zehrend. Deshalb kann es helfen, wenn man nicht auf Anhieb bei sich selbst hinschauen muss, sondern erst mal bei anderen hinschauen darf. Und so steht meine Geschichte stellvertretend für viele andere Menschen in diesem Land und anderswo, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und immer noch machen, und für die Menschen, die sie vielleicht noch machen werden. Es ist eine Geschichte für dich, die Rassismus erlebt, oder für dich, deren Freundin, Freund, deren Kind oder Enkelkind, deren Arbeitskollege Rassismus erlebt. Oder für dich, der denkt, dass er nicht davon betroffen ist, den es aber trotzdem etwas angeht. Denn: Rassismus geht uns alle an.
Die Sprache als Zeugin der Zeit
Das N-Wort und der Umgang damit zeigen beispielhaft, wie sich Sprache verändert. Ursprünglich vom französischen nègre und vom spanischen und portugiesischen negro entlehnt als Bezeichnung für Menschen «dunkler Hautfarbe», verbreitete sich der Begriff im Deutschen mit dem Aufkommen der Rassentheorien im 18. Jahrhundert und wurde während des Sklavenhandels verwendet. Es ist also historisch betrachtet ein zutiefst rassistisches Wort. Doch da es über Jahrhunderte der allgemein gebräuchliche Begriff zur Beschreibung Schwarzer Menschen war, wurde er kaum hinterfragt und praktisch alternativlos verwendet. Während meiner Kindheit in den 1980er-Jahren galt er bereits als verpönt. Ich hörte ihn dennoch regelmässig. Manchmal fiel er unüberlegt, manchmal fiel er, weil man gerade keine passende Alternative zur Hand zu haben schien, manchmal fiel er zusammen mit einer Erklärung, die meist lautete, er komme ja vom englischen und spanischen negro, was nichts anderes bedeute als «schwarz». Und manchmal wurde das Wort ganz bewusst gewählt, weil Sprache noch keinen Rassisten ausmache, weil man sich den Mund nicht verbieten lassen wolle, und manchmal sogar, um jemanden bewusst zu kränken. Je mehr wir über Rassismus lernten und je sensibilisierter wir damit umgingen, desto aufmerksamer wurde auch unser Umgang mit der Sprache. Und so verschwand das N-Wort allmählich aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Immer mehr Menschen verzichteten auf seine Verwendung. Mit der Zeit kamen Alternativen leichter über die Lippen, und das N-Wort hatte es immer schwerer. Irgendwann wurde schief angeschaut, wer daran festhielt. Man verwendete es zwar nicht mehr im Alltag, aber noch immer beim Zitieren, bis man irgendwann anfing, es auch in Zitaten nicht mehr zu reproduzieren und stattdessen «N*» oder eben «N-Wort» einzusetzen. Nur noch selten höre ich heute Menschen sagen, sie seien doch hier nicht «der N*», wenn sie sich für eine Arbeit zu schade sind, oder «Ich fühlte mich wie der N* im Umzug», um zu betonen, dass sie schlecht behandelt wurden. Diese Menschen werden immer weniger, und jene, die solche Aussagen nicht mehr unkommentiert stehen lassen, werden mehr und lauter.
Die Sprache verändert sich und sie wird sich immer verändern. Sie ist Teil der gesellschaftlichen Entwicklung und sie ist auch Zeuge davon. Deshalb ist es mir wichtig, auf meiner rassismuskritischen Reise auch die Sprache und deren Entwicklung zu berücksichtigen. Wenn ich in diesem Buch Begriffe und Formulierungen verwende, die ich entweder mit heutigem Wissensstand oder persönlich als unpassend, rassistisch oder aus anderen Gründen als zu wenig sprachsensibel erachte, setze ich sie in Anführungszeichen. Schreibe ich Schwarz gross, meine ich nicht die «Hautfarbe», sondern die gemeinsame Erfahrung, die People of Color machen. Deshalb bezeichnen sich auch Menschen als Schwarz, die relativ hell sind. Schwarz ist eine Selbstbezeichnung und gilt heute als passender Begriff für Menschen, die von anti-Schwarzem Rassismus betroffen sind. In der Schweiz benutzbare Alternativbegriffe sind PoC (Person oder People of Color), Woman / Women oder Man / Men of Color, BIPoC (Black, Indigenous, People of Color), Afroschweizer:in, Menschen von African Descent. Weiss in Bezug auf «Hautfarbe» steht kursiv, weil es auch hier nicht primär um den Farbton der Haut geht, sondern um die damit verbundene Position in der Gesellschaft.
Ich verwende überholte Sprache manchmal bewusst, um zu illustrieren, wie man sich zu jener Zeit ausdrückte. Darunter fallen Formulierungen für Menschen of Color wie «Farbige» oder «Dunkelhäutige». Begriffe, die lange als unproblematisch galten, heute jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht mehr verwendet werden sollten. Sie gelten als Fremdbezeichnungen, die das vermeintlich Andere hervorheben, und daher aus heutiger Perspektive als rassistisch.
Da sich Sprache stets weiterentwickelt, ist es gut möglich, dass vielleicht bald auch Begriffe, die wir heute verwenden, als nicht mehr zeitgemäss gelten. Die Sprache ist immer eine Zeugin ihrer Zeit. Die Zeit steht nicht still, und das ist auch gut so.
Am Ende des Buches findest du ein Glossar, das wichtige Begriffe aufnimmt und nach heutigem Wissensstand erklärt und einordnet.
1970ER-JAHRE
Die weisse Schweiz der 1970er-Jahre
«Die weisse Schweiz» klingt komisch. Es klingt, als wäre da etwas, das wert wäre, es hervorzuheben. Natürlich sollte es das nicht sein. Doch wollen wir den Rassismus in der Schweiz verstehen, müssen wir es betonen: Die Schweiz der 1970er-Jahre war fast durch und durch weiss. So wie die meisten anderen europäischen Länder auch. Die meisten Menschen in der Schweiz hatten einen Schweizer Pass. Die meisten Paare lebten in heteronormativen Beziehungen und heirateten früher oder später, die meisten Ehepaare bekamen irgendwann Kinder und blieben ihr Leben lang zusammen. Die meisten Männer gingen arbeiten, die meisten Frauen blieben zu Hause und kümmerten sich um die Kinder und den Haushalt. 1971 wurde den Schweizer Frauen an der Urne gerade erst das nationale Stimm- und Wahlrecht gewährt, was der Schweiz den Ruf als rückständiges Land einbrachte. Ich fand es eigentlich nie erstaunlich, dass es so spät geschah. Denn schliesslich konnten über das Stimm- und Wahlrecht der Frauen ja nur die Männer abstimmen – jene also, die Macht abgeben mussten.
Etwas mehr als sechs Millionen Menschen lebten in der Schweiz, davon waren rund eine Million Ausländerinnen und Ausländer. Die Zahl jener mit einem Pass aus einem der über 50 afrikanischen Staaten lag bei gerade mal 5000. Oder anders gesagt: Im Jahrzehnt, in dem ich geboren bin, gab es in der Schweiz so gut wie keine Menschen afrikanischer Herkunft. Die Herkunft allein lässt freilich nicht auf die «Hautfarbe» schliessen. So waren bestimmt nicht alle Angehörigen eines afrikanischen Landes Schwarze, dafür gab es Schwarze, die keinen afrikanischen Pass besassen, sondern vielleicht einen US-amerikanischen, einen dominikanischen, einen brasilianischen, einen französischen, einen Schweizer Pass oder den eines anderen Landes. Doch wo auch immer sie herkamen und was auch immer ihre Staatsangehörigkeit war: Es können nur ganz wenige gewesen sein. Und die wenigen, die es gab, blieben oft unter sich.
Für Schweizerinnen, die in Erwägung zogen, einen «Ausländer» zu ehelichen, gab es eine eigens dafür eingerichtete Beratungsstelle. In einem Bericht des Schweizer Fernsehens aus dem Jahr 1970 werden Ratschläge erteilt:
«Wer einen Ausländer heiratet und vielleicht irgendwann mit ihm in seinem Heimatstaat leben will oder muss, sollte sich unbedingt vor der Heirat möglichst genau über die dortigen Verhältnisse, einschliesslich der Rechtsordnung, erkundigen. Man muss wissen, welche Stellung die Frau nach dem Heimatrecht des Mannes im Familien- und Erbrecht hat und welche Sitten und Bräuche in seinem Land herrschen. Das gilt natürlich besonders für Mädchen, die einen Orientalen oder Afrikaner heiraten wollen.»2
Eine in der Sendung interviewte Beraterin sagt: «Ehrlich gesagt: Ich begreife jedes Mädchen, das sich in einen Afrikaner oder Asiaten verliebt. Unsere Schweizer Männer kommen gegen deren Charme und manchmal auch gegen deren unmittelbare Menschlichkeit nur schwer an. Das Gefährliche daran ist allerdings, dass solche Paare dann das Gefühl haben, sie verstünden sich wunderbar gut, und sie merken gar nicht, wie ganz verschieden ihre Denkart ist.»
Ich kann nur erahnen, wie es damals in der Schweiz für ein junges, verliebtes, binationales Paar gewesen sein muss, wenn es vorhatte, sein Leben zusammen zu verbringen, und denke dabei auch an meine Eltern. Doch dazu später.
In der Schweiz werden Daten darüber erhoben, welche Staatsangehörigkeit die Menschen haben, welcher Religionsgemeinschaft sie angehören, welche Sprachen sie sprechen. Darüber, welche «Hautfarbe» sie haben, existieren bis heute aber lediglich Schätzungen. Dasselbe gilt für die ethnische Zugehörigkeit. Allerdings steht die Schweiz damit keineswegs allein da. Die wenigsten europäischen Länder haben entsprechende belegbare Zahlen. In Frankreich ist es sogar verboten, Daten zu ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder «Hautfarbe» zu erheben: Das Gesetz sichert die Gleichheit aller Bürger:innen «ohne Unterscheidung nach Herkunft, ‹Rasse› oder Religion». Tatsächlich wurden diese Daten in der Vergangenheit in einigen Ländern aus rein rassistischen Motiven statistisch erfasst, so etwa während der Apartheid in Südafrika. Einige Expert:innen warnen, die Hervorhebung von Merkmalen einer bestimmten Gruppe trage zu ihrer Stigmatisierung bei. Auch sind ethnische Kategorien schwierig zu definieren. Und in den falschen Händen können Daten zur ethnischen Zugehörigkeit zu einer Gefahr für marginalisierte Gruppen werden. Es gibt also durchaus nachvollziehbare Gründe, auf solche Erhebungen zu verzichten. Andererseits erschwert es die Auseinandersetzung mit Diskriminierungen, wenn wir nicht wissen, von welchen Zahlen wir ausgehen müssen. In Grossbritannien wird die Zahl statistisch erfasst: Etwa 18 Prozent der Bevölkerung dort sind «nicht Weisse». Grossbritannien nutzt diese Daten, um einerseits Minderheiten sichtbar zu machen, aber auch, um rassistische Strukturen erkennen und abbauen zu können.
In Ländern mit einem so kleinen Anteil «Farbiger» – so nannte man sie damals oft – wie der Schweiz dachte man in den 1970er-Jahren kaum über Rassismus nach, tat ihn sogar als inexistent ab. Man hatte eine klare Vorstellung davon, was Rassismus war. Rassismus war das, was die Kolonialmächte in den afrikanischen Ländern angerichtet hatten. Damit hatte die Schweiz – so die Überzeugung – rein gar nichts zu tun. Die Schweiz war nie Kolonialmacht gewesen. Also musste sie sich auch nicht im gleichen Masse damit auseinandersetzen. Der Kolonialismus hat aber seine Spuren hinterlassen. Und diese Spuren liegen auch in der Schweiz.
Als man allmählich anfing, die kolonialen Verstrickungen der Schweiz aufzuarbeiten, konnte ich nicht so viel damit anfangen. Ich erinnere mich an die ersten Artikel zum Thema, die ich las. Das war mir irgendwie zu abstrakt. Schweiz und Kolonialismus? Als müsste sich mein Hirn auf so einen Erzählstrang erst einstellen. Das Thema ist zudem hochkomplex. Die ersten öffentlichen Auseinandersetzungen damit nahm ich zur Jahrtausendwende wahr, auch wenn die Aufarbeitung in kleineren Kreisen schon vorher begonnen hatte. Damals stand ich persönlich aber in Bezug auf Rassismus an einem ganz anderen Punkt: Ich setzte mich damit grundsätzlich kaum auseinander.
Die Schweiz hatte nie Kolonien besessen. Keine einzige. Und doch war sie diesbezüglich längst nicht so sauber, wie sie sich lange darstellte. Was ich schnell verstand, war, dass die Schweiz sehr wohl auf unterschiedlichste Weise vom Kolonialismus profitiert hatte. So hatte es hier Familien und Unternehmen gegeben, die Handel mit Kolonialwaren betrieben, Söldner, die sich in den Dienst von Kolonialmächten stellten, reiche Schweizer, die in Sklaventransporte investierten, oder solche, die am Dreieckshandel beteiligt waren, bei dem zum Beispiel Schweizer Textilien nach Afrika gebracht und dort gegen Afrikaner:innen getauscht wurden, die als Sklav:innen weiterverkauft wurden. Schweizer «Rassenforscher» trugen dazu bei, den kolonialistischen Hierarchiegedanken mit ihren Theorien zu untermauern. Nun wurde plötzlich Kritik laut an bekannten Schweizern wie Alfred Escher, dem Eisenbahnpionier und Wirtschaftsführer, dessen Familie einen Teil ihres Geldes mit Erträgen auf einer kubanischen Kaffeeplantage gemacht hatte, die von Sklaven bewirtschaftet worden war. Escher selbst hatte mit dieser Plantage nur insofern etwas zu tun, als er später finanziell von deren Verkauf profitierte. Er war kein Sklaventreiber. Wie gesagt: Auch diese Geschichte ist komplex. Klar ist aber, dass die Familie Escher auch dank des Kolonialismus zu Geld kam, von dem letzlich die Stadt Zürich und damit auch die Schweiz profitierte. Alfred Escher war Gründer der Schweizerischen Kreditanstalt, aus der später die Grossbank Credit Suisse wurde. Er legte den Grundstein für Zürichs Finanzplatz. Ihm gehörten mehrere grosse Liegenschaften, die später teils an die Stadt übergingen, darunter der grosse Belvoirpark samt Villa. Eschers Erbe ist ein grosses Erbe. Nach wie vor ziert seine Statue aus dem Jahr 1889 den Zürcher Bahnhofplatz.
Was ich erst viel später zu realisieren begonnen habe, ist, dass man die koloniale Vergangenheit noch heute überall erkennen kann. Am Beispiel von Alfred Escher sehen wir, dass Dinge, die sich vor mehreren Hundert Jahren zugetragen haben, Folgen bis in die heutige Zeit hinein haben. Die kolonialen Spuren zeigen sich auch in historischen Häusernamen, in rassistischen Kinderbüchern und -liedern, in rassistischen Darstellungen auf alten Werbeplakaten. Man sieht sie sogar auf unseren Balkonen: Die Geranien, die zur Schweiz gehören wie die Uhren und der Käse, kommen ursprünglich aus Südafrika. In die Schweiz gelangten sie über Söldner und deren Beziehungen zur Kolonialmacht Niederlande.
Der bis heute vorherrschende Rassismus hat seinen Ursprung in der Kolonialgeschichte. Das Einteilen von Menschen in «Rassen» galt als Rechtfertigung dafür, koloniale Strukturen aufzubauen, indem man die «schwarze Rasse» als minderwertig klassifizierte. Diese Grundhaltung verankerte sich in der Gesellschaft, nicht nur in Ländern mit Kolonien. Es brauchte Jahre, bis ich anfing, diese Zusammenhänge zu begreifen.
Das alles wird nun seit einigen Jahren aufgearbeitet. In den 1970er-Jahren aber war man weit davon entfernt. In meiner Recherche für dieses Buch durchforstete ich unzählige Zeitungsartikel von 1970 bis heute unter anderem nach dem Begriffspaar «Rassismus und Schweiz». Wenn man bedenkt, dass das Wort «Rassismus» 1973 erstmals im Duden aufgeführt wurde, wird es kaum erstaunen, dass ich mit den 1970er-Jahren äusserst schnell durch war.
Doch das wenige, das ich fand, beeindruckte mich. Weil ich merkte, dass es immer schon kritische Stimmen gegeben hat. Wie diejenige des Journalisten und Missionars Michael Traber, die ich im «Bieler Tagblatt» vom 26. Februar 1972 entdeckte:
«Rassismus als ethnische Sozialkategorie ist nichts Neues. Neu ist aber, dass Rassismus in den letzten Jahrzehnten zu einem politischen Konzept geworden ist. […] Der traditionelle Rassismus sitzt immer noch tief im Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten, besonders dort, wo sich das Problem Schwarz / Weiss in direkter Konfrontation vorfindet. Demgegenüber aber ist der neue Rassismus als politische Handlungslehre geradezu universal, wenngleich wir erst jetzt daran sind, ihn aufzudecken und ins Bewusstsein zu bekommen. Das Bedeutsame dabei ist, dass ein weltweiter Prozess im Gange ist, wonach Gruppen und Nationen nach dem Kriterium ‹Hautfarbe› polarisiert werden, was für die Zukunft der Welt von entscheidender Bedeutung sein könnte.»
Ich konnte kaum glauben, was ich da las, weil es so fortschrittlich klang für die damalige Zeit. Oder vielleicht auch, weil mir bewusst wurde, dass solche Stimmen damals wohl kaum gehört und vielleicht noch weniger verstanden wurden. Ein weiterer Hinweis darauf, wie unbewandert die Schweiz mit dem Thema war, geben die Fragen in einem Interview mit dem Philosophieprofessor Arnold Künzli im Rahmen der ersten UNO-Weltkonferenz gegen Rassismus in Genf 1978. Seine Antworten dagegen könnten genauso gut einem Interview der heutigen Zeit entstammen.
Journalist: «Nach der UNO-Charta dürfte es Rassendiskriminierung schon lange nicht mehr geben. In der heutigen Diskussion wird allerdings oft mit Begriffen argumentiert, die nicht immer ganz klar sind. Was heisst Rassismus, was Rasse?»
Arnold Künzli: «Rassismus gründet auf dem Vorurteil, dass bestimmte ethnische Gruppen von Natur aus überlegen, andere minderwertig sind. […] Der Begriff Rasse freilich ist etwas fundamental Unwissenschaftliches. Bis heute ist es in Tat und Wahrheit nicht gelungen, den Begriff ‹Rasse› zu definieren. Ursprünglich meinte man damit eine Abstimmungsgemeinschaft, doch Völker mit ‹reiner Rasse› gibt es gar nicht. […]»
J: «Rassismus hat etwas mit Ablehnung, Neid und Hass zu tun, vor allem aber steckt dahinter meist auch Angst.»
AK: «Ja, die Geschichte des Rassismus lehrt, dass rassistische Bewegungen meist in Situationen entstehen, wo gewisse soziale Schichten und Klassen Angst bekommen, von andern verdrängt zu werden. Man nimmt dann Zuflucht zu einem rassistischen Mythos, weil es viel einfacher ist, den Gegner zu diffamieren, wenn er scheinbar von Natur aus zu einer minderwertigen Rolle verurteilt ist. […]»
J: «Die Vermutung liegt nahe, dass Rassismus am besten im Milieu des Kleinbürgertums gedeiht. Neigt nicht der Spiesser ganz besonders zu rassistischen Vorurteilen?»
AK: «Kleinbürgertum und Arbeiterschaft sind höchstens anfällig, Rassismus aber manifestiert sich in Wirklichkeit in allen sozialen Schichten.»3
Ich stiess auch auf einen Artikel über Fahrende, die der Schweiz Rassismus vorwarfen.4 Rund 150 Fahrende waren im Sommer 1978 auf ihrem Weg von Deutschland nach Italien an der Schweizer Grenze aufgehalten und an der Weiterfahrt gehindert worden. Sie kündigten daraufhin an, sich bei der UNO wegen «Rassismus und Engstirnigkeit» beschweren zu wollen. Das Zollamt rechtfertigte sich gegenüber der Zeitung unter anderem mit den Worten, dass man vorsichtig geworden sei, da man «Zigeuner», wie man sie damals noch nannte, oft genug nicht mehr losgeworden sei und sie auf Schweizer Kosten durchgefüttert habe. Diese unverhohlene Reaktion spiegelt eine vermutlich weitverbreitete Meinung.
Artikel zum Thema «Rassismus und Schweiz» fand ich zudem im Zusammenhang mit dem Apartheidregime in Südafrika. Es gab schon da Stimmen, die auch den Umgang der Schweiz damit kritisierten und ihr vorwarfen, vom Apartheidsystem zu profitieren. Denn auch dies assoziierten die meisten Menschen in der Schweiz mit dem Begriff Rassismus: was die Schwarzen Menschen in Südafrika erlebten, wo die Apartheid Schwarz und weiss komplett trennte. Wo es Menschen wie mich mit einem weissen und einem Schwarzen Elternteil offiziell gar nicht geben durfte. Sie waren illegal, denn Schwarz und weiss hatte sich schlicht nicht zu vermischen, geschweige denn, sich zu vermehren.
Und Rassismus war das, was der Schwarzen Bevölkerung in den USA widerfuhr. Während sie dort einen beträchtlichen Teil einer Minderheit ausmacht, ist diese Minderheit in der Schweiz verschwindend klein. In den USA wurden Schwarze Menschen über Jahrhunderte erst versklavt, später zwar toleriert, aber immer noch unterdrückt und diskriminiert. Sie wehrten sich dagegen, lehnten sich auf, kämpften, wurden laut und blieben es bis heute. Grosse Vorkämpfer:innen gegen Rassismus zahlten mit ihrem Leben.
Doch in der Schweiz «andersfarbig» zu sein, hatte eine komplett andere Bedeutung als in den USA oder in Südafrika. Den Rassismus in ihrem eigenen Land sahen die Schweizerinnen und Schweizer nicht. Weil er sich ganz anders abspielte. Hier gab es keine rechtliche Trennung von Schwarz und weiss. Hier brauchten Schwarze keine anderen Toiletten zu benutzen, hier mussten sie sich im Bus nicht auf andere Stühle setzen. Hier durfte niemand aufgrund seiner «Hautfarbe» eine bestimmte Schule nicht besuchen oder bestimmte Geschäfte nicht betreten. Hier wurden Schwarze Menschen nicht bereits rechtlich als Bürger:innen zweiter Klasse gesehen. Hier hatte kaum ein Schwarzer Angst um sein Leben, nur weil er Schwarz war. Und während die Schwarzen in den USA darum kämpften, gleichberechtigt zu sein und als gleichwertig angesehen zu werden, machten es sich wohl die meisten der wenigen Schwarzen in der Schweiz zur Aufgabe, sich so anzupassen und in die Gesellschaft einzureihen, dass sie möglichst nicht auffielen. Wie unsichtbar wir waren, als wir noch wenige waren, zeigt etwa der Fall von Tilo Frey. Sie war die erste Schwarze Frau im Nationalrat. 1971, als erstmals überhaupt Frauen ins Parlament gewählt wurden. Unter den ersten Parlamentarierinnen war also auch eine Schwarze Frau, eine Schweizerin mit einer Mutter aus Kamerun und einem weissen Schweizer Vater. Er soll stets zu ihr gesagt haben, sie solle «weiss sein wie eine Lilie». Weiss und rein wie eine Lilie, so angepasst wie nur möglich. Sie wurde weiss und damit unsichtbar. Rassismus erlebte sie trotzdem. Doch für Aussenstehende war auch dieser unsichtbar. Dass diese Form der Fremd- und auch Selbstunterdrückung eine durchaus verbreitete war, die auch ich mir bereits in meiner Kindheit angeeignet hatte, wurde mir erst viel später bewusst. Auch dass der hier für viele unsichtbare Rassismus eine sehr schmerzhafte Tragweite hat, war mir nicht von Anfang an klar. Nicht weil ich ihn selbst nicht erfahren hätte. Sondern weil ich diese Gefühle unterdrückte, negierte, versteckte und schon früh anfing, sie anzuzweifeln. Wie war das möglich? Heute weiss ich es. Es wurde mir so vorgelebt. Und bestimmt mit keinerlei schlechter Absicht.
Von Grenzen und Ausgrenzung
Schon die Schweiz der 1970er-Jahre war ein Land mit einer langen Migrationsgeschichte, aber bestimmt keines mit einer prägenden Schwarzen Migrationsgeschichte. Wer heute erzählt, wie People of Color Teil der Schweizer Geschichte wurden, fängt meist mit den Fluchtbewegungen der 1980er- oder sogar erst 1990er-Jahre an. Doch die Schwarze Schweizer Geschichte erzählt sich nicht allein durch Fluchtbewegungen. Und sie beginnt auch nicht erst in den 1980er-Jahren. Es gab Menschen afrikanischen Ursprungs, die schon früh in die Schweiz kamen, um hier zu studieren oder zu arbeiten. Es gibt aber auch die unrühmliche Geschichte, die von Völkerschauen erzählt, die bis in die 1960er-Jahre hinein noch stattfanden. Es gab Schweizer Staatsangehörige, die in einem afrikanischen Land arbeiteten und dann ihre Bediensteten von dort mit in die Schweiz brachten. Sie liessen sie hier weiter für sich arbeiten, manche verliebten sich auch, gründeten eine Familie. Und schliesslich ist die Schwarze Schweizer Geschichte auch diejenige von Menschen, die immer schon hier waren. Es sind Menschen wie ich.