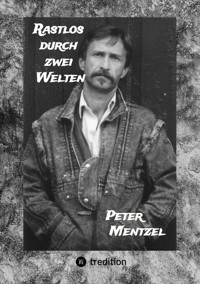
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor begibt sich auf eine episodische Zeitreise durch zwei Mal fünfunddreißig Jahre gelebtes Deutschland. In einunddreißig Kapiteln erzählt er über Abenteuer seiner Kindheit und die erotischen Erlebnisse der frühen Jugend, über sportliche Ambitionen und Leidenschaften eines Heranwachsenden im erzgebirgischem Annaberg-Buchholz. Er erfährt in zwei Ehen Liebe und Lüge, wird Vater zweier Söhne in seinem neuen Umfeld Meißen und muss feststellen, dass die Jahre der Veränderung in der Gesellschaft alles in Frage stellt, was sein Leben ausmachte. Die Ehe zerbricht, die Kinder wachsen in einem fremden Umfeld auf, der Autor sucht nach neuen Wegen und findet sie in der neuen Partnerin, die bald seine dritte Frau wird. Der gewaltsame Tod des älteren Sohnes markiert einen Wendepunkt. Dieses Ereignis wird den weiteren Weg des Autors bis heute bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Peter Mentzel – Rastlos durch zwei Welten
© 2025 Peter Mentzel
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Peter Mentzel, Smetanastraße 18, 01662 Meißen, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Peter Mentzel
Rastlos durch zwei Welten
Eine episodische Zeitreise durch zweimal 35 Jahre gelebtes Deutschland
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Urheberrechte
Titelblatt
Prolog
Kapitel 1 – My Home Town
Kapitel 2 – Erzgebirgswinter
Kapitel 3 – Familie
Kapitel 4 – Schule
Kapitel 5 – Der Skilift
Kapitel 6 – Der Infarkt
Kapitel 7 – Die Band
Kapitel 8 – Mädels
Kapitel 9 – Erfahrungen
Kapitel 10 - Drei Jahre
Kapitel 11 – Zukunft
Kapitel 12 – Leipzig
Kapitel 13 – Sylvina
Kapitel 14 – Veränderungen
Kapitel 15 – Meißen
Kapitel 16 – Angekommen
Kapitel 17 – Verwirrungen
Kapitel 18 – Wandel
Kapitel 19 – Revolution
Kapitel 20 – Umbruch
Kapitel 21 – Videoclub
Kapitel 22 – Bruch
Kapitel 23 – Jena
Kapitel 24 – Back Home
Kapitel 25 – Freunde
Kapitel 26 – Biker
Kapitel 27 – Canada
Kapitel 28 – Rückblick
Kapitel 29 – Söhne
Kapitel 30 – MGB
Kapitel 31 – Gegenwart
Epilog
Zum Autor
Quellenverzeichnis:
Rastlos durch zwei Welten
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Prolog
Quellenverzeichnis:
Rastlos durch zwei Welten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
Prolog
Fünfunddreißig Jahre ist es her, als ein Herr Schabowski den Halbsatz murmelte: „…nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich…“.
Das Unvorstellbare wurde Realität, bei vielen Leuten musste diese Äußerung erst sacken, andere begriffen schneller, setzten sich in ihren Trabi und fuhren zu den Grenzübergängen. Jeder durfte plötzlich in den Westen reisen, ohne Gefahr, sein Leben zu riskieren oder seine Familie in den Ruin zu führen.
Fünfunddreißig Jahre. Genauso lange lebte ich in der DDR.
Grund genug, um sich zu erinnern, wer ich in meiner Kindheit, meiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter war und wie sich die Veränderungen während und nach der politischen Wende auswirkten.
Ich mag es nicht, wenn Dokumentationen, Filme oder Bücher das Leben in der DDR auf Stasi, Mauertote und fehlende Reisefreiheit heruntergebrochen wird Kurz nach der Wende gab es noch lustige Filme wie „Go, Trabi, Go“, es wurde gelacht über die Macken der Bürger hier und dort. Später wurden die Storys immer düsterer. Man kam und kommt sich manchmal in der Gegenwart bei Fragen von Kindern oder Jugendlichen vor, als würden sie uns bedauern, weil wir in Kellern oder Höhlen hausen mussten und nichts vom Licht der Welt wussten.
Aber war unser Leben bis zum Jahr 1989 tatsächlich nur auf materielle Dinge wie Reisen, Autos und fehlende Luxusartikel beschränkt?
Nein, das war es nicht. Wir lebten als Kinder unbekümmert und fröhlich in unserer kleinen Stadt im Erzgebirge, hatten jede Menge Spielkameraden, wir tobten Sommer wie Winter im Freien und hatten Spaß an allen Dingen, die für uns wichtig waren. Wir gingen zur Schule, lernten, machten Blödsinn, veralberten unsere Lehrer. Wir interessierten uns nicht für die große Politik, wir kannten nur die bescheidenen Verhältnisse, in denen wir nun mal lebten, wir freuten uns über die kleinen Dinge, die wir hatten und mit denen wir spielten. Ein Holzbaukasten mit großen Klötzen zum Bauen und ein Holzkipper reichten uns, um glücklich zu sein. Wenn es dann doch mal Apfelsinen oder andere Früchte gab, war das schön, aber Luftsprünge machten wir deswegen keine.
Später als Jugendliche spürten wir natürlich die Einschränkungen, aber allem zum Trotz spielte ich in verschiedenen Bands, bei denen wir die aktuellen Hits der Rolling Stones oder der Beatles, Songs von Bob Dylan oder Jimi Hendrix spielten, auch wenn wir Listen anfertigen mussten, die ein Verhältnis von 60 Prozent Ost- und 40 Prozent Westsongs enthalten mussten. Wer hielt sich schon daran? Wir trafen uns in Jugendclubs, hörten Musik der Charts, aber auch Jazz und Blues, tranken Mixgetränke oder Bier, rauchten, lachten.
Klar waren da immer die Grenzen, die uns eine freiere Entfaltung verwehrten. Als Skifahrer durften wir nur in die benachbarte Tschechoslowakei fahren, um dort Wettkämpfe zu absolvieren. Gerne hätten wir unser Können mit anderen Nationen verglichen. Klar hätten wir gerne Konzerte unserer Idole besucht und mussten uns mit zugegebenermaßen auch sehr guten Ostrockbands wie Karat, Silly, Stern Meißen und anderen begnügen, aber auch bei diesen Konzerten herrschte gute Atmosphäre und Freude. Ende der Achtziger gings bescheiden mit Auftritten von Künstlern wie Joe Cocker in Dresden oder Bob Dylan und Bruce Springsteen in Berlin los. Spätestens da wurde uns klar, was wir bisher verpasst hatten.
Fünfunddreißig Jahre liegen jetzt zwischen dem Aufbruch und heute. Fünfunddreißig Jahre lagen bis zum Aufbruch vor mir. Was sich alles in diesen und in jenen Jahren abgespielt hat, sollen diese von mir aufgezeichneten Episoden bildhaft machen. Es war ein langer Weg mit vielen Irrtümern, vielen erfolgreichen Abschnitten, vielem Schmerz, viel Spaß und Trauer.
Kapitel 1 – My Home Town
Neulich stieß ich auf der Suche nach interessanten Sendungen bei Netflix auf die Dokumentation „Bruce Springsteen on Broadway“, einer Mischung aus Biografie und Konzert. Der „Boss“ alleine auf einer kleinen Bühne mit seiner Gitarre und einem Flügel. Dort erzählt er Episoden und verbindet sie mit entsprechenden Songs seines unerschöpflichen Repertoires und das alles in einer Atmosphäre, die einen gebannt am Bildschirm fesselt. Das Licht gedimmt, nur wenige Spots auf ihn gerichtet, fällt es leicht, sich nur auf ihn und seine Stimme zu konzentrieren.
Er versteht es, die Geschichten so lebendig zu gestalten, dass es leicht ist, die Untertitel und die Originalstimme miteinander zu verbinden. Im Laufe der Sendung merkt man kaum noch, in welcher Weise man den Text tatsächlich aufnimmt.
Eine Episode musste ich mir mehrfach anschauen und anhören, weil sie mich tief bewegte und Erinnerungen wach werden ließen. Es ging dabei um seinen Vater und wie er sich an Dinge erinnerte, die in seiner Kindheit eine große Rolle spielten und ihn beeinflussten.
Er beschreibt seinen Vater als Arbeiter, der schon in vielen Jobs gearbeitet hatte und gerne am Ende einer harten Woche in seine Stammkneipe ging, um mit seinen Kumpels zu trinken, um so die schwere Arbeit zu vergessen.
„Für ein Kind stellten die Bars „…unheimliche mysteriöse Festungen dar.“
„…Wenn man eine Bar betrat, war man im Königreich der Männer!“ „…Und sie (seine Mom) sagte zu mir: - Geh rein und hol deinen Dad“ – „…Es war aufregend, weil mir meine Mutter…die Erlaubnis gab, die Bar zu betreten…Das war aufregend, aber auch beängstigend…betrat ich gleichzeitig den Ort, der meinem Vater vorbehalten und für ihn heilig war…Ich war ein Dreikäsehoch, ein Zwerg, der das Land der Riesen betrat.“
Diese Worte erinnerten mich unweigerlich an meine eigene Kindheit und Erlebnisse, die ich mit meinem Vater verband.
Mein Vater Alfred war wie viele andere nach dem Krieg aufgerufen, fehlende Pädagogen zu ersetzen, um Schulen wieder zu öffnen. Man nannte sie Neulehrer, das waren ehemalige Arbeiter oder Angestellte, die sich in einer begrenzten Zeit umschulen ließen und so in verschiedenen Fachrichtungen anfingen zu unterrichten. Oft erzählte er mir später, dass er in seinen Vorbereitungen gerade mal eine Stunde den Schülern voraus war. Er war beharrlich und bald ein anerkannter Lehrer, der in unserer kleinen Stadt Buchholz in wenigen Jahren so bekannt wie der berühmte „bunte Hund“ war.
Noch heute kommt es bei gelegentlichen Besuchen bei einem meiner damaligen Schulfreunde vor, dass ich mich seinen Bekannten vorstelle, ich ihnen erkläre, dass ich bis zu meinem 18.Lebensjahr hier gewohnt und gelebt habe. Dabei schütteln alle den Kopf, sie würden mich nicht kennen. Wenn ich aber erwähne, der Sohn vom Lehrer Mentzel zu sein, kommt ein allgemeines Aha auf und alle wissen mich einzuordnen.
Unterrichtet wurde damals auch samstags, nicht allzu viele Stunden, meist so um die vier, aber immer waren Schüler und Lehrer natürlich auch samstags unterwegs.
Was die Lehrer anbetraf, so lief es nicht anders als bei den Vätern, über die Bruce Springsteen erzählt. Man ging nach getaner Arbeit noch nicht nach Hause, sondern traf sich zum gemeinsamen Umtrunk in einer kleinen Kneipe in der Nähe der Schule. Natürlich war dort nicht das gesamte Kollegium versammelt, es war der „harte Kern“, alles Neulehrer, die man getrost als dicke Kumpels bezeichnen durfte.
Die kleine Kneipe hieß „Alma“, wahrscheinlich war das nur der Name der Wirtin, eine sehr dünne Dame mittleren Alters, die schon um 11.00 Uhr ihre Kneipe öffnete und der erwarteten Stammgäste harrte. Die Lage war günstig, ein paar Schritte vom Haupteingang der Schule entfernt, gleich gegenüber der Turnhalle und der Ruine der Kirche.
Ich war gerade mal 6 Jahre alt, als mal wieder das zubereitete Essen drohte, kalt zu werden. Mutter wollte den Herd nicht ohne Aufsicht lassen, also bat sie mich, in die Kneipe hochzulaufen und meinen Vater zu holen. Auch ich hatte wie Bruce S. das Gefühl, einen Schritt ins Erwachsenenleben zu machen – ich sollte in die Stammkneipe meines Vaters gehen!
Also zog ich los, zögerte aber noch eine geraume Weile vor der Kneipentür. Es war laut da drin, es musste ziemlich voll sein. Dann nahm ich allen Mut zusammen, drückte die Türklinke herunter und betrat den Gastraum. Ich sah erst mal gar nichts vor lauter Zigarettenqualm, es roch nach allem Möglichen, Zigaretten, Zigarren, Schweiß, verschüttetem Bier und Schnaps. An den alten klapprigen Tischen saßen „die, die immer hier sitzen“. So stand es auf dem Schild des Stammtisches in der Mitte des Gastraums. Der Raum bot vielleicht 20 Leuten Platz, alle waren sichtlich gut drauf und unterhielten sich lautstark über die Tische hinweg. Meinen Vater erkannte ich dann an der kleinen Bar sitzend, seine Kollegen und Kumpels Wolfgang Flohrer und Ludwig Krämer an seiner Seite. Die beiden waren meine Patenonkel und sehr oft mit meinem Vater unterwegs.
Es wurde ein wenig ruhiger in der Kneipe…“Was will der Kleine hier?“…bis es dann wieder auf volle Lautstärke anschwoll.
Es dauerte eine Weile, bis mich Vater registrierte und mich fragte, was ich wohl hier in seiner Kneipe wollte. Ich sagte zu ihm: „Mutti schickt mich. Du sollst nach Hause kommen, das Essen ist fertig und sie wartet.“ Er meinte nur: „Setz dich hier hin, ich bestelle dir eine Limo. Wenn du die ausgetrunken hast, gehe ich mit dir nach Hause.“
Ich setzte mich also auf einen der freien Stühle und sah mich in der Kneipe um. Alma brachte mir die große Limo und Vater bestellte für sich und seine Freunde noch eine Runde Bier mit einem „Kurzen“ dazu. Es dauerte noch eine geschlagene Stunde und eine weitere Limo, bis er sich zum Gehen entschloss. Es war bestimmt schon so gegen zwei Uhr am frühen Nachmittag, als sich auch Wolfgang und Ludwig aufrafften zu gehen. Allen drei war die starke Gesichtsrötung im Gesicht anzusehen.
Vor der Tür gab es noch eine große Verabschiedung, die auch noch eine Weile dauerte, dann endlich konnte ich mit Vater die steile Neugasse zu unserer Wohnung hinunterlaufen.
Wir wohnten in einem alten Mietshaus, das seine beste Zeit schon lange hinter sich hatte. Es war in den 1920ern ein Hotel, man kann noch heute die Schrift lesen: „Hotel Deutsches Haus“. Man konnte im Treppenhaus die Ringe auf den Stufen sehen, an denen vor langer Zeit Teppiche befestigt waren. Die Vorräume zu den Wohnungen waren riesig. Wir wohnten in der 4. Etage und der Weg da hoch war in dem Zustand, in dem sich mein Vater momentan befand, ziemlich anstrengend.
Der Empfang an der Wohnungstür war wie von mir, aber sicher auch von meinem Vater erwartet, dem Zustand entsprechend frostig. Meine Mutter legte los, wie ich es sehr selten erlebt hatte. Es ergoss sich ein Schwall von Beschimpfungen über ihren Ehemann, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Vater wurde ganz kleinlaut, entschuldigte sich, musste aber sein Essen nun selbst aufwärmen. Ich bekam meinen Teller selbstverständlich hingestellt, aber die Stimmung war auch mir gegenüber nicht sehr freundlich, hatte ich doch meine Aufgabe nicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt. In den Folgejahren kam es immer mal wieder zu ähnlichen Vorfällen, ab und an holte ich Vater wie schon damals von „Alma“ ab, auch als ich selbst schon die Schule besuchte, an der mein Vater unterrichtete.
Das „Land der Riesen“, wie es B.S. beschrieb, verlor für mich so allmählich seinen Schrecken und ich fand es nicht mehr so mysteriös wie beim ersten Mal. Ein paar Jahre später sollte die kleine Kneipe durchaus auch zur Stammkneipe der älteren Schüler und für mich werden. Natürlich passten wir den Zeitpunkt unserer Besuche so ab, dass wir nicht mit unseren Lehrern zusammentrafen, meistens war das in der Woche, wo die Lehrer nicht da waren. Alma schwieg wie ein Grab über unsere Besuche, wir zollten ihr dafür großen Respekt. Der Samstag blieb ihnen weiterhin heilig, da blieben sie unter sich.
Die ersten 18 Jahre meines Lebens verbrachte ich in Buchholz, dem kleineren Stadtteil von Annaberg-Buchholz. Die beiden Städte Annaberg und Buchholz wurden 1945 auf Weisung des sowjetischen Stadtkommandanten zu einer Kreisstadt vereinigt. Buchholz hat einen gar eigenartigen terrassenförmigen Aufbau in mehreren Ebenen. Die untere Ebene in Höhe Talstraße, die beiden mittleren Ebenen in Höhe des Rathauses und der jetzigen Karlsbader Straße und die oberen Ebenen, die die Berg- und die Teichstraße ausmachen. Es geht aber noch höher hinaus bis hin zum Sportplatz an der Alten Schlettauer Straße. Dazwischen liegen teils extrem steile Verbindungsstraßen. So steil, dass die Häuser, die direkt an den Verbindungsstraßen stehen, im unteren Teil mindestens ein Stockwerk mehr haben.
Von der unteren bis zur oberen Ebene, dem Sportplatz, liegen gute 150 Höhenmeter. Diese Steilheit machten wir Kinder uns vor allem im Winter zu Nutze. Die Straßen waren in meinen Kinderjahren fast immer gut zugeschneit. Gestreut wurde, wenn überhaupt, mit Asche auf den Gehwegen. Das bedeutete, wir konnten die steilen Gassen für unsere Rodelabenteuer nutzen. Wir banden in Höhe des Sportplatzes mehrere Schlitten zu einem „Bob“ zusammen und los ging die wilde Fahrt hinunter bis zur Talstraße, teils wurde der wilde Verband der Schlitten in scharfen Kurven auseinandergerissen, dann ging es eben in mehreren kleinen Formationen weiter, direkt über die Hauptstraße hinweg (da hatten wir einen Posten aufgestellt) bis hinunter zur Sparkasse. Erst dort fand das wilde Rennen ein Ende. Ein Gaudi ohne Gleichen!
Überhaupt war die kleine Stadt Buchholz ein sehr kinderreiches Örtchen mit immerhin zwei Mittelschulen, die beide gut besucht waren. Auf der Karlsbader Straße, die damals Straße der Befreiung hieß, fand das gemeinschaftliche Leben statt, es war das kommunikative Zentrum der Stadt.
Es gab viele Geschäfte: Bäcker, Drogerie, Molkerei, das Bekleidungshaus Höbler, das Eisenwarengeschäft Möckel, Apotheke, einen Schreibwarenladen, ein Imbiss, den Fischladen, die Konditorei Nestler, Fleischer und natürlich einen „Konsum“ und eine „HO“, den Vorläufern der Supermärkte. Über der Einkaufsstraße thronte die Ruine der Katharinenkirche. Sie war einem Fehlangriff der Alliierten Fliegerstaffeln am 14. Februar 1945 zum Opfer gefallen. Den ganzen Tag lang sah man Leute, die einkaufen gingen, man unterhielt sich, saß auf den Bänken des kleinen Parks, dazwischen tummelten sich kleine Kinder, später spuckten die beiden Schulen ihren Schulkinder aus; es war Leben in der Stadt!
Vor einigen Wochen war ich nach langer Zeit mal wieder in meiner Heimatstadt. Der Grund war eine Klassenfeier der drei parallelen Klassen der Gelben Schule. Ich nutzte die Gelegenheit zu einem Bummel durch die Altstadt von Buchholz. Matthias R., einer meiner Klassenkameraden später an der EOS, begleitete mich, um mir die Veränderungen zu erklären. Ich war geschockt. Aus der ehemals pulsierenden Haupt- und Ladenstraße war eine leblose, triste Gegend geworden. Es gab zwar noch einige der ehemaligen Geschäfte, aber man sah kaum einen Menschen, den es hier nach draußen zog.
Umso weiter man in den äußeren Bereich gelangte, wurde es noch schlimmer. Jedes dritte Haus, manchmal gar ganze Straßenzüge waren mittlerweile unbewohnt und gammelten vor sich hin. Zwei der beliebtesten Kneipen, die „Dumme Sau“ und „Lucie“ waren geschlossen – und das nicht erst seit Monaten. Baulücken waren entstanden, wo vormals lebendiges Wohnen vorherrschte. Auch ein Blick in die höher gelegenen Stadtteile und eine Autofahrt über etwas abgelegene Straßen bestätigten meine Eindrücke. Kaputte Straßen, leere Häuser, wenige restaurierte Bauten.
Das Kino und Kulturhaus „Marx“ weggerissen, einst der Treffpunkt der Jugend von Buchholz. Den Anblick meines elterlichen Wohnhauses kann man nur als erbärmlich bezeichnen. Das Dach kaputt, die Fassade ein Witz, der Garten und das Waschhaus zugewuchert wie einst das Schloss des Dornröschens.
Die Arbeitsplatzverluste infolge der Einstellung des Bergbaus, der Wegzug vieler Menschen in die Neubaugebiete von Annaberg oder in andere Städte, Schließungen der großen Betriebe wie Plasticard oder der Posamentenwerke führten dazu, dass Buchholz nur noch halb so viele Einwohner hat wie zu meiner Kinderzeit. Neue Bauten entstanden nur noch in den Höhenlagen der Stadt. Dort in den Siedlungen baute man immer höher hinaus auf ehemals grünen Wiesen. Das Buchholz meiner Kindheit gibt es nicht mehr. Ein weiterer Grund, sich mit dem Leben von damals zu beschäftigen.
Die Schule, in der mein Vater unterrichtete und ich acht Jahre zur Schule ging, hieß Pestalozzi Oberschule, wurde aber von allen Einwohnern wegen der Farbe die „Gelbe Schule“ genannt. Unweit gab es noch die Fröbel Oberschule, die als „Grüne Schule“ bezeichnet wurde. Dort ging meine Schwester zur Schule, zumindest bis sie ab der achten Klasse nach Klingenthal an die Kinder- und Jugendsportschule „delegiert“ wurde.
Die Gelbe Schule wurde etwas von den Bewohnern bevorzugt, dort gab es auch mehr Schüler. Einen großen Vorteil stellte die Sporthalle dar, die gleich unterhalb der Schule stand. Dazwischen befand sich der Pausenhof. Das war nicht immer ein Ort der Erholung. Es gab Streit zwischen den Schülern der oberen und den unteren Klassen, es gab durchaus auch Gewalttätigkeiten. So wurden Holzkatapulte so genial umgebaut, dass sie in der Lage waren, über mehrere Meter hinweg nach einiger Übung ungeliebte Schüler zielgenau mit Metallkrampen zu attackieren.
In dem kleinen Viertel unterhalb der Schule, praktisch im Zentrum von Buchholz, wohnten wir. Es gab jede Menge Kinder von den kleinsten bis zu den Jugendlichen ringsherum, nie wurde es einem langweilig, wenn man aus dem Hause ging. Man verabredete sich und schon plante man Abenteuer und tobte auf den Straßen, bis es finster wurde. Alleine in unserer Mietskaserne gab es sechs Kinder, in der unteren Etage wohnte Familie Bergner.
Sie hatten parterre eine kleine Kartonagenfabrik. Werner war vier Jahre älter als ich, aber unabhängig davon hatten wir in den Folgejahren jede Menge Spaß zusammen. Gegenüber wohnte Familie Küchler mit drei Mädchen, die ältere hieß Bärbel und die Zwillingsmädchen Ute und Karin. Sie gingen in die andere Schule, sodass sich der Kontakt mit ihnen in Grenzen hielt. Dann gab es eine Etage darüber noch Steffen, ein von seinen Eltern stark eingeschränktes und oft krankes Kind, das man fast nie mit anderen zusammen sah. Erst später öffnete er sich mir gegenüber und wurde ein recht guter Freund.
Auch im Umfeld waren Kinder, mit denen ich befreundet war, im Nachbarhaus wohnte die Familie Kempe, sie hatten sieben Kinder, die sehr streng und autoritär erzogen wurden. Volkmar ging in meine Klasse und wenn es ihm erlaubt wurde, waren wir unterwegs am Waldschlösschen oder im Buchholzer Freibad. Manchmal vergaßen wir die Zeit, dann wurde es ungemütlich für ihn, ich ging zur Sicherheit mit hoch zur Wohnung und musste in der Folge erleben, wie Vater Kempe seinen Sohn brutal verdrosch. Ich erzählte es Vater, aber er wusste schon davon, ein älterer Bruder von Volkmar hatte es in der Schule erzählt.
Unsere Wohnung lag in der oberen Etage. Nachdem man die vielen Stufen erklommen hatte und einigermaßen außer Puste war, stand man vor einem riesigen Vorraum, von dem drei Türen abgingen. Rechts wohnte Familie Fiedler, ein Berufsschullehrer mit seiner Frau, die beiden hatten keine Kinder. In der Mitte war der Eingang zu Frau Knöfel, eine sehr dünne und kleine ältere Frau. Ich empfand sie aus meinen Kinderaugen unwahrscheinlich alt. Sie hatte ihren Mann im Krieg verloren und war sehr verschlossen. Manchmal halfen wir ihr bei schweren Arbeiten wie Holz spalten oder wir schleppten Kohlen für sie hoch. Erst später, als ich an die 17,18 Jahre alt war, hatte ich intensive Gespräche mit ihr über die Zeit vor und während des Krieges.
Links standen mehrere große Schränke, in denen alles Mögliche verstaut war, was nicht in die Wohnung passte, einer von Frau Knöfel, die anderen von uns. Links davon ging eine hölzerne Treppe zum Boden hinauf. Auf der Zwischenetage befanden sich die Toiletten von uns und der alten Dame, Plumpsklos mit riesigem Fallrohr. Diesen Raum nutzte mein Vater auch als Werkstatt für seine Drechselarbeiten.
Ging man durch die verglaste Wohnungstür, stand man in einem ziemlich langen Flur, der mit Schränken und Regalen hinter Vorhängen mit Krimskrams vollgestellt war. Links ging eine Tür zur „guten Stube“. Diese wurde sehr selten genutzt, eigentlich nur, wenn eine Feier anstand, zu Weihnachten oder wenn Besuch kam. Darin stand ganz links ein großer, alter Schreibtisch, in dem sich die Schätze meines Vaters befanden. Es handelte sich dabei um verschiedene Gesteinsarten, die er im Laufe seiner Ausbildung zum Geografielehrer gesammelt hatte. Rechts vor der Verbindungstür zum Schlafzimmer stand ein Sofa, darüber ein gemaltes Bild mit einer Fantasielandschaft, davor ein Ausziehtisch mit ein paar Stühlen.
Den hinteren Bereich füllte eine Schrankwand, die die Eltern von einem Tischler fertigen ließen. In der Weihnachtszeit baute mein Vater die Modelleisenbahn vor den beiden Fenstern auf. Wir saßen stundenlang davor und ließen die Züge an kleinen Häuschen, die er selbst gebaut hatte, Bäumen und Feldern vorbeifahren. Dieses Zimmer war das einzige, was tapeziert war, alle anderen Räume waren glatt weiß gestrichen.
Rechts im Flur war die Tür zum Kinderzimmer, das mir erst nach Auszug meiner älteren Schwester Maritta zur Verfügung stehen sollte. Bis dahin stand mein Bett im elterlichen Schlafzimmer. Maritta ging mit 14 Jahren zur Kinder- und Jugendsportschule nach Klingenthal. Endlich konnte ich mich mit meinem Spielzeug so richtig ausdehnen! Das Zimmer war wie ein Schlauch, gerade mal 1,80 m breit und so an die 3,50 m lang. Egal, ich hatte endlich mein Reich für mich, außer meine Schwester kam an den Wochenenden nach Hause, aber das konnte ich verkraften.
Das eigentliche Zentrum der Wohnung befand sich geradeaus, die Küche. Es war der größte Raum der Wohnung, zum Fenster zu allerdings mit einer Dachschräge. Es war das einzige Zimmer, was regelmäßig geheizt wurde, dort stand das Waschbecken, hier wurde gekocht, gegessen, freitags in einer Zinkbadewanne gebadet (natürlich alle in einer Wasserfüllung – ich war immer der Letzte!), auf einer Couch ausgeruht, Schularbeiten korrigiert, gebügelt. Also alles, was das Leben ausmachte, es fand in der Küche statt. Im hinteren Bereich unter der Schräge stand ein Tisch, der für alles herhielt, zum Essen, zum Spielen, Malen, Korrigieren, Hausaufgaben machen, Schreiben. Links davon, in einer ziemlich dunklen Ecke, stand er, der „Huwiedenstuhl“. Auf der Sitzfläche lagen und über die Lehne hingen alle Klamotten, die jeder so über die Tage anhatte oder wieder anziehen wollte. Jeder Versuch meiner Mutter, diesen Stuhl zu beräumen, wurde von uns torpediert, spätestens einen Tag nach der Beräumung war er wieder da, der „Huwiedenstuhl“!
Von der Küche aus ging eine Tür zur elterlichen Schlafstube, die aber auch als Lager für Wäsche und Lebensmittel diente. In der Ecke des Schlafzimmers thronte in einer Ecke hochkant die Badewanne. In der Dämmerung verwandelte sich dieses Monstrum in einen Sarg, zumindest in meiner Fantasie. Gruselig!
Das Verrückteste an diesem Haus waren die Nebengelasse, allem voran der Keller. Wie alle Häuser an den vertikalen Verbindungsstraßen zu den horizontalen Ebenen hatte es zum Tal eine Etage mehr als bergseits. Der Keller ging diese Neigung mit, hieß, er fiel talwärts ab, als ginge man einen Berg hinab. Unser Keller befand sich natürlich ganz unten, es war der letzte Verschlag, den die Windungen des Kellergangs hergaben. Dort lagerten die Kohlen, aber auch die Kartoffeln und ein paar Gläser mit Eingewecktem.
Die Kohlen mussten erst mal dorthin getragen werden, das war der jährliche Höhepunkt an Hausarbeit. Der Lastwagen kippte die sechzig Zentner oder mehr lose Briketts oben an der Hauptstraße ab. Von dort mussten sie in Tragekörben und Eimern die Einfahrt hinunter zum Hauseingang getragen oder mit dem Handwagen gebracht werden, dann die Kellertreppe hinunter und durch die verwundenen Gänge hinunter zu unserem Verschlag. Manchmal lag schon Schnee, das brachte Erleichterung und vor allem jede Menge Spaß mit sich. Dann konnten wir die gefüllten Körbe mit dem Schlitten den Hang hinunterfahren. Meistens ging es gut, aber wie man sich vorstellen kann, kippten ab und zu die vollen Körbe vor ihrem Ziel um oder der Schlitten mitsamt seiner Fracht und dem Führer landeten im Schnee.
Für das Füllen der Körbe war meine Mutter zuständig, den Schlitten fuhren meine Schwester Maritta und ich im Wechsel und in den Keller trug Vater die Körbe. Er sah schon nach ein paar Zentner Kohle aus wie ein Bergmann, der gerade aus der Grube gefahren war, das Gesicht schwarz und von der Anstrengung auch noch gerötet, was für eine tolle Farbmischung! Aber er nahm es mit Humor, vor allem, wenn er wieder eine unerwartete Pause bekam, weil der Schlitten mal wieder auf der Seite lag und wir Kinder die Kohlen unter Gelächter einsammelten.
Unmittelbar links neben der Haustür war das Waschhaus. Dort stand eine einfache Waschmaschine, deren Kessel man mit Holz und Kohle erst anheizen musste. Das war aber schon ein Fortschritt zu dem Kessel, der vorher drinstand. Die Mieter mussten sich in eine Liste eintragen, wann sie die Absicht hatten, große Wäsche zu waschen. Das bedeutete, dass bei sieben Mietparteien jeder alle sieben Wochen dran war.
Freitag ging`s schon los mit dem Hinuntertragen der Wäschekörbe, dem Säubern des Kessels und dem Bereitlegen von Holz und Kohle. Samstags wurde angeheizt und gewaschen, was das Zeug hielt, Berge von Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Unterwäsche, später, wenn das Wasser nicht mehr so heiß war, auch Hosen, Kleider und Hemden. Aus dem Kessel raus, mussten wir die Wäschestücke auswringen, teils mit der Hand oder durch eine Wringmaschine, zwei Holzrollen, die übereinander angebracht waren. Mit einer Kurbel wurden die Rollen in Bewegung gesetzt, dabei drehten sich die Rollen entgegengesetzt, die nasse Wäsche wurde durchgezogen und kam auf der anderen Seite feucht heraus. Dazu brauchte es aber drei Leute, die halfen. Vater hielt sich aus der Waschzeremonie raus, also mussten die Kinder mit ran. Sonntags trocknete die Wäsche auf der Leine entweder auf der Wiese oder aber auf dem Boden, einem riesigen Raum mit einigen abgeteilten Kammern.
Am Ende der Wiese stand der große Schuppen der Kartonagenfabrik von Familie Bergner. Das war aber nicht nur ein normaler Schuppen, er diente Werner, der den Schlüssel dazu hatte, und mir als Abenteuerspielplatz. Stundenlang spielten wir Verstecken hinter den riesigen Stapeln von Kartons in allen Größen, wir lasen uns Gruselgeschichten vor oder sangen patriotische Lieder wie: „Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsre Schützengräben aus…“ oder „Von all unsern Kameraden war keiner so lieb und so gut wie unser kleiner Trompeter, ein lustig Rotgardistenblut“. Es waren Lieder, die wir in der Schule und im Chor gelernt hatten und uns durchaus bewegten. In Wintern mit viel Schnee diente uns das Schuppendach, das zirka drei Meter hoch über der Wiese war, als „Mutsprungkante“. Dazu häufelten wir mit Schaufeln lockeren Schnee zu einem großen Haufen an und sprangen die drei Meter hinunter, die Mutigsten mit Anlauf und Absprung
Kapitel 2 – Erzgebirgswinter
In den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein galt das Erzgebirge mit seinen höchsten Gipfeln, dem Fichtelberg auf deutscher und dem Keilberg auf tschechischer Seite, zu den schneesichersten Landschaften in Ostdeutschland. Schneehöhen bis zu 1,50 Meter waren durchaus keine Seltenheit. Manchmal fiel so viel Schnee, dass es auf den Straßen nur auf Trampelpfaden voranging.
Solche Tage nutzten Werner Bergner und ich, manchmal auch andere Kinder, uns direkt vor unseren an der Katharinenstraße gelegenen Häusern zu rodeln, Ski zu fahren, aber uns vor allem kleine Schanzen zu bauen, auf denen wir immer weiter sprangen. Ging es nicht weit genug, wurde einfach der Schanzentisch höher gebaut. Mit unseren Stöcken, die wir zum Springen nicht brauchten, markierten wir unsere Bestweiten. In der Haltung eiferten wir dem damaligen Idol Helmut Recknagel nach, einem Skispringer aus Thüringen, der noch mit den Armen nach vorn durch die Lüfte segelte. Überhaupt gab es einen Hype um das Skispringen, weil Recknagel so viele Erfolge feierte – drei Mal gewann er die Vierschanzentournee, er wurde Olympiasieger und Weltmeister. Viele Jungs eiferten ihm nach, wir auf unserer Straße in Buchholz natürlich auch.
An einem Februartag im Jahr 1967 schneite es die ganze Nacht hindurch, nachdem es bereits am Abend angefangen hatte. An diesem Sonntagmorgen wollten wir uns im Tal treffen, um mit dem Mannschaftsbus zu einem Skirennen zu fahren.
Ich war pünktlich aufgestanden, hatte gefrühstückt und wollte mit meiner Skiausrüstung loslaufen. Aber beim Versuch, die Haustür zu öffnen, scheiterte ich. Die Haustür ging nach außen auf, davor lag aber so viel Schnee, dass es beim Versuch blieb. Es gab keine Chance, die Tür auf zu bekommen. Ich rief meinen Vater zu Hilfe, aber auch er blieb erfolglos. Wir gingen eine Treppe hinauf, öffneten das Fenster und schätzten die Situation ab. Es würde schon gehen. Ich sprang in den Schnee hinab. Die Angst blieb unbegründet, ich sank bis zur Hüfte im Schnee ein, wühlte mich heraus, Vater warf die Skiausrüstung hinterher und ich stapfte los.
Es war mühsam, vor mir waren vielleicht ein, zwei Leute die Straße runtergelaufen, aber es war nur ein kleiner Pfad und mit der Ausrüstung kam ich nur schlecht und langsam voran. Am Treffpunkt musste ich feststellen, dass es die anderen Sportler nicht mal bis hierhin geschafft hatten. Der Bus stand in einer einen Meter hohen Schneewehe. Es gab keine Möglichkeit, den Bus frei zu schaufeln. Selbst wenn wir das geschafft hätten, der Bus wäre keinen Meter vorangekommen. Also lief ich den beschwerlichen Weg wieder zurück. Es ging ein bisschen leichter, weil in der Zwischenzeit doch ein paar Leute den Pfad ausgetreten hatten. Am Haus angekommen, waren gerade Vater und einige andere Mieter dabei, den Eingang und die Einfahrt zum Grundstück von den Schneemassen zu befreien. Es wurde ein wunderschöner Tag. Die Sonne kam heraus und so nutzten wir die Gunst der Stunde, stapften zu unserer Skiwiese Frankehalde hoch, trampelten den hohen Schnee so fest, wie es ging und fuhren den ganzen Tag Ski. Am späten Nachmittag ging es auf Skiern die steilen Straßen hinunter bis vor die Haustür.
Ich war zweieinhalb Jahre alt, als mich mein Vater das erste Mal auf zwei kleine Holzrutscher stellte und mich im Schnee voran schob. Das geschah noch auf einer Ebene, ich lernte, mich mit den Brettern fortzubewegen, in dem ich die beiden Stöcke zu Hilfe nahm und mich Schritt für Schritt nach vorn tastete. Ich hatte riesigen Spaß damit, ein Jahr später bekam ich schon richtige kleine Ski und fuhr die ersten Hügel hinab.
Die ganze Familie war skiverrückt. Vater bestritt Wettkämpfe und gewann viele davon in der Klasse der Versehrten, von denen es nach dem Krieg viele gab. Mutter ließ es langsamer angehen, nutzte aber auch jede Gelegenheit, mit den Brettern den Berg hinunter zu sausen. Meine Schwester hatte ebenso zeitig angefangen und war so gut, dass die Eltern meinten, sie sei reif, auf die Sportschule zu wechseln. Leider waren die Plätze für den alpinen Rennsport an der Sportschule Oberwiesenthal begrenzt. Sie wurde nicht angenommen, aber man stellte ihr in Aussicht, nach Klingenthal zu gehen und dort in der Disziplin Skilanglauf eine Ausbildung zu machen. Da sich sowohl meine Schwester als auch die Eltern auf die Sportschule „eingeschossen“ hatten, entschieden sie sich dafür.
Die Frankehalde lag oberhalb der Bergstraße und war im oberen Bereich durch den Wald begrenzt. Den Namen hatte die Wiese durch die beiden Abraumhalden bekommen, die vom Uranbergbau der 40er übriggeblieben waren. Die Sowjets hatten im Zuge der Reparationen im Raum Annaberg Uran und andere Mineralien abbauen lassen. Und so standen sie nun, die beiden mächtigen, zirka zwanzig Meter hohen Halden. Lag Schnee darauf, sah man Stellen, an denen sichtbar durch Reststrahlung der Schnee schmolz.
Vater und andere Sportler, für die die Wiese schon weit vor dem Krieg als Skihang diente, machten sich die Tatsache, dass die Halden nun mal da waren, zunutze und erbauten auf der zentral gelegenen Halde eine Sprungschanze. Sie flachten den Mittelteil des Berges ab, natürlich alles mit der Hand und primitiven Hilfsmitteln wie Hacken und Schaufeln, holten aus den umliegenden Wäldern starke Stämme heraus und zimmerten in zwei Jahren tatsächlich einen Anlaufturm mit drei Luken. Was für eine Leistung so wenige Jahre nach Ende des Krieges! Eigentlich gab es keine Baumaterialien, aber die Männer schafften es, das Werk fertig zu stellen. Selbst die Tatsache, dass der Turm einmal drohte, umzufallen, haute sie nicht um. Sie verbesserten die Stabilität, versteiften die Verbindungen und so konnte die Schanze in den Folgejahren auch zu kleinen Wettkämpfen genutzt werden
Überhaupt muss man sich das Skifahren in den frühen Jahren, in denen ich begann, anders als in der Gegenwart vorstellen. Unsere Skier waren aus Holz, hatten geschraubte Stahlkanten und eine Seilzugbindung mit einem sogenannten Tiefenzug. Man konnte durch die relative Bewegungsfreiheit der Fersen mit den Skiern durchaus auch Wanderungen unternehmen. Bevor wir abfuhren, lösten wir die Spannung, zogen den Seilzug durch den Tiefenzug und waren damit fest mit den Skiern verbunden.
Unsere Gegend bot viele Gelegenheiten, sich auf Skiern fortzubewegen. Im Buchholzer Wald gab es eine „Schneeschuhbah“. Im Sommer ein Forstweg, gab uns die Abfahrt im Winter den totalen Kick. Wir fuhren Schuss die gerade mal ein bis zwei Meter breite Schneise ab. Wir sprangen über quer verlaufende Wege, erreichten im unteren Abschnitt noch mal so richtig Geschwindigkeit und konnten kurz vor der Straße rechtzeitig abschwingen. Der Weg zurück war natürlich beschwerlich, aber das machte uns nichts aus, nur mussten wir beim Aufstieg aufpassen, dass wir nicht mit anderen kollidierten. Oben angekommen, hatten wir wieder Gelegenheit, die Frankehalde zu nutzen.
Die Wiese hatte nur eine geringe Neigung, aber gerade dadurch eignete sie sich für alle Skibegeisterten. Jung und Alt tummelten sich auch in der Woche auf dem Skihang, wenn das Wetter es zuließ. Einen Lift gab es natürlich nicht. Wenn es geschneit hatte, war das erste, was man machen musste, das Trampeln des Hanges. Seitlich versetzt stiegen wir mit unseren Skiern den Hang hoch und schafften uns so eine Bahn, die spätestens nach zwei, drei Aufstiegen genug Breite hatten, um bequem abfahren zu können.
So ging das den ganzen Tag lang, hochtrampeln, dabei viel schwatzen und dann die Abfahrt genießen. Den absoluten Kick holten wir uns, wenn richtig viel Schnee gefallen war. Dann waren auch die beiden Halden schneebedeckt.
Wir trampelten die höhere, zirka dreißig Meter hohe hoch, fuhren erst den unteren Teil platt, dann ging es immer höher. Das Gefälle war steiler als das der Sprungschanze. Von der Haldenspitze gab es jetzt eine Speedspur mit einem verdammt engen Radius im Übergang zur Wiese. Egal, wir rasten hinunter in einem Affenzahn, meistens endete die Fahrt mit einem Sturz nach dem Radius, aber das war uns der Gaudi wert.
Anfang Februar fand für unseren Verein der Höhepunkt des Jahres statt, die Ortsmeisterschaften. Zu diesem Wettkampf waren alle eingeladen, die etwas mit Skiern zu tun hatten, also die alpinen Skifahrer, die Langläufer und die Skispringer. Einige meldeten sich für alle Disziplinen an, ich war natürlich auch mit dabei. Am Vormittag gings auf die Loipe, zehn Kilometer auf Läufern abspulen, am zeitigen Vormittag dann der Slalom auf der Frankehalde und danach das Skispringen. Alles war so organisiert, dass alle Zuschauer und Wettkämpfer alle Wettkämpfe schauen konnten. Es war ein großes Volksfest.
Neben der Frankehalde waren unsere Väter immer auf der Suche nach geeigneten Rennstrecken. Keine Zeit war ihnen zu schade, alle packten mit an, wenn es darum ging, Schneisen durch den Wald zu schlagen oder Baumstümpfe zu roden. Oberhalb des Freibades entstand so eine Abfahrtsstrecke durch den Wald, die es in sich hatte. Ein paar Jahre fanden dort Wettkämpfe statt, dann verwilderte sie wieder. Es fehlten einfach Zeit, Leute und das Geld, die Strecke zu erhalten. Gegenüber des Buchholzer Berges gab es noch den „Katzenbuckel“. Dort fanden sogar einige Jahre unter Licht Rennen statt, aber auch diese Wiese ereilte das Schicksal der Abfahrtsstrecke.
An einigen Wochenenden fuhren wir bei schönem Wetter regelmäßig nach Oberwiesenthal zum Skifahren. Wir fuhren mit der Bimmelbahn von Buchholz bis nach Cranzahl und von dort mit der Fichtelbergbahn bis Oberwiesenthal. Da das Geld knapp war, nahmen wir Verpflegung und Getränke in einem Rucksack mit, liefen vom Bahnhof über die „Idiotenwiese“ - so wurde der große Skihang genannt - bis zu einem großen Busch und hängten ihn da an einen Ast.
Von da ging es im Gräten- oder dem Treppenschritt gemächlich bergan bis zum Eckbauer, dem oberen Ende des Hanges. Das dauerte so an die dreißig Minuten. Was für eine Anstrengung! Nach einer kurzen Pause fuhren wir in rasanten Bögen die Wiese hinab bis zum Busch. Das dauerte gerade mal drei bis vier Minuten. So ging das mit kleinen Unterbrechungen, wo wir uns ausruhten und etwas aßen oder tranken, bis in den späten Nachmittag hinein.
Um Geld zu sparen, fuhren wir mit den Skiern vom oberen Bereich des Fichtelbergs, das Gepäck hatten wir bei der letzten Bergtour mitgenommen, bis zum Bahnhof Vierenstraße immer leicht bergab. Manchmal musste man ein Stück laufen oder schieben, aber je nach Schneelage brauchten wir eine Dreiviertel bis zu einer Stunde. Es war wunderbar, durch den verschneiten Erzgebirgswald dahinzugleiten und seinen Gedanken nachzuhängen.
Die Freude am Skifahren brachte mich zum Skiclub Buchholz. Dort lernte ich sehr schnell das Fahren durch Torstangen, die verschiedenen Techniken des Skifahrens und war bald an der Spitze meiner Altersgruppe. Nun ging es zu Wettkämpfen in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom, zunächst auf den Hängen des Kreises. Neben Oberwiesenthal waren das Bärenstein, Jöhstadt, Neudorf, Sehma und Ehrenfriedersdorf.
Die Ausrüstung verbesserte sich so nach und nach. In der Nähe, in Geyer, gab es eine Skiwerkstatt, die gute Ski bauten. Zum Skibauer Gablenz gab es gute Verbindungen. Wir erhielten zunächst noch Holzski, die aber schon mit einer Langriemenbindung versehen waren. Vorn hatte die Bindung zwar noch die Backen, die von der Seilzugbindung herrührten, aber hinten gab es einen Drehteller mit einem etwa einem Meter langem Lederriemen. Der wurde vorn und hinten über Kreuz fest angezogen, sodass man jetzt eine wesentlich bessere Verbindung zum Ski hatte. Sicher war das noch lange nicht, weil man Gefahr lief, sich bei einem Sturz das Kniegelenk zu verletzen.
Im Jahr 1967, als es die ersten Erfolge für den Verein gab, stiegen wir zum Trainingsstützpunkt auf und uns standen nun mehr Mittel zur Verfügung. Die Trainingsgruppe umfasste zirka sieben Sportler verschiedener Altersgruppen - männlich wie weiblich. Jetzt bekam ich die ersten Fiberglasski von Mende aus Wolkenstein. Zwei Meter lang. Aber welch Fortschritt! Auf dem Ski montierten wir in der Tschechoslowakei gekaufte Marker Rotamat Fersenautomatik- Bindungen. Bei Stürzen löste sich die Bindung und die Gefahr einer schweren Verletzung war minimiert.
Die Wettkämpfe wurden komplexer. Begann es mit einzelnen Rennen an den Wochenenden, kamen bald schon Fahrten mit Übernachtungen hinzu, weil zwei oder mehr Rennen gefahren wurden. Einige dieser Rennen sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Der Nachtslalom in Sehma war legendär, bei wenig Beleuchtung konnte man die Torstangenfarben Rot und Blau kaum unterscheiden und da kam es schon mal vor, dass sich Läufer verfuhren oder Tore ausließen.
Ein Wochenende ging es nach Seiffen. Im Organisationsbüro wurden Quartiere vergeben, das waren Übernachtungen bei Familien, die ihre Gäste- oder Schlafzimmer für Sportler zur Verfügung stellten. Mein Trainer und ich bekamen ein Zimmer ziemlich am Rande der Stadt. Wir stapften mit unserer Ausrüstung und dem Koffer durch den Schnee, wurden von den Leuten herzlich begrüßt und bewirtet und bekamen deren Himmelbetten. Die Bettdecken waren so dick, dass wir im Liegen nicht drüber schauen konnten. Ich kann mich nicht erinnern, jemals wieder in solchen Betten geschlafen zu haben. Mein Trainer und ich schüttelten uns vor Lachen. Wir schliefen traumhaft gut.
Erste Erfolge stellten sich schon im Alter von zehn Jahren ein, das Training bei meinem Trainer Gerhard Richter wurde härter, es kamen immer neue Trainingseinheiten dazu, auch in der Halle, wo wir Kraft und Geschicklichkeit trainierten. Wir mussten lernen, wie man stürzt, ohne sich dabei ernsthaft zu verletzen, turnerische Übungen wie Saltos, Sprungrollen und Sprünge von hohen Höhen gehörten zum Programm. In den Sommermonaten kamen Waldläufe dazu, Sprünge vom Einmeter- und vom Dreimeterbrett im Schwimmbad, wir nahmen an Leichtathletikwettkämpfen teil und in den Herbstferien ging es nach Oberwiesenthal zu Trainingslagern.
Dort lernten wir mit kurzen, einen Meter langen Skiern auf Mattenbahnen zu fahren, wir nutzten den morgentlichen Tau, um auf einer Wiese Kurven zu fahren und wir mussten Sprungschanzen bewältigen, um bei schnellen Abfahrten bestehen zu können. Das alles war schweißtreibend, aber ich hatte einen Riesenspaß daran. Immer mehr Wettkämpfe nahmen wir ins Programm auf, es ging nach Thüringen zu den schwierigen Hängen von Goldlauter-Heidersbach, im Vogtland zur zweitschwersten Abfahrtsstrecke nach Schöneck und vielen anderen Wettkampfstrecken.
Meinen größten Erfolg feierte ich zur Deutschen Schülermeisterschaft 1967 in Frauenwald, einem kleinen thüringischen Ort. Ich war in Top-Form, hatte in der Saison schon meine ärgsten Konkurrenten Wolfgang Riedel, Bodo Lützendorf und Eckhard Gahler in die Schranken weisen können und war deshalb guter Dinge.
In einem kleinen Schaufenster im Ort waren die Medaillen ausgestellt, die zu gewinnen waren. Mein einziger Gedanke war: „Die musst du unbedingt gewinnen!“. Am ersten Tag wurde wegen des Wetters der Abfahrtslauf abgesagt, stattdessen fand ein Riesenslalom statt. Ich war wahnsinnig aufgeregt, deswegen misslang mir der Start und ich kam nicht richtig in den Lauf hinein. Ab Mitte des Laufes lief es wie geschmiert, ich holte auf und gewann die erste Medaille der Meisterschaften, eine bronzene. Mehr war nach dem Start auch nicht zu erwarten gewesen.
Am Folgetag stand der Slalom auf dem Programm, meiner Problemdisziplin. Zwei Durchgänge waren zu fahren. Nach dem ersten lag ich auf Platz fünf, legte aber im zweiten eine Schippe drauf und es kam wieder der gleiche Platz raus: Dritter. Meine Hauptkonkurrenten patzten aber noch mehr als ich und so kam es, dass ich in der Kombiwertung der beste Fahrer der Wettkämpfe wurde: Gold in der Kombination, was für ein Erfolg! Ich war nach dem dritten Platz im Slalom am Boden, hatte mir mehr vorgenommen und jetzt das! Die Siegerehrung genoss ich in vollen Zügen.
Jetzt bemerkte ich allerdings auch, dass ich ziemlich schwer erkrankt war – ich sah aus wie ein Streuselkuchen, ich hatte die Windpocken und die Temperatur stieg bei der Rückreise noch stark an. Zu Hause angekommen, fiel ich entkräftet ins Bett und dort blieb ich eine Woche lang. Im Folgejahr fielen die Erfolge moderat aus, mal gewann ich ein paar Wettkämpfe, mal wurde ich gerade mal Sechster, trotzdem berief man mich in den C-Nachwuchsnationalkader. Damit waren mehr Förderungen und die Aussicht einer Delegierung zur Kinder- und Jugendsportschule Oberwiesenthal verbunden.
Das sollte zum Schuljahr 1967/68 passieren. Zum Schuljahresende ließen sich die Lehrer meiner Schule etwas ganz Besonderes einfallen. Ich hatte mich in der Saison schon laufend gewundert, dass die Urkunden für die Erfolge bei den Wettkämpfen nicht ausgegeben wurden. Im Kino von Buchholz fand eine Feierstunde statt, an der die Schüler verabschiedet werden sollten, die zur EOS nach Annaberg wechselten. Vor der Verabschiedung aber teilten die Lehrer mit, dass ich als einziger der Schule zur Sportschule Oberwiesenthal versetzt werden sollte. Ich wurde auf die Bühne gerufen. Was jetzt kam, trieb mir tatsächlich die Tränen in die Augen. Alle Urkunden samt den Ergebnissen aller Erfolge des zurückliegenden Winters wurden verlesen und mir übergeben. Einerseits war ich stolz auf das, was da geschah, anderseits wollte ich am liebsten im Boden versinken, ich war ja nicht jedermanns Freund und hochstapeln war nicht mein Ding. Vielleicht war es das Omen, was zwei Monate später auf mich zurückfallen sollte.
Im Sommer 1967 fand der Parteitag der SED statt, der zwar endlich die Fünf-Tage-Woche beschloss, aber auch die Reduzierung von Förderungen für Sportarten, die nicht genügend Erfolge versprachen. Darunter fiel natürlich auch der alpine Rennsport. Bis zu diesem Zeitpunkt schafften es gerade mal Eberhard Riedel und Ernst Scherzer, sich bei internationalen Wettkämpfen durchzusetzen – zu wenige in den Augen der Funktionäre. Das war natürlich auch das Aus für Neueinschulungen in die Sportschule Oberwiesenthal. Ich musste nach der feierlichen Verabschiedung im Juni wieder zurück in meine alte Schule und das 8. Schuljahr dort besuchen – Schadenfreude bei meinen Feinden, aber zumindest Freude bei meinen Freunden, die in der Überzahl waren.
Es war das erste Mal, dass ich mich vom Staat, von der Gesellschaft, von den „Oberen“ betrogen fühlte. Seit meinem zehnten Lebensjahr arbeitete ich an meinem Ziel, ich hatte mir den Arsch aufgerissen für eine Sportart, die durchaus gute Chancen gehabt hätte, wäre man den Weg der Spezialisierung gegangen. Klar hatten wir in unserem Mittelgebirge keine geeigneten Abfahrtsstrecken, die es mit denen in der BRD, Frankreich oder Italien hätten aufnehmen können. Trainingsmöglichkeiten für Riesenslalom hingegen, Slalom noch mehr, hätte es am Fichtelberg, dem Keilberg oder im Riesengebirge gegeben.
Mit diesem Beschluss war alles Makulatur, was wir uns bis dahin aufgebaut hatten. Wir verloren den Status des Trainingsstützpunktes und damit auch die materielle und finanzielle Grundlage, unseren Sport weiterhin so zielgerichtet zu betreiben. Der Sponsor (das hieß zwar damals noch nicht so) zog sich zurück, das hieß, wir hatten den Kleinbus, einen B1000 für die Fahrten zu Wettkämpfen nicht mehr zur Verfügung, wir bekamen kein neues Material, also kein Geld mehr für Ski, Wachs, Bindungen. Was wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten, war zwar auch nicht viel; für Bekleidung und Skihelme war nie was da, aber jetzt mussten die Eltern, die ein Auto hatten, einspringen und uns zu den Wettkämpfen begleiten. Das ging bei eintägigen Rennen noch, aber weiter weg und über das ganze Wochenende, das war praktisch nicht mehr möglich.
Ich war zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt und wollte mich partout nicht mit dieser Situation zufriedengeben. Neben unserem Skiclub und meinem Trainer Gerhard Richter gab es in Buchholz eine weitere kleine Skigruppe, die nicht so präsent bei Wettkämpfen war und auch wenige Sportler vereinte. Sie trainierten auf der Schrammwiese, einer kleinen, dafür aber steilen Wiese ganz in der Nähe meines Wohnhauses. Ihr Trainer war Jürgen Agsten, er wohnte direkt unterhalb dieser Wiese. Sein Vater hatte eine Plastikfabrik, wo Kämme, Becher und ähnliche kleine Gegenständer hergestellt wurden.
Jürgen war 19, studierte in Berlin Ökonomie und kümmerte sich um die jüngeren Skifahrer, bestritt aber gleichzeitig selbst noch Rennen in der Erwachsenenklasse. Wir waren ab und zu auch auf dieser Wiese Ski fahren, aber unser Haupthang war die Frankehalde. Jürgen hatte eine begeisternde Art an sich, bekam natürlich mit, was mit unserem Stützpunkt passiert war und versuchte uns von seinen Ideen zu überzeugen. Er wollte auf die Schrammwiese einen Lift bauen und hatte bereits Pläne, wie das umzusetzen ginge.
Die alteingesessenen Skifahrer hielten nichts von diesen Ideen, sie wollten eher weiter auf der Frankehalde bleiben, auch mein Trainer. Ich ließ mich von Jürgen animieren und trainierte fortan bei ihm. Mein Vater sah das mit großer Skepsis.
Neben Jürgen gehörte auch Uli Lorenz zu der Truppe, er war vier Jahre älter als ich, war aber in die Ideen von Jürgen voll integriert. Wir trafen uns in der Folgezeit oft bei Jürgen, tüftelten Pläne zur Umgestaltung der Schrammwiese aus, waren aber auch außerhalb zusammen unterwegs. Wir fuhren mit Jürgens „Pobeda“, einer russischen Karre, die mit zwanzig Liter Waschbenzin auf hundert Kilometer lautstark unterwegs war, zum Geyerischen Teich, segelten dort mit einem Faltboot über den Teich, gingen baden oder machten Ausflüge in die erzgebirgische Landschaft.
In seinem Zimmer, oder besser Wohnung, denn er hatte im Haus seiner Eltern schon sein eigenes Reich geschaffen, hörten wir stundenlang Musik von seinem Smaragd Tonbandgerät, hauptsächlich die der Rolling Stones. Er hatte, glaube ich, alle aktuellen Scheiben der Gruppe auf Band. Was für ein Gewinn! Bisher dudelte unser altes Radio zu Hause lediglich alte Schlager der dreißiger bis fünfziger Jahre, wenn überhaupt. Vater war ein musikalischer Tiefflieger, nur Mutter trällerte die alten Schlager mit. Und jetzt die Stones, Eric Burdon & The Animals, Ten Years After, Procul Harum, Iron Butterfly, The Small Faces, The Kinks, The Beatles und noch viel mehr. Was für ein Gewinn, ich konnte nicht genug davon bekommen! Es war nicht nur die beginnende Pubertät, sondern auch der Einfluss der neuen Freunde, die mein Leben zum Leidwesen meines Vaters stark umkrempeln sollten.
Kapitel 3 – Familie
Über meinen Vater habe ich in den vorangegangenen Kapiteln bereits einige Charakteristika beschrieben. Ich muss wieder auf die Sendung „Bruce Springsteen on Broadway“ zurückkommen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einer amerikanischen Kleinstadt oder eben in einer noch kleineren Kleinstadt im Erzgebirge am Rande der DDR nahe der Grenze zur Tschechoslowakei gelebt habe, aber das Grundsätzliche bleibt: Eltern prägen uns in den unterschiedlichsten Formen.
Wie auch B.S. sah ich in meinem Vater einen Helden, aber auch meinen größten Feind. Letzteres entwickelte sich stärker in der Phase der Pubertät und im Zusammenhang mit meinen neuen Freunden Jürgen und Uli. Bis jetzt war Vati mein Vorbild, er war ein geachteter Lehrer, gut in der Stadt vernetzt und intelligent. Sein Wissen auf dem Gebiet der Geologie, Astronomie und Mathematik fesselte mich. Er begeisterte mich mit seinen Erzählungen, die er aus dem Ärmel schüttelte. Er beteiligte mich an den Korrekturen der Arbeiten seiner Schüler und erklärte mir akribisch sein Vorgehen bei der Bewertung der Schüleraufsätze oder Diktate.
Es dauerte nicht lange, da schob er mir die Arbeiten der Klassen 4 und 5 zu und meinte, ich wäre jetzt soweit, ihm zu helfen und die Arbeiten zu korrigieren. Ich hatte ein Faible für die deutsche Sprache, machte kaum wissentlich Fehler und genau das machte er sich zunutze. Ich ahmte seine Art nach, unterstrich die falsch geschriebenen Wörter oder Fehler in der Zeichensetzung, markierte die Fehler am Rand in roter Farbe. Am Anfang ging er alle Arbeiten selbst noch einmal durch und setzte die Note und seine Unterschrift darunter, später blieb es nur noch bei der Note und der Unterschrift. Er vertraute mir – und das konnte er auch, zumindest, was die Schule betraf.
Bei häuslichen Arbeiten sah es schon ein wenig anders aus. Bald war es meine Aufgabe, die Kohlen aus dem irren Keller nach oben zu schleppen, wozu ich gar keine Lust hatte. Ich erledigte das, aber nicht in dem Moment, als er das wollte. Jetzt kam auch noch diese „Hottentotten-Musik“ dazu. So nannte er die Musik, die ich jetzt hörte. Für ihn war Musik etwas, was man notgedrungen brauchte, um zu tanzen; und das tat er mit Begeisterung.
Vater war der jüngste Spross seiner Eltern Martha und Georg Mentzel - das Nesthäkchen. Von seinen Schwestern Margarethe und Liesbeth wurde er verwöhnt, sein Bruder Fritz war so viel älter, dass er anfangs wenig Kontakt zu ihm hatte. Sie alle wuchsen in einem kleinen Haus auf der Teichstraße in Buchholz auf, eine der Straßen auf der höheren Ebene unseres Städtchens. Ganz in der Nähe war beschriebene Frankehalde, auf der sich außer Alfred aber niemand aus der Familie tummelte. Nur er war versessen aufs Ski fahren und Springen. Er machte seinen Schulabschluss, wie es eben in jener Zeit üblich war und ging danach in die Lehre als Werkzeugmacher. Die für unsere Generation unerklärliche, fanatische Begeisterung für den Nationalsozialismus machte auch bei Familie Mentzel nicht halt. Alfred engagierte sich in der Hitlerjugend und meldete sich mit seinem achtzehnten Geburtstag 1941 freiwillig zur Wehrmacht. Nach einer kurzen Ausbildungszeit ging es zur Ostfront nach Russland.
Als ich so dreizehn, vierzehn Jahre alt war, versuchte ich, mit Vater über seine Zeit an der Front zu sprechen. Meine Fragen prallten wie von einer Mauer ohne Antworten zurück – mit wenigen Ausnahmen. So erzählte er mir, dass sie kaum sauberes Wasser hatten, aber Tee und dass sie sich notdürftig mit Tee rasiert hätten. Er beschrieb mir, wie sie sich Donnerbalken im Wald gebaut und wie sie sich in tagelangem Beschuss im Schützengraben gefühlt hätten, aber auch bei diesen Schilderungen unterließ er es, über Einzelheiten zu berichten.
1943 wurde er in der Nähe der Stadt Riga am rechten Fuß von einem Granatsplitter getroffen. Das waren Verletzungen, die die Soldaten in Russland als „Heimatschuss“ bezeichneten. Er wurde nach der Behandlung in einem Notlazarett nach Deutschland verlegt und in Frankenberg weiter behandelt.
Die Verletzung war so schlimm, dass sie ihm das Bein abnehmen wollten. Der Fuß war so vereitert, dass die Ärzte keine Chance auf Rettung sahen. In der Nacht kratzte Alfred sich so lang an seinem verwundeten Fuß, bis die Wunde platzte und der Eiter abfloss. Der Arzt hätte sich sehr gewundert – so die Erzählung meines Vaters – aber sie sahen jetzt von einer Amputation ab. Nach einem langen Heilungsprozess wurde er entlassen – nicht nur vom Lazarett, sondern auch von der Wehrmacht. Er bekam einen Erholungsurlaub, den er zusammen mit seiner Schwester Margarethe zu einer Reise nach Innsbruck und auf den Patscherkofel unternahm.
Wieder zu Hause in Buchholz angekommen, frischte er die Jugendliebe zu Lisa Roscher auf. Sie hatte gerade eine zweijährige Odyssee hinter sich und verliebte sich in den Rückkehrer. 1944 heirateten die beiden und im Januar 1945 kam meine Schwester Maritta zur Welt.
Lisa Roscher war ein Einzelkind, eigentlich eine Seltenheit in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ihre Eltern Gertrud und Karl waren einfache Leute, die in einem Haus auf der Bergstraße, unweit der Teichstraße auf der gleichen oberen Ebene von Buchholz wohnten. In diesem Haus wohnte auch die Stiefmutter von Gertrud und die Familie des Stiefbruders, die Familie Böttcher.
Ich lernte als Kind noch diese Stiefmutter kennen, für mich bleibt in Erinnerung, dass das eine böse, zänkische Frau war, die meine Oma immer traktierte und sie für sich arbeiten ließ. Oma war wie viele Frauen in diese Zeit Hausfrau. Sie kümmerte sich um die alltäglichen Dinge und um ihren Mann. Karl war ein großgewachsener attraktiver Mann, den aber schon der Weltkrieg Nummer Eins die Gesundheit genommen hatte und deswegen ständig auf der Suche nach einer Arbeit war. Das gelang ihm meistens durch seine Art und seine Erscheinung, aber es waren bestenfalls wenig einbringende Arbeiten. Weltkrieg Nummer Zwei brach ziemlich seinen Willen, vor allem war er gesundheitlich noch mehr angeschlagen. Er nahm Arbeit im Untertagebau an, die seiner schon angeschlagenen Lunge den Rest gab. Staublunge und schließlich Krebs beendeten sein aufopferungsreiches Leben im Jahre 1974.
Lisa war ein aufgewecktes, fröhliches Kind. Sie war bei allen beliebt, ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen. Wenn es einer Freundin schlecht ging, war sie als erste zur Stelle und kümmerte sich uneigennützig um sie. Ihrer „lieben“ Großmutter Thekla, der Mutter von Karl, galt ihre uneingeschränkte Zuneigung. Ständig besuchte sie sie, half ihr beim Haushalt und bei Besorgungen. Noch im Alter holte sie Fotos mit sich und ihrer Omi ständig aus einem Karton und schwärmte von der Warmherzigkeit dieser Frau.





























