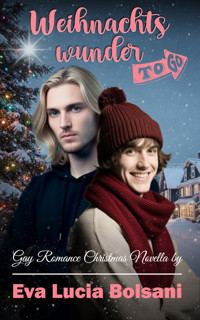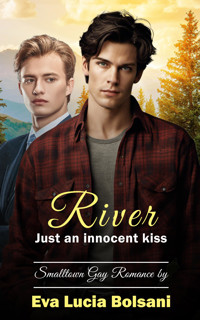5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein verzogener Prinz. Ein unbarmherziger Räuber. Ein tollkühner Plan – mit ungeahnten Folgen! Leander soll eines Tages Landgraf von Trällerbach werden – doch statt Politik interessieren ihn nur guter Wein und romantische Drachenballaden. Bis er in eine Falle gelockt und sein Diener Felix von einer Räuberbande verschleppt wird. Leander würde Felix nur zu gerne retten, aber selbst mitten unter den Räubern zu landen, war nicht geplant! In der rauen Welt des Waldes gibt es keinen Platz für verwöhnte Prinzen. Zumal der resolute Räuberhauptmann Thore es sich zur Aufgabe gemacht hat, den widerspenstigen Neuankömmling zu zähmen. Aber könnte Thores strenge Hand genau das sein, was Leander bisher gefehlt hat? Immer mehr Gefallen findet der junge Mann an seinem neuen Leben – und immer mehr Gefallen findet er an Thore! Doch kann ein Prinz wirklich alles hinter sich lassen? Oder muss Leander für seinen Traum von Freiheit einen zu hohen Preis zahlen? Eine freche, prickelnde, märchenhafte Gay Romance mit schlagfertigen Helden, verbotenen Verlockungen und einer Liebe, die alle Ketten sprengt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva Lucia Bolsani
Räuberherz und Taugenichts
kinky gay fairytale
Zu Risiken und Nebenwirkungen
Ein kinky gay fairytale? Was zum Teufel ist das denn?
Ehrlich gesagt, wusste ich das auch nicht – bis ich eines geschrieben habe. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer und kann euch einen kleinen Beipackzettel zur vorliegenden Geschichte anbieten:
Was ist drin? Genau das, was draufsteht: eine märchenhafte Geschichte aus einem Märchenland, in dem es Märchenprinzen, Märchenschlösser und märchenhaft finstere Räuber gibt. Vielleicht gibt es in diesem Märchenland sogar einen Drachen, aber dazu liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor – eventuell handelt es sich dabei also um ein Märchen.
In dieser zauberhaften Welt haben überholte Konventionen ausgedient. Hier darf jeder lieben, wen er möchte, und niemand wundert sich, wenn ein Prinz das Herz eines Mannes erobert oder eine mutige Heldin sich in eine andere Frau verliebt. Auch die sexuelle Revolution hat ihren Weg ins Märchenland gefunden. Küssen ist hier nicht mehr das Höchste der Gefühle – ein bisschen mehr Spaß ist durchaus erlaubt. Den findet ihr in einigen wenigen expliziten Szenen zwischen Mann und Frau und in etlichen heißen Momenten zwischen zwei Männern.
Natürlich steht es mir als Märchenerzählerin nicht zu, den Bewohnern des Märchenlandes Kinks oder Vorlieben zu verbieten. Tatsächlich gibt es auch dort Menschen, die Freude an Spielarten finden, die wir wohl dem Soft-SM-Bereich zuordnen würden. Nichtsdestotrotz ist und bleibt »Räuberherz und Taugenichts« ein Märchen, und deswegen gilt auch hier, was für alle Märchen gilt: Lesende dürfen gerne mit Leander und Thore ins Märchenland reisen und mitträumen – aber bitte keine voreiligen Nachahmungen! Also bitte: keine Kinder im Wald aussetzen, keine Äpfel vergiften und niemanden ohne klare Zustimmung fesseln oder übers Knie legen.
Viel Spaß beim Lesen!
Eva Lu
Es war einmal …
… ein riesiger Drache, dessen schuppige Haut in dunklem Grün schimmerte und dessen gewaltige Schwingen die Sonne verdunkelten, wann immer er seine Höhle verließ. Die Menschen erzitterten vor Angst, denn der Drache forderte jedes Jahr ein Opfer: einen unschuldigen jungen Mann.
In jenem Jahr fiel das Los auf den jungfräulichen Kaspar, und nackt wie am Tage seiner Geburt wurde er vor die Höhle des Drachen geführt. »Komm nur herein«, lockte die Bestie mit ihrer rauchigen Stimme. Mit weichen Knien und zitternd vor Angst betrat Kaspar die Behausung des Untiers.
Die ganze Höhle schien in ein schillerndes Grün getaucht zu sein, und obwohl Kaspar fürchten musste, jeden Moment verschlungen zu werden, kam er nicht umhin, die Schönheit des Schuppenkleides der Bestie zu bewundern.
»Hör zu«, sagte der Drache. »Diene mir ein Jahr, und ich werde dich freilassen. Widersetzt du dich aber, bist du des Todes.«
»Ich werde dich nicht enttäuschen«, entgegnete Kaspar so mutig er konnte. »Soll ich dir vielleicht einen Tee kochen?«
… Fortsetzung folgt
»Tee kochen! Was zur Hölle?!«
Leander knallte das Buch zu, so heftig, dass sein Weinkelch fast vom Tisch gefallen wäre. Jetzt, wo es endlich spannend wurde, hörte es auf – an der besten Stelle!
Es konnte Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, bis er an die Fortsetzung herankam. Solche Bücher standen schließlich nicht in der landgräflichen Bibliothek herum. Leander hatte die Ballade beim Stadtfest bei einem schmierigen Händler zwischen allerlei Tand entdeckt, und es hatte ja auch wirklich vielversprechend begonnen … die wilde Bestie, der tapfere, nackte Jüngling … was da alles Aufregendes passieren könnte! Doch was auch immer es war, Leander würde es womöglich nie erfahren. Ein furchtbares Ärgernis war das.
Er trank seinen Wein in einem Schluck aus, ließ den leeren Weinkelch danach achtlos auf das Tischchen fallen und starrte aus dem Fenster. Was er dort sah, war so langweilig wie der ganze Tag bisher: blauer Himmel, weiße Wolken. Die Dienerschaft bereitete die Kutsche für die Reise vor, während er nichts tun konnte, außer zu warten.
Wenn es doch endlich losginge! Die Einladung zu Maximilians opulentem Spektakel – seine Worte, nicht Leanders –, bei dem es sich in Wahrheit um eine stinknormale Fasanenjagd handelte, war seine Rettung. Dem strengen Regiment seines Vaters für ein paar Tage zu entkommen, der ihn ohnehin nur mit Vorträgen über seine Pflichten langweilen würde, war Gold wert.
Dazu wäre es allerdings vonnöten, das Schloss auch irgendwann mal zu verlassen!
Gerade als der Prinz jede Hoffnung auf eine baldige Abreise aufgegeben hatte, öffnete sich die schwere Tür seines Gemachs. Sein Diener Felix trat ein und verneigte sich leicht. »Eure Hoheit, die Kutsche ist bereit.«
»Das wurde auch Zeit.« Leander stand auf, nicht ohne demonstrativ zu seufzen, und maß Felix mit einem vorwurfsvollen Blick. »Die Sonne steht bereits hoch am Himmel. Ich werde als Letzter eintreffen.«
Felix grinste, während er dem Prinzen den Reiseumhang umlegte. »Ihr seid der Ehrengast, Hoheit. Niemand wagt es, ohne Euch zu beginnen.«
»Erspar mir die Schmeicheleien, Felix. Das ist lächerlich.« Leander, der sich bereits umgewandt hatte und zur Tür unterwegs war, drehte sich noch einmal um, griff nach dem Ohr seines frechen Dieners und zog ein wenig daran. Nicht besonders heftig, schließlich wollte er Felix nicht ernsthaft wehtun.
»Auf dem Schloss des Fürsten solltest du lieber dein vorlautes Mundwerk im Zaum halten, bevor Maximilian dir befiehlt, es mit Seife auszuwaschen. Diener soll man weder sehen noch hören«, mahnte er, auch wenn er selbst es damit nicht so genau nahm. Nicht bei Felix, der seit ihrer Kindheit immer an seiner Seite war. Sie waren etwa gleich alt, und hätte Felix nicht die Livree eines Dieners getragen, man hätte sie gar für Brüder halten können.
Wären die Umstände anders, könnten sie vielleicht sogar Freunde sein.
Leander wischte den unsinnigen Gedanken beiseite, während er würdevoll durch die langen Gänge des Schlosses schritt. Seine Freunde gehörten allesamt dem Adel an, so wie Maximilian – auch wenn dieser ein unerträglicher Langweiler war, der sehr zu Leanders Verdruss sein Erbe bereits angetreten hatte. Zweifellos würde Maximilian die gesamte Jagdgesellschaft wieder stundenlang mit Klagen über seine fürstlichen Pflichten unterhalten.
Aber wenn Leander erst Landgraf war, würde er es ihm mit gleicher Münze heimzahlen! Denn was bedeuteten die Pflichten eines popeligen Fürsten schon im Vergleich zu denen eines mächtigen Landgrafen? Lächerlich! Bis dahin musste er Maximilians Prahlereien eben erdulden. Denn eines war sicher: So lahmarschig Maximilian auch war, seine Einladung zur Jagdgesellschaft war ein Geschenk des Himmels. Lieber ertrug Leander die öden Reden, als im Schloss seiner Eltern zu versauern, wo das letzte aufregende Ereignis der Angriff eines Drachen vor über 500 Jahren gewesen sein musste!
Da der Prinz sich bereits nach einem späten Frühstück pflichtbewusst von seinen Eltern verabschiedet hatte, konnte er nun ohne weitere Verzögerung aufbrechen. Auch wenn er vor Ungeduld fast platzte, schritt Leander gelassen durch den ehrwürdigen Haupteingang des Schlosses, Felix wie ein Schatten an seiner Seite.
Draußen wartete der Kutscher Hans mit der prächtigen Droschke. Hastig riss der Mann sich den Hut vom Kopf und verneigte sich, ebenso wie die drei Soldaten, die neben ihren Pferden warteten. Leander quittierte die Geste mit einem flüchtigen Nicken. Ohne ein Wort stieg er ein, gefolgt von Felix, der die Tür hinter ihnen schloss und ihm gegenüber Platz nahm. Mit einem lauten Knall ließ Hans die Peitsche durch die Luft sausen, und die Kutsche setzte sich endlich ruckelnd in Bewegung.
»Drei Bewaffnete«, brummte Leander und verzog das Gesicht. »Ich sehe ja aus wie ein Feigling! Als ob irgendein Gauner den Mut hätte, die Kutsche des Prinzen anzugreifen! Dieser verfluchte Händler und seine Märchen über Räuberbanden im Wolfstann.« Er schnaubte verächtlich. »Ich wette, kein Wort davon ist wahr. Der Pfeffersack hat seine Waren bestimmt irgendwo versteckt, um sie anderswo für das Dreifache zu verkaufen. Die ganze Geschichte stinkt wie ein Misthaufen im Hochsommer.«
»Ihr glaubt, der Mann lügt, Hoheit?«
»Allerdings. Diese Räuber sind nichts als ein Ammenmärchen.«
Felix’ Haltung blieb ruhig, doch seine Augen verengten sich kaum merklich. Er lehnte sich vor, seine Stimme leise, aber klar. »Vielleicht. Aber was, wenn nicht? Ein Händler, der alles verliert, hat nicht viel zu lachen, Hoheit. Sein Kummer verdient zumindest Beachtung, finde ich.«
Die Kutsche rumpelte über eine Unebenheit. Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, nur unterbrochen vom rhythmischen Hufschlag der Pferde. Eine leichte Röte stieg in Leanders Wangen. Wie machte Felix das nur? Mit wenigen Worten gelang es ihm stets, Leander ins Wanken zu bringen, und dabei klang er noch immer wie der ergebenste Diener.
Trotzdem war das Unsinn! Diese Räuber waren nichts weiter als Hirngespinste, erfunden von gierigen Händlern oder gelangweilten Dorfbewohnern. Leander reckte das Kinn und zog seine Mundwinkel zu einem überheblichen Lächeln hoch. »Nun, wenn das so ist … dann haben diese Gauner gewiss auch die Fortsetzung der Drachenballade gestohlen. Jetzt werde ich nie erfahren, wie es ausgeht!«
Felix’ Lippen zuckten, während er kaum merklich den Kopf schüttelte. Seine Augen blitzten kurz auf. »Natürlich, Hoheit. Die Räuberbande hat es auf literarische Meisterwerke abgesehen. Besonders auf Drachengeschichten.«
Fast erwartete Leander, dass Felix ihn daran erinnern würde, dass die angeblichen Räuber laut den Gerüchten nur Nahrungsmittel und Münzen stahlen. Doch sein Diener hatte sich scheinbar wieder an seine Stellung erinnert und schwieg.
Leander spürte, wie sich ein Gefühl der Zufriedenheit in ihm ausbreitete. So gehörte es sich. Er streckte die Beine aus, bis seine Stiefel auf der gegenüberliegenden Bank ruhten. »Weck mich, wenn wir angekommen sind – oder wenn du einen Räuber erspähst.«
Auch wenn Leander nicht an die Geschichte glaubte, musste er zugeben, dass ein Überfall eine willkommene Abwechslung wäre. Mit einem zufriedenen Lächeln schloss Leander die Augen und ließ seiner Fantasie freien Lauf. Er stellte sich vor, wie er sich heldenhaft vor Felix und Hans stellte, die Armbrust entschlossen auf den schaurigen Räuberhauptmann gerichtet. Der Mann, von Furcht gepackt, ließ sein rostiges Schwert fallen und floh in die Wälder. Ha! Maximilians langweilige Monologe würden dagegen verblassen, und Leander wäre der Held der Jagdgesellschaft.
Es war eine weit angenehmere Vorstellung, als sich mit der bitteren Wahrheit zu befassen, dass sein Vater ihm wahrscheinlich keinen einzigen Bewaffneten als Eskorte mitgegeben hätte, wenn Leander drei Brüder statt seiner drei Schwestern hätte.
Die Kutsche des Prinzen rumpelte durch die adrette Stadt Trällerbach, doch der Mann, der sich genau in diesem Augenblick dem Liebesspiel hingab, bekam davon nicht das Geringste mit.
Kunststück, galt seine ganze Aufmerksamkeit doch seiner heutigen Bettgefährtin. Genüsslich ließ Thore seine Lippen über die üppigen Brüste der Frau wandern, die nackt, hilflos und vollkommen verzückt vor ihm lag. Ihre Nippel reckten sich ihm bereits hart und vorwitzig entgegen, und Thore stupste sie neckisch mit seiner Zunge an – dann biss er herzhaft zu. Matilda, die Frau des Bürgermeisters, stöhnte voller Wollust und riss an den Seilen, die ihrem fülligen Körper fast jede Bewegungsfreiheit nahmen. Ihre Hüften bockten nach oben, doch Thore dachte gar nicht daran, ihrem gierigen Leib bereits jetzt Erlösung zu schenken.
»Verfluchter, nichtsnutziger Halunke«, keuchte die außerhalb dieses Raumes so respektable Frau, »mach schon, du elender Wichtelarsch!«
»Gedulde dich gefälligst, Weib«, schnurrte Thore und leckte über ihre geschundene Brustwarze. »Dein Gezeter wird dir wenig nutzen. Wenn du nicht artig bist, werde ich dich die Peitsche spüren lassen.«
»Oh … ja!«, keuchte Matilda.
»Unersättliches Weibsbild«, schimpfte Thore gespielt streng. »Dein Gebaren ist einer Dame unwürdig, immer fordernd und ohne Scham, als gäbe es für dich weder Anstand noch Zügel! Ist dies das Benehmen einer anständigen Frau?«, fragte er süffisant, ehe er einen ihrer Nippel zwischen seine Zähne zog.
»Neiiiiin …« Nun kreischte die gefesselte Frau wie eine empörte Elster. »Bestrafe mich! Ich verdiene die Peitsche!«
»Das tust du gewiss«, bestätigte er. Matilda wand sich sichtlich erregt vor ihm, und Thore nutzte die günstige Gelegenheit, um kräftig in das Fleisch ihres üppigen Hinterteils zu kneifen. Sofort wurde er mit einem erneuten Stöhnen belohnt.
Doch die Peitsche würde nur eine unanständige Fantasie bleiben, ein Spiel in Gedanken, das niemals Wirklichkeit werden konnte. Ihr Mann, der Bürgermeister, war zwar ein törichter Einfaltspinsel – jeder andere hätte längst Verdacht geschöpft. Wenn Matilda von ihrer Freundin zurückkehrte, zerzaust und strahlend wie ein Honigkuchenpferd nach befriedigenden Stunden, bemerkte er nichts. Doch die Striemen einer Peitsche würden selbst diesem Tölpel nicht entgehen. Zumal der Bürgermeister, wie es hieß, regelmäßig auf die Erfüllung der ehelichen Pflichten bestand.
Etwas, das Thore nur allzu gut nachvollziehen konnte. Ein Prachtweib wie Matilda würde er gewiss jeden Tag beglücken, und nicht nur das, im Gegensatz zu ihrem Angetrauten würde er stets dafür sorgen, dass sie auch bekam, was sie brauchte.
Apropos …
»Ich werde dir dein vorlautes Maul schon stopfen«, verkündete er und machte sich an den Schnüren seiner Beinkleider zu schaffen. Dann schwang er eines seiner Beine über ihren gefesselten Leib und klemmte diesen wunderbar kurvigen Körper mit all den verlockenden Rundungen zwischen seinen kräftigen Schenkeln ein, während er sein Glied hervorholte.
Matilda gab ein klägliches Jammern von sich, als sie verstand, worauf er hinauswollte. Doch unnachgiebig öffnete Thore mit seinen Fingern ihre Lippen, tastete in der warmen Höhle ihres Mundes nach ihrer feuchten Zunge. »Wenn du meinen Prügel brav schluckst, lege ich dich übers Knie und versohle dich so lange, bis dein prächtiger Arsch rot ist wie die Äpfel des Bauern Magnus, bevor ich dich nehme«, verkündete Thore. Einem solchen Angebot würde die lüsterne Frau sicherlich nicht widerstehen können.
»Du nichtsnutziger Schuft …«, schimpfte Matilda, und ihre prallen Brüste bebten, während sie sich zwischen seinen Schenkeln wand. »Steck dein Kolben dahin, wo er hingehört.«
Doch Thore gab nicht nach. Grinsend umfasste er seinen harten Schaft und ließ seine Hand genüsslich auf und abwandern. »Ich kann es mir auch einfach selbst besorgen und dich mit meinem Saft besudeln.« Als wolle sein Schwanz seine Worte unterstreichen, quollen ein paar Lusttropfen aus seiner Spitze hervor. Thore packte fester zu, ließ seine Faust rascher auf und abwandern und genoss das Gefühl seiner schwieligen Hände auf seinem besten Stück.
»Verdammter Koboldkopf«, fluchte Matilda und riss an ihren Fesseln. »Na gut!«, stieß sie hervor, und dann öffnete sie wie ein hungriges Vögelchen ihre vollen Lippen.
Thore fackelte nicht lang und versenkte sich gierig in der feuchten, warmen Höhle, genoss es, zu sehen, wie Matilda darum kämpfte, ihn ganz zu schlucken, während erste Tränen aus ihren weit aufgerissenen Augen kullerten. »So ist es gut«, feuerte er sie an. »Braves Mädchen!«
Es war wunderbar, ja, geradezu himmlisch. Sollte Gevatter Tod eines Tages nach ihm greifen, so wünschte er sich, dass es in genau solch einem Moment geschehen möge. Denn dass er eines Tages in der Hölle landen würde, stand außer Frage. Doch wenn seine letzten Minuten auf Erden erfüllt wären von solch sinnlichem Rausch, würde er die Feuer der Unterwelt gewiss leichter ertragen!
Eine Stunde später sanken Thore und Matilda erschöpft auf die Matratze und rangen nach Atem. Thore betrachtete die herrlich geröteten Rundungen seiner Gespielin. Ihre Wangen glühten wie Rosenblüten im Frühling, ihr Hintern erinnerte an ein angeheiztes Kaminfeuer – und fühlte sich vermutlich auch so an. Wie sehr er es genoss, für beides verantwortlich zu sein!
Schließlich erhob er sich, löste ihre Fesseln und begann, seine Kleidung in Ordnung zu bringen. Matilda, ganz die herrische Bürgermeistergattin, ließ sich ebenfalls nicht lange bitten. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen legte die Frau des Bürgermeisters keinen Wert auf endlose Zärtlichkeiten, wenn er sie erst befriedigt hatte. »Hilf mir mit dem Korsett«, befahl sie knapp.
Thore gehorchte mit einem schiefen Lächeln und kämpfte mit den Schnüren. »Es ist immer leichter, eine Frau aus ihrer Unterwäsche zu befreien, als sie wieder hineinzubekommen«, murmelte er.
»Mach schon, Taro! Du stellst dich an wie ein Jüngling in der Hochzeitsnacht.«
Natürlich kannte Matilda seinen wahren Namen nicht, auch wenn es ihn so oder so ins Verderben stürzen würde, wenn ihr heimliches Treiben jemals entdeckt würde, ganz gleich, ob sie ihn nun als Taro oder Thore kannte. Schließlich war er nicht einfach nur ihr Liebhaber, der sich nahm, was eigentlich einzig ihrem angetrauten Mann zustand. Nein, er befriedigte Matilda auf eine Weise, die bei vielen Menschen auf Unverständnis stoßen würde. Nicht bei Thore, der kam ihren Wünschen nur allzu gerne nach. Doch wer würde ihm glauben, dass es auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin geschah, wenn er seinen Schwanz in die Spalte einer Frau stieß, die gefesselt auf dem Bett lag? Matilda würde jedenfalls gewiss kein Wort zu seiner Verteidigung sagen, dazu war sie zu schlau.
Andererseits – eines Tages würden die Schergen des Landgrafen Thore so oder so aufspüren. Auch das Glück eines Teufels fand irgendwann sein Ende, und dann würde sein Leben am Galgen enden, daran gab es keinen Zweifel.
Denn in Wahrheit war er ein Gejagter. Sein Name stand auf Steckbriefen, und auf sein Haupt war ein fürstliches Kopfgeld ausgesetzt – eine Summe, die sogar für einen Bürgermeister schwer zu ignorieren gewesen wäre. Aber Thore wusste, wie man unauffällig blieb. Matilda ahnte vermutlich, dass er nicht das war, was er vorgab zu sein. Doch sie hatte nie gefragt, und er hatte ihr nie mehr gesagt, als sie hören wollte.
Es war auch nicht das erste Mal, dass er einem anderen Mann Hörner aufsetzte – seit er im Wald lebte, ließ Thore ungern eine der wenigen Gelegenheiten verstreichen, seine Lust zu stillen. Doch hier ging es um mehr. Matilda lieferte ihm Informationen – und dafür nahm er gern das Risiko in Kauf, die Stadt zu betreten.
Nachdem sie sich beide wieder in einen halbwegs vorzeigbaren Zustand gebracht hatten, schenkte Thore zwei Kelche Wein ein. Nicht, um den Abschied hinauszuzögern – dies war schließlich keine Liebesaffäre. Sondern um ihr Geschäft abzuschließen.
Während Matilda genüsslich an ihrem Wein nippte, fragte Thore sie ganz nebenbei nach allem, was ihn interessierte: Welche Händler reisten in den nächsten Tagen durch den Wald? Welche Route nahmen die Karren, und welche Fracht verbarg sich unter ihren Planen? Wie stark war die Eskorte? Solche Informationen waren für ihn von unschätzbarem Wert. Nur so konnte er abwägen, ob ein Überfall lohnenswert oder schlichtweg zu riskant war.
Die Gespräche zwischen ihnen klangen immer wie harmloser Klatsch. Doch obwohl die Frau des Bürgermeisters im Bett gerne bezwungen werden wollte – und bei allen Göttern, sie schenkte Thore ihre Hingabe nicht, er musste sie sich hart erkämpfen – war Matilda eine sehr kluge Frau. Kein einziges Mal hatte sie ihm die Route eines Händlers verraten, an dem ihr Mann finanziell beteiligt war.
Nachdem Thore alles Wichtige in Erfahrung gebracht hatte, war er bereits im Begriff, sich zu verabschieden, doch Matilda schien in Plauderlaune zu sein und schwatzte weiter.
»Man sagt, unser Prinz Leander wolle sich Maximilians Jagdgesellschaft anschließen«, begann sie mit deutlich hämischem Unterton in der Stimme. »Natürlich reist er mit drei bewaffneten Männern, damit ihm im düsteren Wolfstann auch ja nichts passiert.«
Thore zuckte mit den Schultern. Er hatte den Prinzen einmal aus der Ferne gesehen – ein schlaksiger, blonder Jüngling, der in einem übertrieben prunkvollen Wams herumlief. Ein eingebildeter Pfau war das, gewiss überzeugt von seiner eigenen Wichtigkeit. Damit unterschied er sich in nichts von all den anderen Adeligen, denen Thore in seinem Leben – sehr zu seinem Leidwesen – bereits begegnet war.
Eine lohnende Beute war das Grafensöhnchen jedenfalls nicht. Was sollte ein Überfall auf ihn schon einbringen? Sicher, an seinen Fingern würden gewiss einige funkelnde Schmuckstücke stecken, solcher Tand stand bei den Adligen hoch im Kurs. Aber was nützte das Thore, da er keine Möglichkeit hatte, das Gold einzuschmelzen? Die Ringe einfach zu verkaufen, wäre zu gefährlich – zu leicht könnte jemand das edle Geschmeide erkennen und Fragen stellen, die Thore lieber unbeantwortet ließ. Nein, das Risiko war weit größer als der mögliche Gewinn.
Doch während Matilda recht unverhohlen über den Prinzen lästerte, kam Thore ein anderer Gedanke. Der Prinz war der einzige Sohn des Landgrafen. Gewiss würde der Graf sich nicht lumpen lassen, sollte sein Spross im finsteren Wald verloren gehen und ein wagemutiger Retter ihn wohlbehalten zurückbringen. Natürlich war das Unterfangen gewagt, doch mehr als einmal hängen konnten sie Thore schließlich nicht, oder? Und selbst wenn … beim zweiten Mal war es ihm wahrscheinlich schnurz.
Er würde den Plan, der sich da gerade in seinem Kopf formte, mit seinen Leuten besprechen. Mit galantem Lächeln küsste er Matildas Hand, was sie mit einem Schnauben quittierte. »Bis in drei Wochen«, versprach er vage, schlich durch die Hintertür hinaus und machte sich auf den Weg in Richtung Stadtmauer.
Thore schritt entschlossen voran und passierte alsbald unbehelligt das Stadttor. Dahinter sah die Welt anders aus. Kein Kopfsteinpflaster, keine prächtigen Fachwerkhäuser – nur schlammige Pfade und windschiefe Hütten, zusammengezimmert aus alten Brettern.
»Hallo, schöner Mann, wie wär’s?« Ein zerlumptes Weibsbild verzog ihre Lippen, die sie mit dem Saft zerdrückter Holunderbeeren tiefrot gefärbt hatte, zu einem zahnlosen Grinsen und hob mit beiden Händen ihren Busen an, als Thore an ihr vorbeikam.
Doch er schüttelte nur den Kopf und setzte seinen Weg unbeirrt fort. Früher hätte er der Frau ein paar Münzen zugesteckt, doch der törichte Narr, der er damals gewesen war, existierte längst nicht mehr. Die paar Groschen würden ohnehin nur in selbstgebrannten Schnaps fließen, und er brauchte jeden Taler für seine Bande.
Bald erreichte er den Schuppen mit dem löchrigen Dach, in dem sein Wallach Rumpel untergebracht war. Wie viele andere auch sah Thore keinen Sinn darin, den erhöhten Zoll zu zahlen, nur um hoch zu Ross die Stadttore zu passieren. Da gab er Rumpel lieber in die Obhut des ehemaligen Kutschers Alarik.
Rasch überzeugte sich Thore, dass es dem Pferd an nichts fehlte und Sattel wie Zaumzeug unversehrt und vollständig waren. Zufrieden zählte er Alarik das vereinbarte Salär in die schwielige Hand. Doch bevor Alarik wie gewohnt mit seinem Lamento über die harten Zeiten beginnen konnte, unterbrach ihn Thore: »Sag, du warst doch früher Kutscher im Schloss. Kennst du den Prinzen Leander?«
Einen Moment lang flackerte etwas auf Alariks Gesicht, ein Schatten von Schmerz, der sich schnell in ein melancholisches Lächeln verwandelte. »Nun, ich kannte den Prinzen, als er noch ein Knabe war«, begann er bedächtig. »Ein furchtloser Recke war er damals wahrlich nicht.«
Thore nickte auffordernd, und mit leiser Stimme erzählte der alte Mann von einer Nacht, als die Familie von einem Fest zurückkehrte. »Der kleine Prinz stieg mit seinen Eltern aus der Kutsche, und im flackernden Schein der Fackeln huschte plötzlich ein großer, dunkler Schatten an der Schlossmauer entlang. Da geriet der kleine Leander in helle Panik. ›Ein Drache!‹ rief er aus vollem Halse und rannte kreischend ins Schloss. Dabei war es nicht das Untier, welches seit 500 Jahren kein Mensch mehr zu Gesicht bekommen hat, sondern nur die Gans der Küchenmagd, die offenbar aus ihrem Verschlag entwischt war.«
Nachdenklich rieb der alte Kutscher sich mit einer Hand über das stoppelige Kinn. »Bis zu jenem Tag hatte sich der kleine Prinz gerne im Stall aufgehalten, doch nun machten sich die Stallburschen einen Spaß daraus, ihn zu necken. Sie schlichen sich hinter den Jungen und taten so, als wären sie selbst der Drache, der ihn holen wolle, und die ganze Dienerschaft lachte über ihn.«
Thore fühlte einen Funken Mitleid in sich aufsteigen, doch er drückte ihn rasch nieder. Hier, vor den Toren der Stadt, waren die Kinder froh, wenn sie wenigstens eine Mahlzeit am Tag ergattern konnten, es gab keinen Grund, das Prinzlein zu bedauern.
Alariks nächste Worte bestätigten dies nur. »Der Prinz beklagte sich bei seiner Mutter über die Streiche, die ihm gespielt wurden, und die Stallburschen bekamen den Stock zu spüren. Ein Schicksal, das auch die Küchenmagd ereilt hatte, nachdem sie die Gans hatte entwischen lassen«, fuhr der alte Kutscher fort. »Danach wurde Felix, der Sohn der Köchin, als Leibdiener für Leander auserkoren, und seitdem haben wir den Prinzen im Stall kaum mehr zu Gesicht bekommen.«
Wie Thore es sich gedacht hatte! Ein verwöhnter Balg war der Prinz, nichts weiter. Er war zu seiner Mutter gerannt und hatte dafür gesorgt, dass die Stallburschen gezüchtigt wurden. Es würde dem Prinzen gewiss nicht schaden, ein paar Tage in Gefangenschaft zu verbringen – im Gegenteil, das könnte ihn vielleicht sogar ein wenig Demut lehren.
Denn ohne es zu wissen, hatte ihm der alte Mann eine entscheidende Information geliefert: Wenn Leanders Eltern schon auf harmlose Streiche so heftig reagierten – wie viel würden sie dann wohl für die Rückkehr ihres einzigen Sohnes zahlen?
Grinsend sattelte er Rumpel und schwang sich auf den Rücken des Wallachs. Dieser Ausflug nach Trällerbach war weit erfolgreicher gewesen, als Thore erwartet hatte!
Ein Prinz verirrt sich … fast nie
Die Kutsche ruckelte über einen holprigen Waldweg und schüttelte ihre Insassen dabei ordentlich durch. An Schlaf war nicht zu denken, und die endlosen Baumreihen boten wenig Abwechslung. Leander war so gelangweilt, dass er fast laut aufgestöhnt hätte.
Um sich abzulenken, wandte er sich an Felix, den er in den letzten Tagen auf Maximilians Schloss kaum zu Gesicht bekommen hatte. Höchste Zeit, ihm von seinen Heldentaten zu berichten!
»Ach, Felix, hättest du mich nur auf der Jagd gesehen! Den prächtigen Fasan, der beim Festmahl im Mittelpunkt stand, den habe ich ganz allein erlegt.« Leander richtete sich stolz auf. »Kein anderer Pfeil als meiner hat das Tier getroffen. Du kannst dir vorstellen, wie die anderen aussahen – wie unerfahrene Knaben!«
Felix nickte höflich, ein kleines, gezwungenes Lächeln auf den Lippen. Leander fuhr fort: »Und dann diese Hofdame … wie hieß sie doch gleich? Es war ein Leichtes, ihr einen Kuss zu rauben!«
Doch selbst in seinen eigenen Ohren klangen die Worte hohl. Ja, er hatte den Fasan getroffen – aber Maximilian leider auch, und die Etikette gebot es, dem Gastgeber die Ehre zu lassen. Und die Hofdame? Es war Amalia, die Gouvernante von Maximilians Schwester, die erschreckend alte dreißig Lenze zählte und bekannt dafür war, Küsse nicht eben selten zu verteilen.
»Hast du schon einmal jemanden geküsst?«, fragte Leander, in der Hoffnung, sich von dem dumpfen Gefühl in seiner Brust abzulenken.
Felix’ Gesicht zeigte ein verträumtes Lächeln, bevor er den Blick rasch abwandte.
»Oho! Wer war es denn?«, neckte Leander ihn. »Die dralle Liesel aus der Küche? Oder gar die schüchterne Magda, die immer so verlegen unter ihrer Dienstmädchenhaube hervorlugt?«
Auch wenn Felix seinen Blick respektvoll gesenkt hielt, war das Schmunzeln, das seine Mundwinkel umspielte, nicht zu übersehen. Langsam und bedächtig schüttelte er den Kopf.
Leanders Neugier wuchs. »Sag schon!«, forderte er. »Dein Geheimnis ist bei mir sicher!« Selbst wenn es eine seiner zimperlichen Schwestern wäre, würde er Felix nicht tadeln – obwohl er sich kaum vorstellen konnte, was sein Diener an diesen spröden Ziegen finden könnte.
Felix zögerte noch einen Moment, doch dann bekannte er: »Es ist Rutger.«
»Der Stallmeister?«, fragte Leander verblüfft, musste dann aber zugeben, dass der fesche Kerl eine weit bessere Wahl war als eine seiner Schwestern. Zwar war Rutger ein wenig älter als Felix und Leander, aber keineswegs so uralt wie Amalia. Da hatte sein Diener einen guten Fang gemacht.
»Seid ihr ein Paar?«, hakte der Prinz nach.
»Nein. Es ist noch ganz frisch«, sagte Felix fest, doch dann biss er sich auf die Lippe, als wolle er sich selbst davon abhalten, mehr zu offenbaren.
Leanders Blick blieb an Felix’ malträtiertem Mund hängen. Wie mochte es sein, Felix zu küssen? Er hatte schon Männer geküsst, warum nicht? Weiter als das war er mit einem Kerl jedoch nie gegangen. Mit Frauen hatte er schon Erfahrung, aber das gehörte schließlich zum Leben eines jungen Prinzen dazu. Er zählte ja bereits achtzehn Lenze, war jung, gesund und von adeligem Geblüt, da erwartete niemand von ihm, dass er ausschließlich seine eigene Hand benutzte, um seine Gelüste zu stillen. Aber Felix … Felix war sein Diener. Das machte es einfacher. Felix musste schließlich gehorchen.
Doch als Leander die Idee weiterdachte, kamen ihm Zweifel. Was, wenn Felix höflich, aber bestimmt Nein sagte, wenn er einen Kuss forderte? Felix hatte ihn schon oft mit geschickten Worten umgestimmt, warum nicht auch jetzt?
Nein, das war es nicht wert. Sie waren keine Freunde, durften keine sein, aber Felix war ihm von allen Menschen auf dem Schloss am vertrautesten. Es wäre lästig, wenn es zwischen ihnen seltsam wurde, nur wegen eines Kusses, der Leander nicht einmal wichtig war. Und so verträumt, wie Felix gerade aussah, hatte der auch anderes im Sinn.
»Du hast dich in ihn verknallt, gib’s zu!«, bohrte Leander weiter.
Felix’ Ohren färbten sich rosa, wieder zögerte er einen Moment, doch dann nickte er entschlossen. »Ja, das habe ich wohl, Hoheit.«
Interessiert beugte der Prinz sich vor. Die Langeweile, die ihn soeben noch geplagt hatte, war verflogen. Er musste unbedingt erfahren, was die beiden außer Küssen sonst noch so getrieben hatten!
Leander hatte Rutger einmal gesehen, wie er mit freiem Oberkörper an einem Zaun arbeitete, und das Spiel seiner kräftigen Muskeln hatte ihn schon damals insgeheim beeindruckt. Doch nun fragte er sich unwillkürlich, ob Rutger an anderer Stelle ebenso gut ausgestattet war. Gewiss war es so! Hatte Felix den Phallus des Stallmeisters bereits gesehen? Ihn angefasst oder gar in den Mund genommen? Oder – und bei diesem Gedanken wurde Leander ganz schwummerig – hatte Felix sich dem Stallmeister auf noch intimere Weise hingegeben?
Er musste alles darüber wissen, unbedingt, weil …, weil …? Weil Felix sein Diener war, natürlich! Und Leander konnte es sich nicht riskieren, dass Felix seine Pflichten vernachlässigte, nur weil dieser Rutger ihn schlecht behandelte. Ja, genau so war es. Das Wohlbefinden eines Prinzen stand schließlich an erster Stelle.
»Und? Was läuft da sonst noch?«, fragte er atemlos.
Felix hob den Kopf, sein Blick war ruhig und er antwortete leise, aber gelassen: »Das ist meine Sache, Hoheit.«
Leander schnaubte. Es ärgerte ihn, wie souverän Felix blieb. Gleichzeitig musste er sich eingestehen, dass er ein bisschen beeindruckt war.
Gerade öffnete er den Mund, um Felix weiter zu löchern, doch bevor er ein Wort sagen konnte, kam die Kutsche mit einem heftigen Ruck zum Stehen. Der Prinz wurde nach vorn geschleudert und landete unsanft auf den Polstern.
»Was zum …?«, begann er, doch ein markerschütternder Schrei ließ ihn verstummen.
Es war das gequälte, schmerzerfüllte Kreischen einer Frau. Leander vergaß augenblicklich Felix’ amouröse Abenteuer und beugte sich neugierig aus dem Kutschenfenster.
Was er sah, ergab wenig Sinn. Eine Frau – allein, mitten im finsteren Wolfstann? Wie konnte das sein? Sie lag am Wegesrand, ihr Bein war unter einem umgestürzten Baumstamm eingeklemmt. Der Stamm war dick genug, um ein Pferd zu erschlagen, doch die Frau war am Leben – sie wand sich und schrie so schrill, dass es in Leanders Ohren schmerzte. Ihr knallrot geschminkter Mund verzog sich grotesk und ihre liederliche Kleidung – ein löchriger Rock und ein schmutziges Mieder – ließen keinen Zweifel an ihrem Stand.
Leander schreckte zurück. Doch nicht der Anblick der Frau ließ ihn zurückweichen, sondern der Gestank, der ihm in die Nase kroch – eine abscheuliche Mischung aus Moder, Schweiß und Verwesung. Würgend griff er nach einem seiner parfümierten Taschentücher, riss es aus seinem Wams und presste es sich vor Mund und Nase.
»Macht schon, helft ihr«, rief er durch das Fenster den Soldaten zu, seine Stimme höher, als er wollte. »Seid wenigstens einmal zu etwas nütze!«
Der Anführer der Eskorte öffnete den Mund, doch Leander ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Beeilt euch! Wir fahren langsam weiter!«
Er war gewiss kein Unmensch, der die arme Frau in ihrem Unglück zurückließ, aber niemand konnte von einem Prinzen erwarten, sich einer derartig widerlichen Lage länger als nötig auszusetzen.
»Zwei von euch sollen uns folgen, sobald ihr den Baumstamm beiseite geräumt habt, und einer von euch bringt das Weib zu einem Heiler!«, befahl der Prinz. »Los, worauf wartet ihr noch!«
Ihr Kutscher Hans ließ sich das nicht zweimal sagen. Mit einem Schnalzen der Zügel setzte er die Droschke in Bewegung. Leander ließ sich zurück in die Polster fallen und schloss die Augen, doch das Bild der schreienden Frau ließ ihn nicht los. Irgendetwas nagte an ihm, etwas, das er nicht recht benennen konnte. Wäre es womöglich seine Pflicht gewesen, auszusteigen und selbst Hand anzulegen?
»Ihr hättet nichts weiter tun können, Hoheit«, holte Felix’ Stimme ihn aus seinen wirren Gedanken zurück.
Leander öffnete die Augen und sah seinen Diener an. Felix begegnete seinem Blick mit jener gelassenen Ernsthaftigkeit, die Leander manchmal zur Weißglut trieb und die ihn gleichzeitig beruhigte.
»Dieses Gekreische …«, begann er, dann stockte er. Es gab keinen Grund, sich zu rechtfertigen, und doch verspürte er das Bedürfnis, etwas zu sagen.
»Die Soldaten sind weit besser geeignet, der Frau zu helfen«, meinte Felix ruhig. Dann hob er die Brauen und zwinkerte Leander verschwörerisch zu. »Und wir sollten dringend etwas tun, um diesen schrecklichen Gestank aus unseren Nasen zu bekommen.«
Felix griff nach der kleinen Reisetasche, die neben ihm lag, und zog eine Flasche hervor. »Ich habe vorgesorgt, Hoheit, und etwas von Fürst Maximilians Weinvorräten eingepackt.«
Leander nahm die Flasche, betrachtete sie einen Moment und lachte trocken. »Natürlich hast du das. Was würde ich bloß ohne dich tun?«
»Das frage ich mich auch manchmal, Hoheit«, erwiderte Felix mit einem Augenzwinkern.
Leander ließ sich den Wein schmecken, während die Kutsche gemächlich weiterfuhr. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er, wie sie abbog und einem hölzernen Wegweiser nach Trällerbach folgte. Bald wären sie zurück, und diese grauenhafte Episode läge hinter ihm.
Vom Wein schläfrig geworden, schloss er die Augen und versuchte, an Drachen und heiße Küsse zu denken, während das sanfte Schaukeln der Kutsche ihn langsam in den Schlaf wiegte.
Thore schmunzelte zufrieden, während er von seinem Versteck aus beobachtete, wie sein Plan aufging. Die Kutsche mit dem Prinzen fuhr weiter, während die Männer der Eskorte sich hastig von ihren Pferden schwangen, um der vermeintlich verletzten Frau zu helfen.
Natürlich ahnten sie nicht, dass sie damit genau in seine Falle getappt waren. Bis sie ihre Aufgabe vollendet hatten, würde die Kutsche längst auf dem falschen Weg tiefer in den Wolfstann hinein sein – dank des Wegweisers, den seine Männer vorhin verstellt hatten. Sobald die Soldaten aufbrachen, würde der Pfeil am hölzernen Pfosten wieder in die richtige Richtung weisen, und die Bewaffneten würden den Weg nach Trällerbach einschlagen. Ihren Prinzen würden sie nie wieder einholen.
Natürlich waren die Räuber in der Überzahl und hätten die Soldaten auch leicht ohne diese List überwältigen können. Aber dann hätte es bestimmt Verletzte gegeben. Warum sollte Thore so ein Risiko eingehen, wenn es nicht unbedingt nötig war?
Wie erwartet, hatte der beißende Gestank von verrotteten Tierkadavern, garniert mit altem Bilsenkraut und wilder Zwiebel, den verwöhnten Prinzen rasch in die Flucht geschlagen. Es roch aber auch so abscheulich, dass selbst er kaum atmen konnte, während er auf der Lauer lag.
Er beobachtete, wie die Soldaten den schweren Baumstamm mit vereinten Kräften zur Seite rollten. Doch als sie sich dann zu der Frau hinabbeugten, um ihr aufzuhelfen, erhob sich diese mit Leichtigkeit. Sie klopfte sich den Staub von den Röcken, als wäre nichts gewesen.
Die Soldaten starrten sie verblüfft an. Mit einem kecken Grinsen hob Bess ihre Röcke bis zur Hüfte und präsentierte den Männern die nackte Haut ihrer Beine, die lediglich ein paar harmlose Kratzer zierten. »Alles in bester Ordnung, meine Helden!«, flötete sie und zwinkerte ihnen zu. »Überzeugt euch gern selbst davon!«
Thore biss sich auf die Zunge, um nicht laut loszulachen, als die Soldaten daraufhin ihre Hände nicht mehr bei sich behalten konnten. Eifrig betatschten sie die unverhüllten Beine der Frau mit ihren riesigen Händen. Eine Weile ließ Bess sie gewähren, ehe sie die Röcke wieder sinken ließ. »Genug jetzt«, sagte sie und schüttelte tadelnd den Kopf. »Ihr solltet euch lieber sputen, wenn ihr euren Prinzen einholen wollt! Es ist nicht gut, allein im Wolfstann unterwegs zu sein, bin ich nicht das beste Beispiel dafür?«
Die Männer blickten sich erschrocken um. Doch die Kutsche war längst aus ihrem Blickfeld verschwunden. Der Anführer der Truppe zögerte, sichtlich hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Versuchung. Erst als Bess sie mit einer wedelnden Handbewegung ungeduldig fortscheuchte, setzte er seine Männer mit einem scharfen Befehl in Bewegung.
Kaum waren auch die Reiter außer Sicht, da kam Thore breit grinsend aus seinem Versteck und reichte der Hure ihren vereinbarten Lohn. »Das Schauspiel war wahrlich jeden Gulden wert«, sagte er schmunzelnd, während Bess die Münzen geschickt in ihrem Mieder verschwinden ließ.
»Nur raus damit, wenn ich noch etwas für dich tun kann«, entgegnete sie keck und zwinkerte ihm verführerisch zu. »Bei so einem feschen Mannsbild wie dir nehme ich auch nur die Hälfte. Und nach der ganzen Fummelei wäre ich nicht abgeneigt, mich ein bisschen näher mit dir zu beschäftigen.«
Tatsächlich war der Anblick ihrer nackten Schenkel auch nicht ohne Wirkung auf Thore geblieben. Zu gerne hätte er sich das Weibsbild geschnappt und ihr gezeigt, wie gefährlich es werden konnte, ihn zu reizen. Doch unglücklicherweise fehlte ihm dazu die Zeit. So beschränkte sich Thore darauf, grob ihr Haar zu packen und sie mit einem Ruck an sich heranzuziehen. Erschrocken keuchte Bess auf, als er die Hüfte kreisen und sie spüren ließ, was für ein prächtiger Schwengel sich unter dem Stoff seiner Beinkleider befand. Gierig schob er seine Zunge zwischen ihre rotgeschminkten Lippen und plünderte ihren Mund. Seine Hände glitten an ihren Flanken nach unten, packten ihren Hintern und kneteten die prächtigen Backen. Bess stöhnte in seinen Mund, und als er sich schließlich von ihr löste, keuchte sie, als sei sie soeben den ganzen Weg von Trällerbach hierher gerannt.
»Geh jetzt«, sagte Thore streng und gab ihr einen kräftigen Klaps auf den Hintern. »Balinor wird dich begleiten, und wenn du ihm Unterschlupf für die Nacht gewährst, soll es dein Schaden nicht sein.«
Bess schob enttäuscht die Unterlippe vor, doch Thore hatte sich bereits abgewandt. Die Frau war vergessen – ebenso wie der harte Schaft zwischen seinen Beinen. Sein Blick wanderte in die Richtung, in die die Kutsche verschwunden war.
Er hatte eine Falle gestellt, und wenn ihn nicht alles täuschte, saß bereits ein Prinzlein darin.
Als Leander die Augen öffnete, fühlte er sich überraschend erfrischt – zumindest bis er aus dem Fenster sah. Bäume, so weit das Auge reichte. Kein Schloss, kein Dorf, kein Trällerbach.
Er gähnte ausgiebig, rieb sich mit beiden Händen übers Gesicht und verzog den Mund. »Wie überaus unerfreulich«, murrte er und warf Felix einen vorwurfsvollen Blick zu. »Kaum eingeschlummert, da bin ich auch schon wieder wach. Und zu Hause sind wir wohl immer noch nicht!«
Felix nickte verständnisvoll, widersprach jedoch leise: »Ihr irrt, Hoheit. Ihr habt tief geschlafen, gewiss eine Stunde oder länger. Seht nur, die Dämmerung hat bereits eingesetzt.«
Leander blinzelte und beugte sich erneut zum Fenster hinaus. Tatsächlich – die Schatten des Waldes waren länger geworden, und das einst strahlende Grün hatte sich in ein düsteres, unheimliches Grau verwandelt. Wie war das möglich? Sollten sie Trällerbach nicht längst erreicht haben?
Mit wachsender Ungeduld hämmerte er gegen die Wand der Kutsche, um Hans’ Aufmerksamkeit zu erregen.
Mit einem heftigen Ruck kam die Droschke zum Stehen. Leander beugte sich aus dem Fenster und rief aufgebracht: »Wie kann es sein, dass wir immer noch durch diesen verfluchten Wald zuckeln? Hast du etwa einen Abstecher zu deinem Liebchen gemacht, oder haben Kobolde unsere Räder mit unsichtbaren Bremsklötzen blockiert?«
Hans drehte sich auf dem Kutschbock zu ihm um, kratzte sich verlegen am Kopf und schaffte es nicht, seinem Prinzen in die Augen zu sehen. »Verzeiht, Hoheit … Ich … Es scheint, als hätte ich mich verfahren! Dabei habe ich die Wegweiser nach Trällerbach sorgfältig beachtet, das schwöre ich!«
Leander schnaubte und spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Doch bevor er eine spitze Bemerkung machen konnte, zeigte Hans zwischen die Bäume. »Seht, dort, Hoheit. Lichter! Gewiss ein Lager von Holzfällern oder der Meiler eines Köhlers. Ich dachte, wir könnten da nach dem Weg fragen.«
Leander folgte Hans’ ausgestrecktem Finger und entdeckte das Flackern von Lichtern, die wie Geisteraugen durch das Unterholz blitzten.
»So, dachtest du das!« Seine Stimme troff vor Spott. »Ein Prinz, der nach dem Weg fragen muss! Fantastisch!« Er ballte die Fäuste, atmete tief durch und zwang sich, seinen Zorn zu zügeln. Es hatte keinen Sinn, Hans anzuschreien – auch wenn es befriedigend gewesen wäre.
»Na schön«, sagte er schließlich und lehnte sich zurück. »Fahre zu den Waldgeistern oder wer auch immer dort haust. Aber vergiss nicht zu erwähnen, dass wir nur dank deiner Unfähigkeit in dieser misslichen Lage sind.«
Dennoch – er konnte nur hoffen, dass sich das nicht herumsprach. Er würde zum Gespött der Leute werden, nicht etwa Hans, dessen Schuld das doch alles war! Leander spürte, wie sein Magen sich verknotete. Maximilians Wein schien ihm nicht bekommen zu sein.
Felix räusperte sich leise. Als Leander zu ihm hinübersah, begegnete er seinem Blick, der wie immer ruhig und aufmerksam war.
»Die Holzfäller werden Augen machen«, meinte sein Diener, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. »Sicher haben sie noch nie einen Prinzen gesehen. Wahrscheinlich erzählen sie sich noch ewig am Lagerfeuer von der prächtigen Kutsche, und irgendwann ist es eine Geschichte, die sie ihren Enkeln vor dem Schlafengehen erzählen.«
Einen Moment lang hielt Leander inne. Dann unterdrückte er den Anflug eines Lächelns.
»Hah! Wenn schon, dann hoffe ich, sie vergessen nicht zu erwähnen, wie prunkvoll mein neues Wams ist«, murmelte er, während Hans die Kutsche bereits in Richtung der flackernden Lichter lenkte.
Ein weiteres Mal wurden sie ordentlich durchgeschüttelt, als die Kutsche über wurzelige Pfade rumpelte. Zunächst glaubte Leander, Hans habe recht behalten und sie würden auf ein Holzfällerlager stoßen. Doch als die Kutsche schließlich auf einer kleinen Lichtung zum Stehen kam, sah der Prinz, dass er sich geirrt hatte.
Vor ihnen erhob sich ein uraltes Gebäude, dessen hölzerne Balken unter dicken Moosflecken kaum noch zu erkennen waren. Die Fensterläden hingen schief in den Angeln, und aus dem krummen Schornstein quoll träge Rauch, der sich zäh in der feuchten Abendluft verlor. Über dem Eingang baumelte an zwei rostigen Eisenketten ein windschiefes Holzschild. Leander kniff die Augen zusammen und entzifferte mühsam die Worte: »Wirtshaus im Wolfstann«.
Ein Frösteln lief ihm über den Rücken. Dieses Haus war nicht nur heruntergekommen – es hatte etwas Unheimliches, als würde es die Dunkelheit des Waldes in sich aufsaugen.
»Wer um alles in der Welt sollte an diesem gottverlassenen Ort einkehren?«, murmelte Leander vor sich hin.
Hans kletterte vom Kutschbock und strich sich die Jacke glatt. »Hier kann man uns gewiss den richtigen Weg weisen, Hoheit.«
Doch Leander zögerte. Sein Blick wanderte zu den schmutzigen Fenstern, die wie blinde Augen auf die Lichtung starrten. Der Wald schien plötzlich noch stiller geworden zu sein, selbst das Rauschen der Blätter war verstummt.
»Halt!«, befahl er hastig. »Wo ist eigentlich die Eskorte? Sie müsste jeden Moment eintreffen. Wir sollten besser auf sie warten.«
Leander ließ sich wieder in die weichen Polster der Kutsche sinken, während er nach einer Erklärung für sein Zögern suchte, die ihn nicht wie einen Feigling dastehen ließ. Doch ehe ihm etwas einfiel, rief Felix plötzlich: »Schaut nur, Hoheit! Dort kommt jemand!«
Leander schnellte hoch und spähte aus dem Fenster. Am Rand der Lichtung bewegten sich zwei Gestalten durch das schwindende Licht. Ach, warum trug er nur seinen Dolch nicht bei sich!
Doch die Fremden wirkten alles andere als bedrohlich. Gekleidet in grobe, robuste Kleidung, hatte sich einer der Burschen eine bunt gemusterte Mütze tief über die Ohren gezogen, auf dem Kopf des anderen saß ein wenig schief und keck ein dunkler Schlapphut, sodass die breite Krempe sein halbes Gesicht verbarg. Beide trugen ein Bündel auf dem Rücken und hielten einen knorrigen Wanderstock in der Hand.
Leander atmete erleichtert auf. »Handwerksburschen auf der Walz«, stellte er fest, während die beiden sich ihnen weiter näherten.
»Guten Abend, die Herren!«, rief der mit der Mütze, kaum dass sie nahe genug an die Kutsche herangekommen waren. Er hob eine Hand zum Gruß, als wolle er einen Eid ablegen. »Ihr habt Glück! Das Wirtshaus im Wolfstann ist das beste Gasthaus weit und breit. Der Wein dort ist gewürzt wie in den feinsten Häusern – besser noch, wie ein Sonnenstrahl an einem Wintermorgen!« Sein breites Grinsen entblößte eine Zahnlücke, während sein Kamerad die Worte mit einem eifrigen Nicken bestätigte.
Hans hob interessiert den Kopf. »Ihr wart schon einmal hier?«
»Na klar!«, prahlte der mit der Mütze. »Sieht ja nach nix aus, aber drin ist es gemütlich wie in einer kuscheligen Bärenhöhle! Und der Wein ist der beste im ganzen Wolfstann. Ein Schluck davon, und die Kälte kriecht aus euch raus wie Mäuse aus einem Kornspeicher.«
Leander runzelte die Stirn. Bärenhöhle? Mäuse? Zudem hatten diese Burschen vermutlich eine ganz andere Vorstellung von gutem Wein als ein Prinz. »Wir müssen nach Trällerbach«, sagte er mit gespielter Geduld und musterte die beiden skeptisch. »Kommt ihr von dort?«
Der mit dem Schlapphut rieb sich nachdenklich das Kinn, als hätte er von diesem bedeutenden Ort noch nie gehört. »Trällerbach …?«, murmelte er gedehnt, dann deutete er in die Richtung, aus der die Kutsche gekommen war. »Da lang!«
»Nein, nein«, fiel ihm der mit der Mütze ins Wort und wies energisch in die entgegengesetzte Richtung. »Da geht’s doch nur tiefer in den Wald hinein. Bis ins Land der Kobolde würdet ihr fahren, wenn ihr diesem Pfad folgt. Da lang müsst ihr, und an der nächsten Abzweigung links.«
»Unsinn!«, murrte der mit dem Schlapphut und deutete vage in eine andere Richtung, wo nicht einmal ein Weg zu sehen war. »Das ist eine Sackgasse. Ihr solltet lieber den südlichen Pfad nehmen, das spart auch Zeit.«
»Papperlapapp!«, schnaubte der mit der Mütze und funkelte seinen Begleiter an. »Du tust ja, als hättest du zum Frühstück die Weisheit in dich hineingelöffelt!«
»Und du tust ja so, als hättest du den Wolfstann erbaut!«, konterte der andere, wobei ihm sein Schlapphut beinahe vom Kopf rutschte.
»Es geht nun mal hier lang«, erklärte der mit der Mütze selbstbewusst und malte mit seinem knorrigen Stock einen verschlungenen Weg in die Luft: »Links, dann rechts, nochmal rechts, dann wieder rechts, dann links, rechts, links – und schon seid ihr da!«
Leander seufzte und warf Felix einen genervten Blick zu. »Offensichtlich sind die beiden nicht besonders helle«, murmelte er.
Felix antwortete nicht, doch seine Mundwinkel zuckten leicht, als wollte er ein Kichern unterdrücken.
Leander richtete sich in seinem Sitz auf. »Wir kehren ein und warten in der Schenke auf die Eskorte«, bestimmte er schließlich. »Vielleicht verfügen die Wirtsleute über mehr Orientierungssinn.« Sein abfälliger Blick auf die beiden Burschen ließ keinen Zweifel daran, was er von ihrem Geschwätz hielt.
Insgeheim musste der Prinz jedoch zugeben, dass die Vorstellung, mit diesen möglicherweise ein wenig einfältigen, aber freundlichen Gesellen einen gewürzten Wein zu trinken, weitaus verlockender war, als weiter in der kühlen Kutsche auszuharren.
Das Wirtshaus im Wolfstann
Gemeinsam mit Hans, Felix und den beiden Handwerksburschen betrat Prinz Leander das Gasthaus. Ein Teil von ihm hatte gehofft, dass es drinnen ein wenig freundlicher wirken würde – vielleicht ein prasselndes Feuer, saubere Tische, ein Hauch von zivilisierter Gastfreundschaft. Doch diese Hoffnung wurde schnell enttäuscht.
Die Stube war düster und roch nach Moder und altem Rauch. Auf den Tischen schienen sämtliche Überreste des in den letzten Jahrzehnten verschütteten Weines zu kleben, und in allen Ecken hingen Spinnweben. Viel wärmer als draußen war es hier auch nicht.
Die Wirtin, die mit verschränkten Armen vor ihnen stand, passte perfekt zu diesem verwahrlosten Ort. Ihr wirres, graues Haar war zu einem schlampigen Dutt gebunden, der aussah, als hätte ihn eine Krähe gebaut, und eine große Warze prangte auf ihrer schiefen Nase. Leander schluckte unwillkürlich und fragte sich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, in der Kutsche zu warten.
Doch da rief der Handwerksbursche mit der Mütze: »Seht nur, wen wir euch mitgebracht haben! Solch elegante Reisende bekommt ihr gewiss nicht oft zu Gesicht. Habt ihr nicht einen eigenen Raum für die hohen Herrschaften? Es wäre doch schade, wenn sich die edlen Gäste mit dem gemeinen Volk in dieser … äh … charmanten Stube abgeben müssten!«
Die Wirtin stieß ein kurzes, meckerndes Lachen aus, das Leander unwillkürlich zusammenzucken ließ. »Na, wenn’s sein muss«, krächzte sie schließlich und deutete mit einem knochigen Finger auf eine wackelige Treppe im hinteren Teil der Stube. »Oben gibt’s einen Raum, der vielleicht euren edlen Nasen gerecht wird.«
Zweifelnd musterten die Neuankömmlinge die windschiefen Stufen. »Nach dir«, sagte Hans knapp, woraufhin die Wirtin erneut ihr meckerndes Lachen ausstieß und ohne zu zögern die knarrende Stiege erklomm.
Die Gruppe folgte ihr langsam und stieg die Treppe mit wachsendem Misstrauen hinauf. Oben angekommen öffnete die Wirtin eine schwere Tür und trat zur Seite, um den Blick auf das dahinterliegende Zimmer freizugeben.
Der Raum war klein, mit abgewetzten Sesseln, einem schiefen Tisch und vier schmalen Lagerstätten. Doch zumindest war er nicht ganz so verdreckt wie die Schankstube, und in einem winzigen Kamin flackerte sogar ein gemütliches Feuer.
»Ich hoffe, dieses Gemach trifft den Geschmack der herrschaftlichen Gäste«, spottete die Wirtin und wischte sich mit einer knochigen Hand die Nase. »Aber seid gewarnt – manchmal verirren sich die Ratten in die guten Zimmer. Sie wissen auch, wo das beste Essen zu finden ist.«
Leander schüttelte sich innerlich. In diesem heruntergekommenen Gasthaus würde er gewiss nichts essen. Aber gegen einen Humpen von dem angeblich so wunderbaren gewürzten Wein hätte er nichts einzuwenden.
»Es ist bereits dunkel. Wir sollten bis zum Morgengrauen hier in Sicherheit bleiben«, schlug Hans verlegen vor.
Leander schnaubte und richtete sich zu voller Größe auf. »Da ich offenbar mit einem Kutscher gestraft wurde, der schon bei Tageslicht den rechten Weg nicht findet, scheint das wohl klüger zu sein.«
Felix zog kaum merklich die Augenbrauen hoch, aber bevor sich Leander weiter ereifern konnte, kam der Handwerksbursche mit der Mütze wieder herein. Er balancierte drei Becher in den Händen, aus denen ein verlockender Duft aufstieg.
»Für unsere hochherrschaftlichen Gäste«, verkündete er mit einem schelmischen Grinsen und stellte die Becher auf den Tisch.
Der Prinz schnupperte interessiert und probierte vorsichtig, wonach er zugeben musste, dass die Wirtin offenbar unfähig war, einen Besen oder einen Putzlappen zu handhaben, aber davon, wie man einen Wein würzte, verstand sie etwas.
Auch Hans sprach dem roten Wein nach Kräften zu und stimmte mit dem Prinzen darin überein, dass der Rebensaft nach dem dritten Kelch sogar noch besser schmeckte als beim ersten Schluck. Nur Felix schien dem Getränk wenig abgewinnen zu können. Sein Becher blieb fast unberührt, und schließlich schob er ihn seufzend Leander zu, der ihn mit einem amüsierten Grinsen entgegennahm.
Nicht, dass es nötig gewesen wäre. Die beiden Handwerksburschen, die sie vor der Wirtschaft getroffen hatten, schienen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, sie mit Nachschub zu versorgen. Kaum war ein Becher geleert, tauchte einer der beiden mit einem frischen auf.
Jedes Mal, wenn die Burschen den Raum betraten, bemerkte Leander, wie viel voller und lauter es unten geworden war. Von der Schankstube drangen Gelächter, lautes Gegröle und das Klirren von Krügen herauf. Es ging hoch her, und Leander war mehr als erleichtert, dass er nicht bei diesen ungehobelten Gestalten sitzen musste.
Doch insgeheim fragte er sich schon, woher all diese trinkfreudigen Gäste plötzlich kamen. Er war schon oft durch den Wolfstann gereist, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Wirklich seltsam.
Mit jedem Schluck wurde diese Frage jedoch bedeutungsloser. Der Wein machte alles weicher, verschwommener. Leander ließ sich tiefer in die Polster seines Sessels sinken. Die warme Luft des Feuers vermischte sich mit dem beruhigenden Summen des Alkohols in seinem Kopf, und er schloss träge die Augen.
Nur Felix störte seine Ruhe, da er scheinbar einfach nicht stillsitzen konnte. Unruhig rutschte sein Diener auf seinem Platz hin und her, bis er schließlich leise zur Tür hinausschlüpfte.
Hm. Wahrscheinlich war er losgezogen, um noch Holz für das Feuer zu holen. Leander wäre es lieber gewesen, wenn Felix ihm vorher aus den unbequemen Stiefeln geholfen hätte, doch zu seinem Glück übernahm Hans diese Aufgabe mit geübten Händen.
Zufrieden streckte der Prinz seine bestrumpften Beine aus und ließ den Kopf erneut in die Polster sinken.
»Hoheit! Hoheit, bitte wacht auf! Ihr seid in großer Gefahr!«
Felix schüttelte ihn kräftig an den Schultern, und allein dieser Umstand sorgte dafür, dass Leander rasch erwachte. So ein unerhörtes Benehmen war ja noch nie vorgekommen! Doch wo war er? Ach ja, dieser unfähige Hans hatte sie statt in das Schloss Trällerbach in eine heruntergekommene Wirtschaft chauffiert. Und jetzt spielte auch noch sein Diener verrückt. Was war nur los mit dieser Welt?
Felix ließ ihn kaum Luft holen. »Dem Himmel sei Dank, Hoheit! Bitte, Ihr müsst mir zuhören. Ihr seid in Gefahr!« Seine Stimme war eindringlich, fast flehend. »Ich habe die anderen Gäste belauscht. Es sind keine harmlosen Trunkenbolde – es sind die Räuber!«
Leander blinzelte irritiert. »Räuber? Hier? Unsinn!« Er schüttelte den Kopf und versuchte, sich aufzurichten, doch sein Körper war schwer wie Blei. »Leg dich endlich hin und geh mir nicht auf die Nerven, nur weil du nicht schlafen kannst.« Er schnaubte abfällig. »Darüber reden wir noch!«
Doch Felix rührte sich nicht vom Fleck. »Ist Euch denn gar nichts seltsam vorgekommen?«, flüsterte er drängend. »Erst die verletzte Frau, dann verirrt sich Hans, der uns schon so oft sicher durch den Wald gebracht hat. Und dieses Wirtshaus …« Er machte eine weit ausholende Geste. »Eine beheizte Stube, die wie durch Zauberei auf uns gewartet hat? Das stinkt doch alles zum Himmel!«
»Gestunken hat es nur bei der Frau«, maulte Leander, doch er hörte selbst, dass er weniger überzeugend klang, als es wünschenswert gewesen wäre. Felix’ Worte sickerten in seinen Kopf, und obwohl er sich bemühte, sie abzuschütteln, regten sich Zweifel in ihm.
»Es war eine Falle!«, flüsterte Felix, jetzt so leise, dass sich Leander aufrichten musste, um ihn zu verstehen. »Hans kann nichts dafür, dass wir uns verfahren haben – die Wegweiser waren absichtlich verstellt. Die beiden Handwerksburschen gehören zu den Räubern. Ihre Aufgabe war es, uns zu täuschen, uns in Sicherheit zu wiegen. Die Eskorte wird niemals eintreffen. Wir sind allein.«
Leander starrte Felix an. »Von einem erfahrenen Kutscher wie Hans hätte ich erwartet, dass er nicht auf falsche Schilder hereinfällt«, grummelte er schließlich, mehr aus Trotz als aus Überzeugung.
Felix warf einen kurzen Blick auf Hans, der zusammengesunken und tief schlafend auf einem der Sessel saß. »Sie planen, Euch gefangen zu nehmen, Hoheit«, fuhr Felix atemlos fort. »Hans und mich werden sie zurückschicken, um dem Herrn Grafen eine Botschaft zu überbringen. Sie wollen eine ›Belohnung‹, weil sie Euch ›in Sicherheit‹ gebracht haben.«
Ein Schauer lief Leander über den Rücken. Jetzt spürte er es – das Prickeln nackter Angst. Was, wenn Felix recht hatte? Was, wenn sie tatsächlich von Räubern umzingelt waren?
Die Vorstellung, in die Gewalt dieser Gauner zu geraten, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Sie würden ihn festhalten, ihn wie ein Tier behandeln, vielleicht sogar …
Er presste die Hände gegen die Schläfen. Ihm wurde flau im Magen.
»Das werde ich nicht zulassen!«, sagte Felix fest.
Leander starrte ihn an, seine Gedanken noch schwer vom Wein. »Was könnten wir schon gegen eine ganze Räuberbande ausrichten?«, fragte er schließlich mit einem traurigen Lächeln. »Wir haben ja nicht einmal meine Jagdwaffen. Die liegen noch in der Kutsche.«
Er seufzte und schloss für einen Moment die Augen, während seine Gedanken zu einer heldenhaften Vorstellung abschweiften. Wäre doch nur seine Armbrust zur Hand! Dann könnte er Felix und Hans verteidigen, bis die Eskorte merkte, dass etwas nicht stimmte und sie hier aufspürte. Immerhin war er es gewesen, der den prächtigen Fasan erlegt hatte – gewiss würden die Räuber es nicht wagen, sich ihm entgegenzustellen.
»Hoheit!«, rief Felix eindringlich. »Nicht wieder einschlafen! Hört mir doch zu!«
Leander blinzelte irritiert. »Was?«, murmelte er.
»Wir tauschen die Kleider«, erklärte Felix entschlossen. »Dann denken die Räuber, ich sei der Prinz, und halten mich hier fest. Ihr könnt mit Hans fliehen.«
»Das geht doch nicht …«, protestierte Leander. Nicht sehr vehement, wie er zugeben musste.